Review: TITANIC (Theater Erfurt)


von Marcel Konrath
1985 wurde das Wrack der RMS Titanic etwa 370 Meilen (600 km) südsüdöstlich vor der Küste Neufundlands in einer Tiefe von etwa 12.500 Fuß unter der Oberfläche des Atlantischen Ozeans entdeckt. Dies nahm der Komponist Maury Yeston zum Anlass, sich intensiver mit dem Thema der Titanic Katastrophe zu beschäftigen. Yeston, der mit Musicals wie „Nine“ und „Grand Hotel“ vor allem Kritiker begeisterte, entschied sich für eine bewusste klassische Auseinandersetzung mit der Musik für sein Musical. „Ich wusste, dass ich eine ähnliche Farbe haben musste wie die Musik der großen Komponisten dieser Zeit, wie Elgar oder Vaughan Williams; das war für mich eine Gelegenheit, ein Element der symphonischen Tradition in das Musiktheater zu bringen, das wir, glaube ich, vorher nicht hatten. Das war sehr aufregend.“ Die Show wurde für 5 Tonys nominiert und gewann alle Auszeichnungen, u.a. auch als bestes Musical und die beste Komposition. Auf beachte 804 Vorstellungen schaffte es die Produktion am Broadway. Nach diversen internationalen Aufführungen, entschied sich das Theater Erfurt „Titanic“ auf den Spielplan 2023/24 zu setzen: ein Ambitioniertes und mutiges Unterfangen. Dass, was Erfurt hier auffährt ist opulent und überaus beeindruckend in der Quantität des Ensembles. Neben dem großen Cast, der vornehmlich aus Gästen besteht, beeindruckt vor allem auch der gigantisch große Opernchor (Choreinstudierung Markus Baisch) in der kongenialen Inszenierung von Stephan Witzlinger. Schon mit den ersten Tönen der Ouvertüre wird deutlich: der wahre Star des Abends ist das fulminante philharmonische Orchester unter der exquisiten Leitung von Clemens Fieguth. Die Idee die Musiker auf der Bühne, als Teil des Schiffes zu platzieren ist ein Geniestreich. So ist das Orchester ein wichtiger Teil der Produktion, welcher sich eloquent auf die Bühne von Lena Scheerer einfügt. Scheerer gelingt es vortrefflich mit wenigen, aber effektiven Mitteln den Luxusdampfer wieder zum Leben zu erwecken und wartet vor allem beim Untergang der Titanic mit spektakulären und wirkungsvollen Effekten auf. Dies sind Theatermomente, die bleiben und noch lange nachhallen werden.

„Titanic“ legt den Fokus vor allem auf historische Figuren wie Kapitän Smith, souverän gespielt von Martin Sommerlatte und Schiffskonstrukteur Thomas Andrews (eindringlich: Dennis Weissert). Da ist zum Beispiel der hoffnungsvolle, naive Heizer Frederic Barrett, überzeugend von Daniel Eckert verkörpert und die junge Kate McGowan (gut: Johanna Spanzel), die Ihr Glück in Amerika finden will. Auch wenn Autor Peter Stone versucht die Vielfalt der Menschen an Bord und ihre unterschiedlichen Hintergründe aufzuzeigen, wirkt die Handlung zu episodenhaft und vor allem einige Dialoge (deutsche Übersetzung: Wolfang Adenberg) zu hölzern und konstruiert. Das Musical verfolgt die Ereignisse vor, während und nach dem Untergang der Titanic. Das gelingt in puncto Emotionalität mal mehr, mal weniger überzeugend. Zu bruchstückhaft werden die Geschichten von Charakteren aus den drei sozialen Klassen, darunter Passagiere, Crewmitglieder und Offiziere präsentiert. Die Handlung versucht sich auf ihre individuellen Geschichten, Hoffnungen und Träume zu konzentrieren. Da ist das Ehepaar Beane an Board, bei dem sich Alice, großartig gespielt und gesungen von Katja Bildt, ihren scheinbar nicht zu erreichenden Illusionen, Teil der ersten Klasse zu sein hingibt. Ihr Mann Edgar, der wenig glaubhaft, als sei er in einem anderen Stück, von Benjamin Ebeling dargestellt wird, versucht sie immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Als Passagiere der ersten Klasse sind Kerstin Ibald und Martin Berger als Isidor und Ida Straus herzzerreißend rührend. Ihre Rollen und ihr gemeinsames Duett („Wie vor aller Zeit“) sind es dann auch, die nachhaltig beeindrucken und bewegen.
Mit „Titanic“ gelingt Regisseur Stephan Witzlinger und seinem glänzenden Team eine beeindruckende Gesamtleistung (Choreografie: Kerstin Ried), wäre da nicht ein ganz unwesentlich wichtiger Faktor für ein Musical, der hier etwas unangenehm aufstößt: die Musik. Die Komposition von Yeston bewegt sich häufig zwischen Oper und Symphonie und ist zwar durchaus schöpferisch wertvoll, mitunter aber schwer antizipierbar. Mit Ausnahme der Eröffnungsnummer, die beeindruckend inszenatorisch und musikalisch gelingt, gibt es kaum Songs die ins Ohr gehen. Yeston versucht mit seiner Musik emotionale Resonanz zu erzeugen, verliert sich aber zu häufig darin. Die Idee mit seiner Komposition die Handlung voranzutreiben und die Erzählung zu unterstützen, gelingt ihm oft nur grobflächig, denn zu sperrig und verklausuliert geraten die teilweise atonalen Melodien. Intervallsprünge und unkonventionelle Klangfarben gestalten es häufig schwierig seiner Musik zu folgen, wirken schon beinahe avantgardistisch und erinnern an Werke von Arnold Schönberg oder Alban Berg.
Sehenswert ist das Stück am Theater Erfurt aber allemal und das liegt vor allem an der fantastischen Symbiose aus Orchester, Regie, Bühne, Licht (Florian Hahn) und Ensemble. Diese „Titanic“ ist definitiv nicht dem Untergang geweiht, sondern ein astreiner Hit!



Review: SOMETHING ROTTEN! (English Theatre Frankfurt)

von Marcel Konrath
„What the hell are musicals?! „It appears to be a play where the dialogue stops and the plot is conveyed through song.“ Klingt doch nach einer vortrefflichen Idee. Gut seien wir ehrlich, Menschen die sich gegenseitig ansingen, in musikalische Monologe abdriften oder eine Eleven o‘ clock belten, sind vollkommen unrealistische Utopien. Gleichzeitig sind Musicals nicht nur ein Garant für volle Häuser, sondern machen viel Spaß, berühren und entführen in andere Welten. Wir befinden uns bei „Something Rotten!“ in der Renaissance „with poets, painters, and bon vivants and merry minstrels who strolled the streets of London.“ Es ist die Zeit von Dürer und Michelangelo, Dante Alighieris Göttlicher Komödie, der Venus von Botticelli und der Blütezeit von William Shakespeare.
„Welcome to the Renaissance!“
So spielt die die Handlung von „Something Rotten!“ im London des 16. Jahrhunderts und dreht sich um die zwei rivalisierenden Brüder, Nick und Nigel Bottom, die versuchen, endlich einen Hit für das Theater zu schreiben. Dabei geraten sie in Konkurrenz mit dem Rockstar-ähnlichen Shakespeare (Matt Beveridge), der im Stückeschreiben wesentlich erfolgreicher ist als die beiden Brüder. Wobei sich Shakespeare teilweise etwas unorthodoxer Methoden bedient um an sein Ziel zu kommen. In ihrer Verzweiflung wenden sie sich an einen Wahrsager, der ihnen prophezeit, dass die Zukunft des Theaters im Musical liegt. Dies bringt sie auf die Idee, das allererste Musical zu schreiben.


Mit „Something Rotten!“ sicherte sich das English Theatre Frankfurt, die deutsche Uraufführung in des für 10 Tony Awards nominierten Musicals aus der Feder der Brüder Karey und Wayne Kirkpatrick. Was das großartig auftrumpfende Ensemble unter der Regie von Ewan Jones in der deutschen Premiere der Show auf die Bühne (Set und Kostüme: Stewart J. Charlesworth) zaubert ist eine wunderbare, herrlich absurd alberne Farce. Auch wenn das Buch von John O’Farrell und Karey Kirkpatrick stark überzeichnet ist und die Gagdichte gut funktioniert, werden die Charakter nie der Lächerlichkeit preisgegeben und sind mehr als bloße funktionierende Schablonen. Greg Miller Burns ist als Nick mit einem guten Gespür für comic timing gesegnet, singt fantastisch und stattet seine Figur aber mit ebenso viel Tiefe wie Herz aus. Als sein Bruder Nigel steht ihm mit Sami Kedar ein ebenbürtiger Partner zur Seite, der genussvoll sämtliche Nuancen auf seiner künstlerischen Partitur spielt. Mit dem waschechten Showstopper „It’s A Musical“ gelingt Tom Watson als Nostradamus eine echte tour-de-force performance. In dem Song, in dem sämtliche Musicals von „Les Miserables“, „Rent“, „Chicago“, „The Music Man“, „Seussical“, „South Pacific“, „Evita“, „Annie“ über „Guys & Dolls“, „A Chorus Line“, „Sweet Charity“, „Hello Dolly“, „Cats“ und „Sweeney Todd“ rezitiert werden, gehört zu den vielen Highlights des Abends. Hier stimmt einfach alles und insbesondere für Musical Liebhaber*innen ist sowohl der Song, wie auch die gesamte Show ein süffisant, nerdiges Vergnügen. Die Kirkpatrick Brüder spielen dabei mit gängigen Klischees („Wait, so an actor is saying his lines and then, out of nowhere, he just starts singing?“) und hinterfragen dabei scharf: „It’s absurd. Who on Earth is going to sit there while an actor breaks into song? What possible thought could the audience think other than ‚this is horribly wrong‘?“ Dabei ist die Herangehensweise der Autoren und Komponisten immer liebevoll überspitzt und dabei beißend witzig. Auch aktuelle Bezüge werden immer wieder augenzwinkernd eingeflochten. Selbstverständlich wird das Patriarchat dabei konsequent auf die Schippe genommen. Hierarchische Geschlechterstrukturen werden grandios ad absurdum geführt, wenn Nigels Frau Bea (großartig und stimmstark: Rachael Archer) ihrem Gatten offeriert „Think of me as your sidekick, helping you whenever I can. I’m more than just a woman. When the pressure’s coming, let me be your right-hand man.“ Als Running gag taucht Bea dann immer wieder in männlichen Rollen auf, da sie beweisen will, dass Frauen ohne Frage fähig sind, Männerjobs auszuführen. Bea, eine klare Anspielung auf die scharfzüngige und emanzipierte Beatrice in „Much Ado About Nothing“ reiht sich in die Namen vieler Protagonist*innen ein, die aus Shakespeare Stücken adaptiert wurden. So verliebt sich Nigel in die, von Briana Kelly quirlig gespielte Portia („The Merchant of Venice“) Jonathan Norman ist als Investor Shylock („The Merchant of Venice“) zu sehen und der Nachname der Brüder Button bezieht sich ohne Zweifel auf eine der denkwürdigsten Figuren Shakespeares in „A Midsummer Night’s Dream“. Die Parallelen zum Shakespeare Gesamtwerk werden immer wieder humorvoll eingewoben und garantieren für einen genussvoll amüsanten Abend („Bottom’s Gonna Be on Top“).


Mit viel Charme und Drive schafft es Regisseur Ewan Jones, der auch gleichzeitig für die Choreografie verantwortlich zeichnet das Maximum aus seinem Ensemble herauszuholen. Dazu eigenen sich die Kompositionen (Musical Director: Mal Hall) auch hervorragend, denn die bieten alles was ein gutes Musical baucht: echte Showstopper („It’s A Musical“ und „Welcome to the Renaissance“), dramatisch anmutende Balladen („I Love The Way“) und steppende Ensemblenummern („We See The Light“). „What could be more amazing than a musical? With song and dance and sweet romance.“
Aber noch einmal zurück zum multitalentierten Ensemble, denn die müssen an dieser Stelle alle unbedingt und ausdrücklich namentlich genannt werden: Bradley Adams, Bethany Amber-Wilde, William Beckerleg, Estelle Denison-French, Liam Huband, Jonathan Norman, Chris Tarsey und Myles Waby leisten großartiges. Oft bleiben ihnen nur wenige, hauchdünne Sekunden für Kostümwechsel, dabei spielen und singen alle mit solcher Passion, Hingabe und Präsenz ihre unterschiedlichen und zahlreichen Rollen, dass es eine wahre Freude ist, diese überschäumende Spielfreude mitverfolgen zu dürfen.
Dem English Theatre gelingt mit „Something Rotten!“ ein waschechter Hit, von dem man sich erhofft, das er zukünftig den Weg auf viele weitere deutsche Bühnen finden wird. „Take it from me they’ll be flocking to see your star-lit, won’t quit big hit, musical“ und das wünscht man dem English Theatre für die Weitsicht dieses Stück endlich nach Deutschland zu bringen, von Herzen.

Review: THE PRODUCERS (Musikalische Komödie Leipzig)

von Marcel Konrath
Broadway Flops gehören zum Great White Way In New York ebenso dazu, wie die gigantischen Erfolge. Nur sind Flops Szenarien, die jeder Broadway und Musical Produzent tunlichst vermeiden möchte. Eine Horror Nouvelle von Stephen King als abendfüllendes Musical? Gute Idee? Dass dachten sich zumindest die damaligen Produzenten, mussten jedoch nach dem Horror der auf der Bühne stattfand, gleichzeitig mit den horrenden, vernichtenden Kritiken umgehen und das Stück musste nach nur 5 Vorstellungen schließen. 8 Millionen Dollar waren so auf einmal komplett in den Sand gesetzt und „Carrie“ ging als einer der größten Flops in die Broadway Geschichte ein. Jedoch, könnte man damit nicht sogar mehr Profit machen als mit einem Erfolg? Der Ansicht sind zumindest Max Bialystock, ein windiger, aber zuletzt glückloser Theaterproduzent und sein neurotisch-verklemmter Buchhalter Leo Bloom. Sie haben den scheinbar perfekten Plan. Sie wollen die schlechteste Show aller Zeiten auf die Bühne bringen und einen vorprogrammierten Flop landen. Mit dem schauderhaften Machwerk „Frühling für Hitler“, verfasst von Franz Liebkind, einem vertrottelten Altnazi, glauben sie, das schlechteste Stück aller Zeiten gefunden zu haben. Als Regisseur engagieren sie den aufgeblasenen, aber gänzlich unbegabten Roger de Bris und sein offensichtlich talentloses Team.
Bialystock und Bloom sind siegessicher – das wird die unmöglichste Show, die der Broadway je gesehen hat, so unerträglich peinlich und geschmacklos, dass die Zuschauer noch vor dem letzten Vorhang das Theater verlassen werden. Zu einer zweiten Vorstellung soll es gar nicht erst kommen. Doch die beiden Produzenten haben die Rechnung ohne das Publikum gemacht: Ihre Show wird als geniale Farce verstanden und gerät zu einem gefeierten Hit. Damit stehen Bialystock und Bloom vor handfesten Problemen…
„The Producers“ aus der Feder von Comedy Titan Mel Brooks ist bereits selbst längst Broadway Legende geworden. Das Stück gewann stolze 12 Tony Awards und lief über 2.500 Vorstellungen. Die Melodien gehen direkt ins Ohr und reihen Ohrwurm an Ohrwurm. „The King Of Broadway“, „I Wanna Be A Producer“, „Keep It Gay“ oder „Springtime For Hitler“ sind nur einige von Brooks denkwürdigen Kreationen. Das Musical kam damals zur rechten Zeit, war die Uraufführung doch im 9/11 Jahr, in der das Publikum nach dieser fürchterlichen Tragödie nach leichter Unterhaltung gierte. Den Kopf abzuschalten und kurzerhand alles um einen herum zu vergessen, gelingt in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden nur bedingt. In einer kriegsgeprägten Ära, in der eine rechtsradikale, homophobe Partei Höchststimmen erzielt und in der braunes Gedankengut verbreitet wird, hält die Inszenierung von Dominik Wilgenbus an der Musikalischen Komödie Leipzig den Finger in die Wunde. Das gelingt dem Regisseur allerdings vortrefflich. Auch wenn sicher der ein oder andere Gag etwas plakativ und überstrapaziert wirkt, ist seine Interpretation von Brooks Show erstaunlich aktuell und erschreckend zeitkritisch. Dass bei allen aktuellen, politischen Eskalationen die Stimmung nicht kippt, ist Wilgenbus sehr zu Gute zu erhalten. Er findet eine gute Balance aus hemmungsloser, alberner Komik und sozialkritischen Tönen. Auf dieser Partitur spielt sein glänzend auftrumpfendes Ensemble fast durchgehend hervorragend. Nur hier und da sind ein paar Dissonanzen zu vernehmen.
Nick Körber kann als Leo Bloom leider nicht überzeugen. Er hatte vor der Premiere das obligatorische break a leg / Hals und Beinbruch etwas zu wörtlich genommen und seinen großen Zeh gebrochen. In den Tanzszenen wird er so kongenial mit geschmeidiger Leichtigkeit von Tänzer Pietro Pelleri vertreten. Auch wenn es Körber anzurechnen ist, dass er das Showbusiness Mantra „the Show must go on“ sehr ernst nimmt, kann er schauspielerisch wie gesanglich der Figur des Leo nicht genügend Überzeugung einhauchen. Seine Panikattacken im Stück sind wenig glaubhaft, sein Spiel zu forciert und unglaubwürdig. Besonders im direkten vergleich zu seinem Bühnenpartner Patrick Rohbeck fällt er deutlich ab.


Als Max Bialystock ist Rohbeck nämlich all dass, was die Rolle des schleimigen, nach Erfolg gierenden Produzenten ausmacht: schauspielerisch auf den Punkt, mit einem guten Gespür für Komik, gepaart mit einer solider Stimme. Besonders seine Nummer „Verrat“ im zweiten Akt, gehört zu seinen glänzenden Highlights. Rohbeck ist eine Idealbesetzung als Max. Echtes Broadway Feeling bringt Olivia Delauré als Ulla auf die Leipziger Bühne. Als Triple Threat kann sie gesanglich, schauspielerisch und vor allem tänzerisch überzeugen. In der Choreo von Mirko Mahr (Step-Choreographie Illia Bukharov) gibt Delauré buchstäblich alles und landet mit ihrer herrlich schwedisch säuselnden Interpretation der Ulla einen absoluten Volltreffer. Franz Liebkind wird von Michael Raschle zwar als hohler, aber auch gefährlicher Alt Nazi dargestellt. Mit seinen Auftritten hat er alle Lacher auf seiner Seite und hat dazu mit seinen Tauben noch eine mit sehr „speziellem“ Namen im Verschlag beherbergt. Dem larger than life Regisseur Roger deBris gibt Andreas Rainer Gesicht und Stimme. Zwischen Slapstick, gnadenloser Komik und guten gesanglichen Qualitäten ist Rainer als Hitler eine echte Wucht und löst beim Premierenpublikum wahre Beifallsstürme aus. Darf man über Hitler lachen? Die Antwort ist eindeutig: auf jeden Fall, wenn er so großartig überspitzt, zum Brüllen komisch und knallhart der Lächerlichkeit preisgegeben wird, wie hier. Jeffery Krueger ist eine herrliche doppelzüngige Carmen Ghia und erstaunliche nahe an Originalübersetzung Roger Bart. Angela Mehling lässt als Grabsch-mich-tatsch-mich keine Wünsche übrig und begeistert gleich in mehreren Rollen. Jedoch wirkt der Chor der Musikalischen Komödie etwas hölzern und kann es hier nicht ganz mit einem Musicalensemble aufnehmen. So sind einige Interaktionen nicht immer poliert pointiert und lassen etwas Agilität vermissen.Das Bühnenbild von Peter Engel ist doch etwas sehr karg und rudimentär geraten. Das Büro von Max sieht eher aus wie eine Spelunke in Harlem und Roger de Bris hat lediglich ein Sofa in Kussform zur Verfügung. Auch wenn das dem vergnüglichen Abend keinen Abbruch verschafft, hätte man hier oder da doch etwas phantasievoll ausladender arbeiten dürfen und monetär investieren können. Die Kostüme von Uschi Haug sind stückdeckend passend designt und interpretiert und können vor allem bei der Nummer „Frühling für Hitler“ visuell imponieren.
Unter der musikalischen Leitung von Michael Nündel könnte das Orchester der Musikalischen Komödie manchmal etwas mehr Drive und Tempo vertragen, sorgt aber für einen souveränen Gesamteindruck. Regisseur Dominik Wilgenbus macht mit seinen klugen politischen Einfällen vieles richtig, manchmal fehlt es allerdings an Timing und Drive. Einige Anschlüsse wirken etwas behäbig und schleppend. Die deutsche Übersetzung von Nina Schneider funktioniert gut, auch wenn natürlich einige Originalwitze unübersetzbar sind, macht Schneider einen sehr guten Job. „The Producers“ ist in Leipzig ein überaus gelungener Abend mit marginalen Abstrichen, der vor allem wegen dem viel zu selten gespielten Stück lohnt. Leipzig zeigt hier wieder einmal den Mut, auch selten gespielten Shows eine Chance zu geben.
Max und Leo hätte es sicher nicht gefreut, aber diese Show ist ein Hit!

Fotos Kirsten Nijhof
Bonnie Tyler live in Nürnberg: 40 Jahre "Total Eclipse Of The Heart"
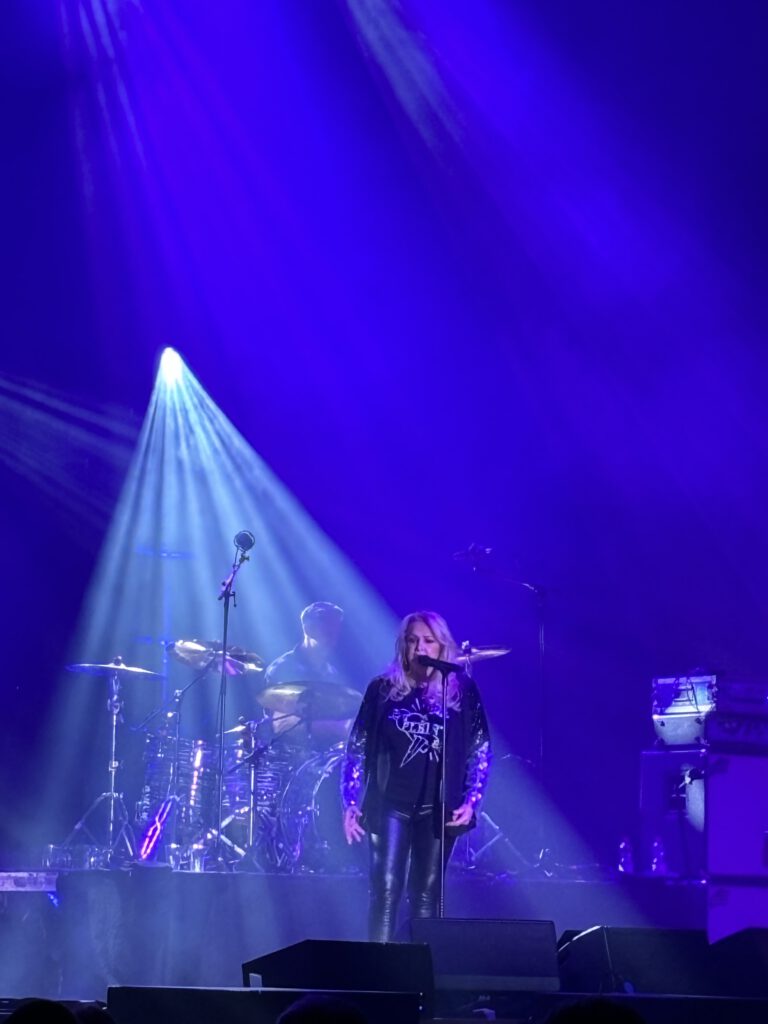
von Marcel Konrath
Das Konzert in der Meistersingerhalle Nürnberg ist bestuhlt. Die Künstlerin, die hier heute Abend auftritt, spielt alterstechnisch in der selben Liga wie 90% ihres Publikums. Viele sind mit ihr aufgewachsen, meine Eltern haben „Faster Than the Speed of Night“ in ihrer Schallplatten Sammlung. Ich sehe Frauen mit aufwendigen, Strass- und Glitzerverzierten Lederjacken und Männer mit T Shirts von der Sängerin, für die alle hier sind: Bonnie Tyler. Die Britin mit der unverwechselbaren, Reibeisenstimme, die ihr Markenzeichen ist, macht mit ihrer „40 Jahre Total Eclipse Of The Heart“ Tour auch in Franken halt. Schon erstaunlich diese Stimme, die immer so klingt als sei sie nach mehreren Packungen Zigaretten und extra viel Whisky einem stetig wachsenden Reifeprozess durchzogen wurden. Könnte man auf jeden Fall denken. Doch in einem Interview mit dem österreichischen Kurier konterte Tyler „Viele Rock-Stars sagen: ,Wir müssen für so ein Organ hart arbeiten, Dutzende Zigaretten rauchen und Whiskey trinken. Ich bin damit geboren – ich habe nie geraucht.“ Ihre Stimme ist immer noch unverwechselbar, eine Stimme die man unter Tausenden heraushören würde, jedoch immer mit der Fallhöhe, sie könnte irgendwann dann doch den ein oder anderen Ton nicht mehr schaffen und kippen. Ein Spagat zwischen Stimmvolumen und Stimmversagen. Dass sich letzteres nicht bewahrheitet, liegt auch an der Unterstützung ihrer formidablen Band, die Tyler aufrichtig gerührt vorstellt. Sogar ihr Promoter und Manager wird auf die Bühne gebeten, mit dem sie fast genauso lange zusammen arbeitet, wie sie mit ihrem Mann Robert verheiratet ist und das sind stolze 50 Jahre.

Tyler gibt ihren Fans natürlich genau dass, wofür sie ein Ticket gekauft haben: ihre großen 80er Hits wie „Made in France“, „It’s A Heartache“, „Faster Than the Speed of Night“, „Have You Ever Seen The Rain?“ und natürlich „Total Eclipse Of The Heart“, den ikonischen Song den Jim Steinman ihr schenkte und den sie nach eigenen Angaben immer noch so gerne singt. Das Publikum ist hier nicht mehr zu halten, die Arme werden nach oben gestreckt, Handys gezückt und „turn around bright eyes“ lautstark mitgesungen. Stolz verkündet Tyler, dass ihr Song und das zugehörige Video die eine Milliarde Marke auf der Plattform Youtube überschritten hat. Eine Ehre, die nicht vielen Künstler*innen zuteil kommt. „Straight From The Heart“ aus dem Album „Faster Than the Speed of Night“ wurde nicht nur von Bryan Adams geschrieben, es ist auch der Titel ihrer bald erscheinenden Autobiographie. Lange habe sie sich geweigert ihre Memoiren zu schreiben, doch ein Verlag habe sie letztendlich doch überreden können, ihre Gedanken und ihr bewegtes Leben zu Papier zu bringen. Hier können wir sicher einige interessante Begegnungen der Musikgeschichte erwarten. Mit „Simply The Best“ ehrt sie die kürzlich verstorbene Legende Tina Turner. Der Song erschien 1988 auf Tylers Album „Hide Your Heart“, floppte zunächst und wurde dann durch Turner zum Welthit und ihrem bekanntesten Song. Mit gerade einmal 55 Minuten Spielzeit verabschiedet sich Tyler dann bereits überraschend von ihrem Publikum. Ich frage mich tatsächlich ob nun eine Pause folgt, doch das Saallicht geht nicht an, die Scheinwerfer bleiben auf die Bühne fokussiert. Es folgt ein Janis Joplin Song, bei dem die Band zeigen kann, was sie musikalisch drauf hat, bevor Bonnie dann als letzte Zugabe ihren Monsterhit „Holding Out For A Hero“ zum Besten gibt, mit reger Publikumsunterstützung. Auch wenn Tyler mit 72 Jahren immer noch fit ist, merkt man ihr an, dass sie nicht mehr ganz die Ausdauer für ein abendfüllendes Konzert hat. Sie wirkt etwas angeschlagen, als sie sich am Mikrofonständer festhält. Nach knackigen 75 Minuten ist Schluss. Auch wenn der ein oder andere Ton nicht mehr zu 100% sitzt, liefert die britische Sängerin eine solide, routinierte Show ab, die genau das beinhaltet was ihr Publikum erwartet: ein zündendes Fest der 80er Jahre, von dem Bonnie Tyler ein großer Bestandteil ist.
Fotos Marcel Konrath
Mein Festivalbericht vom ersten Tag des Lido Sounds Festival in Linz

von Marcel Konrath
Alleine auf einem Festival zu sein widerstrebt dem Wort und Sinn Festival. Wie kann man ein Fest alleine bestreiten, dass doch dazu wie gemacht ist als Duo, Trio oder Gruppe den Moment des Augenblicks zu zelebrieren? Die Antwort ist denkbar einfach und ernüchternd: gar nicht. Auf jeden Fall nicht beim ersten Lido Sounds in Linz. Denn es dauert nicht lange, bis ich die Bekanntschaft mit neuen, mir bis dato fremden Menschen mache. In der Post Corona geprägten und besonders für Kunst und Kultur gebeutelten Zeit, ist es schön und seltsam zugleich mit so vielen Menschen ein Bad in der Menge zu genießen und sich fallen zu lassen. „I’ve always relied on the kindness of strangers” sagt Tennessee Williams Heroine Blanche duBois am Ende von “ A Streetcar Named Desire“. Recht hat sie. Auch wenn ich nicht die histrionische Persönlichkeit einer Blanche besitze, sollte ich am Ende des ersten Festivaltages feststellen, wir wahr dieser Satz ist. Doch von Anfang an. Als ich die Nibelungenstraße auf dem Weg von Passau nach Linz fahre, ergießen sich die Sonnenstrahlen über Seen und Berge in einer Symbiose aus göttlicher Schönheit und zärtlicher Poesie . Hier hat der liebe Gott es ganz besonders gut gemeint und einen wunderschönen Pinselstrich ausgeführt. Ich fahre an Spaziergängern und Radfahrern vorbei. Kilometer für Kilometer genieße ich die formidable Aussicht auf dem Weg nach Linz. Nachdem ich mein Presseticket akkreditiert habe, geht es zur obligatorischen Sicherheitskontrolle die keine ist. Nach einer nicht enden wollenden Wartezeit von locker einer Stunde, bei dem gerade die letzten Klänge des Opener Danger Dan verstummen, bin ich endlich an der Reihe. Mein Schwager hat mir seine Bauchtasche ausgeliehen, die schon Festival erprobt ist und mit einer faltbaren, praktikablen 1.5 l Flasche ausgestattet ist. Das ist die maximale Größe, die auf das Festivalgelände darf. Selbstredend habe ich mich im Vorfeld informiert, was man mitnehmen darf und was lieber zu Hause bleiben sollte. Da ich ohnehin nicht vor hatte einen Fön, diverse Klappmesser oder einen Campingstuhl mitzunehmen fühle ich mich gut gewappnet für den Tag. Kaugummis, Ausweis, Kreditkarte für den Notfall, etwas Bargeld, Taschentücher, Deostick und Powerbank sind meine Begleiter. Das dies allerdings gar nicht kontrolliert wird und ich schon nach einer Millisekunde und halbherzigen Abtasten weitergeschickt werde, spiele ich in Gedanken durch ob nicht doch ein Campingstuhl in die Tasche gepasst hätte.
Endlich auf dem Festivalgelände angekommen gehe ich zum Auffüllen meiner faltbaren Flasche zum versprochenen gratis Aqua für alle. Ich bin zuerst nicht sonderlich überrascht über die lange Schlange, ist es doch warm und jeder will sein mitgebrachtes Accessoire füllen, damit auch niemand dehydriert. Als ich an der Reihe bin, sehe ich den tatsächlichen Grund für die vielen Menschen: es gibt nur einen Wasserhahn! Chapeau, wer sich sowas für ein Festival ausdenkt. Kein Wunder, dass hier so viele Festival Besucher Zeit verbringen bis sie endlich an der Reihe sind. Anschließend schaue und höre ich mir die Österreichische Band My Ugly Clementine an. Mit ihrem Statement für Empowerment und gegen Homophobie setzen sie ein größeres Zeichen als mit ihrer Musik. Vielleicht liegt es daran, dass ich noch nicht richtig angekommen bin, empfinde den Auftritt aber eher als anstrengenden Soundcheck. Dann fällt der Bass aus und die Band bittet um Verständnis und fordert die Partizipion des Publikums. Ich nehme einen großen Schluck aus meiner Flasche und checke den Timetable. Dann eine Unwetterwarnung. Der Regen lässt nicht lange auf sich warten und ergießt sich kübelweise auf das Gelände am Donauufer. Nach diesem Intermezzo drängt sich endlich wieder die Sonne hervor und ich folge den Wegweisern Front of Stage. Wenn ich schon alleine bei diesem Festival bin, kann ich ruhig auch gut sehen denke ich und wenn ich etwas habe dann ist es massig Zeit. Für Florence and the Machine möchte ich gerne so nahe wie möglich an der Bühne sein. Anna Calvi ist eine Sängerin aus London und der nächste Act auf der Center Stage. Etwas wortkarg und routiniert spult sie ihr Programm ab begrüßt weder das Publikum noch lerne ich etwas über den Hintergrund ihrer Musik. So erschließt sich für mich kein Zugang zu ihrem Sound und das Tor bleibt für mich verschlossen. Aber wenigstens habe ich super sehen können.
Im Anschluss heißt es Mission Himmelblau denn der Umbau für die deutsche Band Giant Rooks steht an. Lautsprecher, Piano und sämtliche Bühnenaccessoires sind in die Farbe himmelblau getaucht und mit diesem ganz besonderen Anstrich versehen. Immer wieder faszinierend wie unglaublich schnell und effizient Stagehands und Techniker:innen arbeiten. Das eine Set ist kaum zu Ende, da wird auch schon das nächste, weniger durch Zauberhand und mehr durch harte Arbeit, aufgebaut und platziert. Und dann geht’s richtig los, denn die Gruppe rund um Frontmann Fred Rabe strahlen nicht nur eine herzliche Sympathie aus, sondern überzeugen mit starken Songs und einer ebenso starken Bühnenshow. Die Jungs geben schweißgebadet einfach alles und genießen sichtlich die Stimmung die ihnen vom Festivalpublikum entgegenbrandet. „Bedroom Exile“, „Morning Blue“ oder „Tom’s Diner“ wissen hier zu begeistern und lassen Arme rhythmisch im Takt hin und her bewegen wie Kornblumen im Wind. Bevor dann die britische Alternative-Folk-Band Alt-J betritt, tippt mich von hinten vorsichtig eine Festivalbesucherin auf die Schulter: „Entschuldige bitte, aber du bist so groß und ich kann nicht soviel sehen. Könnten wir vielleicht Plätze tauschen? Die Band bedeutet mir so viel.“ Ich sage ihr nicht, dass ich bislang noch nie etwas von der Band gehört habe und keinen richtigen Plan hatte, was mich genau erwartet und so stimme ich zu. Wie könnte ich aber auch eine so charmante Bitte abschlagen. Und wir kommen ins Gespräch. Erstaunlich und schön zugleich wie wichtig eine Band, Künstler:in für eine bestimmte Person sein kann. Wie viele Emotionen, Hörerlebnisse und persönliche Erinnerungen in Musik stecken können, während man selbst bislang keinen Zugang zu dieser Musik hatte. Und wie sich das alles mit einem Wimpernschlag ändern kann. Als dann kurzerhand und urplötzlich ein erneuter heftiger Schauer einbricht und wir den Front of Stage Bereich räumen müssen, finde ich mich unter dem großen Regencape meiner neuen Freundin und ihres Verlobten wieder. Es ist wie eine Mischung aus Klassenfahrt und Abenteuerurlaub. So war der Tag nicht geplant, aber mir gefällt die Nähe zu meinen neuen Bekannten und der Austausch aus sozialen und kulturellen Komponenten.

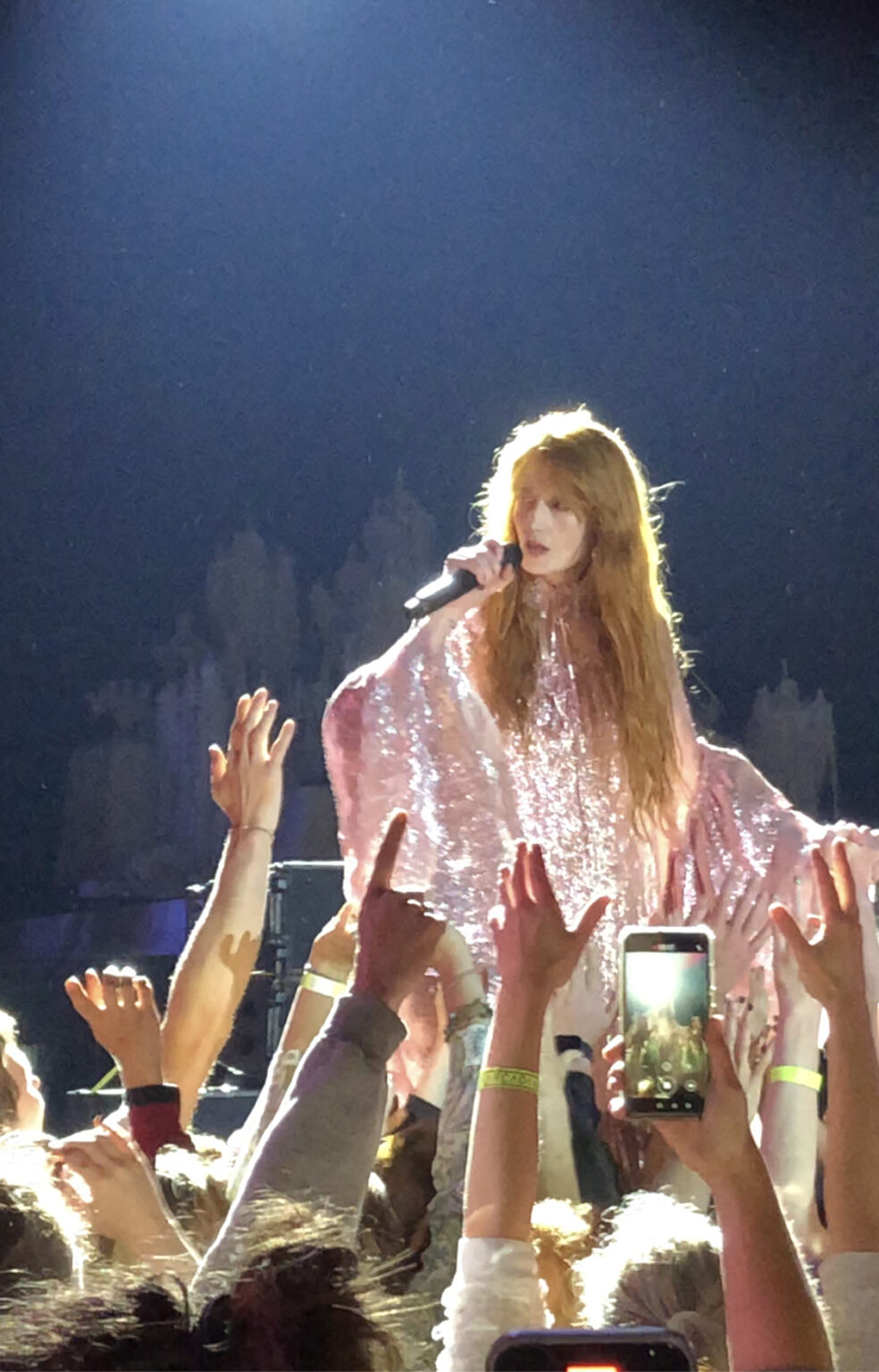


Fotos Marcel Konrath
Dann endlich sind wir alle startklar für Florence and the Machine. Ich treffe kurz vorher, nach dem das Wetter endlich wieder auf Regen verzichtet, eine Konzertfreundin aus Berlin, mit der ich vor Jahren ein Florence Konzert in Berlin sah und die mich in der Menge entdeckt. „Wie schön dich zu sehen“ strahlt sie mich an. Eine Begeisterung, die ich uneingeschränkt zurückgeben kann. Wie schön wenn Musik Menschen zusammenbringt: Sei es für einen Abend oder für die Ewigkeit. Florence Welch ist dann auch die Sahnehaube auf der Festivaltorte. Denn wer schon einmal ein Konzert von Florence and the Machine gesehen hat, weiß dass es weniger Konzert, sondern mehr wie eine Messe, eine beinahe religiöse Erfahrung ist. Und so überzeugen die Songs „Ship To Wreck“, „King“, „Big God“ (bei dem Welch ein Bad in der Menge nimmt) und „Shake It Out“ mit der makellosen und hymnischen Stimme von Florence Welch und gehen unter die Haut. Was für eine allumfassend schöne, sinnliche Erfahrung und eine intensive Stimmung beim Lido. So endet das Festival für mich mit ganz viel potiven Eindrücken durch nette Menschen, die meinen Tag so ungemein versüßt haben. Ich war nicht allein, sondern ein kleiner Teil eines großen Ganzen beim ersten Lido Festival im schönen Linz.
Review: TOOTSIE (Staatstheater am Gärtnerplatz, München)
von Marcel Konrath
rezensierte Vorstellung: 27.05.2023
„Ein neues Musical zur Uraufführung zu bringen, ist wie Kinder bekommen: nicht jeder sollte eins haben“ sagt Bettina Mönch in der Rolle der Julie im Musical „Tootsie“. Wenn das stimmt, dann sind die Eltern im vorliegenden Fallbeispiel äußerst zufriedene, denn dieses Kind erfreut sich bester Gesundheit und Agilität. „Tootsie“ kann als Musical in der europäischen Uraufführung am Theater am Gärtnerplatz überzeugen. Die Geschichte von Michael Dorsey, der als Schauspieler keine Anstellung findet und kurzerhand in Frauenkleider schlüpft, um als Dorothy Michaels Karriere zu machen, wurde von Sidney Pollack 1982 erfolgreich mit Dustin Hoffman und Jessica Lange verfilmt. Hoffman wurde für einen Oscar nominiert und Lange bekam ihren erster Oscar als beste Nebendarstellerin. Gut 45 Jahre später gelang am Broadway der Musicaladaption ein Achtungserfolg, die Auszeichnung mit 2 Tony Awards und eine Show, die seitdem erfolgreich durch die Staaten tourt. Einiges grundliegendes hat sich seit den 80ern (zum Glück) geändert und so entstand ein neues Buch von Robert Horn und damit eine zeitgemäße, genderfluid Adaption des Stoffes. Auch wenn „Tootsie“ als Film nichts von seinem Charme eingebüßt hat und Dustin Hoffman ein sehr Sensibles, fernab von Hollywood Klischees geprägtes, sehr differenziertes Portrait liefert, ist der Film doch etwas in die Jahre gekommen und teilweise nicht gut gealtert.


Dass in der Inszenierung von Regie- und Musical Veteran Gil Mehmert, alles frisch, mitunter aber auch eine gewisse Antiquiertheit spürbar ist, macht vielleicht auch den Reiz der Produktion aus. Es gibt sehr viel zu lachen und viele schöne Ideen, die Mehmert phantasievoll umsetzt und geschickt einflechtet. Ein Highlight ist dabei eine entworfene Utopie in der Dorothy der Star gleich mehrerer weiblicher Musicalrollen in diversen Produktionen ist. Es ist also ein äußerst stimmiges Gesamtpaket was das Theater am Gärtnerplatz auf die Bretter schickt. Die einzige Frage die sich mir stellt, ist tatsächlich nur, ob das Stück als Schauspiel nicht noch besser funktioniert hätte? Die Songs sind alle ok bis gut, aber eine richtig zündende musikalische Nummer gibt es nicht und ein Ohrwurm, mit dem man das Theater verlässt bleibt leider aus. Es gibt die obligatorischen Betroffenheit- und Erkenntnissongs, gepaart mit repetitiven Ensembletracks und Pattern-Nummern, doch nichts davon bleibt dauerhaft und klingt zu austauschbar. Auf meine persönliche Musical Spotify Liste, würde ich keine der Songs hinzufügen. Komponist David Yazebeck bedient sich hier stellenweise etwas bei seinem Musical „Dirty Rotten Scoundrels“, doch da gab es mehr Nummern die nachhaltig überzeugen konnten. Bezeichnenderweise gewann „Tootsie“ zwar einen Tony Award für das beste Buch, ging aber im Musikapartment komplett leer aus. Eine in vielerlei Hinsicht nachvollziehbare Entscheidung. Tatsächlich hatte ich sogar eher die Songs „Tootsie“ und „It Might BeYou“ von Stephen Bishop aus dem Film im Kopf. Dass das Musical dennoch so hervorragend funktioniert, ist vor allem der grandiosen Besetzung und dem guten Buch zu verdanken.
Allen voran Armin Kahl als Michael / Dorothy der so gut wie durchgängig auf der Bühne ist und rasant überzeugend in den Geschlechterrollen wechselt. Das beherrscht Kahl auf großartige Weise mit viel Charme, Fleiß und Esprit. Als Ekel Regisseur mit Wedelesken Locken brilliert Alexander Franzen, während Julia Sturzlbaum als Sandy zum heimlichen Publikumsliebling avanciert. Gunnar Frietsch gibt herrlich nonchalant und deftig den Mitbewohner Jeff, während Dagmar Hellberg als kodderschnauzige Produzentin Rita alle Register zieht. Bettina Mönch ist als Julie wieder einmal sehr wandlungsfähig, charmant und berührend in ihrer Interpretation. Dabei gibt sie auch stimmgewaltig Einblicke in das Seelenleben einer Schauspielerin und welchen Kampf Frauen im Showbusiness immer noch dem Patriarchat ausgesetzt sind. Im Film wird Dorothy in einer Telenovlea als neue Hauptrolle besetzt, in der Bühnenadaption spielt sie die Amme in einer Fortsetzung von „Romeo und Julia“. Was im Film so hervorragend funktioniert und von Dustin Hoffman so exzellent gespielt wird, überträgt sich auf die Bühne zwar auch noch sehr amüsant, ist aber nicht ganz so zum Schreien witzig und grotesk wie im Film. Der alternde, lüsterne Soap Opera Schauspieler John Van Horn, wurde für die Bühne mit dem (fast) talentfreien Reality Star Max van Horn (stimmgewaltig: Daniel Gutmann) ausgetauscht, was gut funktioniert. So wird Dorothy auch als etwas ältere Schauspielerin von einem jüngeren Kollegen begehrt und verehrt: eine willkommene Loslösung von bestehenden Klischees und Vorurteilen. Die Musicaladaption bietet etwas, was mitunter Mangelware auf deutschen Stadttheaterbühnen ist: eine exzellente Inszenierung und die Möglichkeit für gut zwei Stunden den eigenen Alltag komplett auszublenden. So kann „Tootsie“ mit marginalen Abstrichen überzeugen und ist ein Musical mit viel Witz, einem großen Herzen und guter Laune Garantie. „Go Tootsie. Go!“

Fotos Jean-Marc Turmes
Review: Hans Klok - Live from Las Vegas
von Marcel Konrath
rezensiert am 15.05.2023
Ein bisschen neidisch bin ich schon auf diese große Ultra High Definition Leinwand, die Hans Klok als stimmungsvollen, plastischen Hintergrund nutzt. In die verschiedensten Welten kann er so problemlos ein- und abtauchen. Die Animationen sind von bemerkenswerter Qualität und hochauflösender als die Realität selbst. Das würde sicher auch toll bei mir daheim aussehen, verwerfe diesen absurden Gedanken aber direkt wieder, denn dazu fehlen eindeutig Platz und monetäre Möglichkeiten. Klok ist bekannt als „der schnellste Magier der Welt“. Das dieses Adjektiv nicht ohne Grund kompatibel ist, beweist Klok mit einem Gastspiel in der Donau Arena Regensburg. Ob es nun den letzten Auswüchsen der Corona Pandemie geschuldet ist, oder ob der sicher für viele Besucher eher suboptimale Montag als Spieltermin für eine erschreckend leere Halle sorgen, ist sicher Auslegungssache. Fakt ist, dass es etwas dauert bis das Publikum in Stimmung kommt, um mit dem Magier warm zu werden. „Ich spreche wie Rudi Carrell und sehe aus wie Linda deMol“ kokettiert Klok mit seinem sympathischen, niederländischen Dialekt. Der Mann hat auf jeden Fall Humor! Humorvoll geht es auch durch den mit einer Nettospielzeit von knapp 90 Minuten, recht knapp bemessenen Abend. Hans Klok liefert ab, was man von ihm erwartet. Echte Überraschungen und verblüffende „Wie-hat-er-das-nur-gemacht?“ Tricks fallen aus. Unter der laut dröhnenden Filmmusik der „Avengers“ lässt er Assistentinnen verschwinden und wiederauftauchen, holt zwei Herren aus dem Publikum auf die Bühne, beschwört den Mythos des berühmten Harry Houdini und lässt eine Glühbirne schweben. Das ist alles zwar nicht atemlos spektakulär, eher etwas konventionelle Massenware, aber dennoch sehr unterhaltsam. Dazwischen gibt er auch immer mal wieder autobiographisches preis.
Alles fing an mit einem Zauberkasten, den er von seinem Großvater geschenkt bekam. Sein Opa sei zwar nicht der beste aller Zauberer gewesen, habe aber immer selber viel Spaß dabei gehabt erzählt Klok. Mit seinen Eltern besuchte er einen Zirkus in Amsterdam, bei dem auch einige Zaubertricks zum Besten geboten wurden. Seitdem war der kleine Hans von der Magie wie verzaubert und begeistert seitdem mit Bühnenauftritten auf der gesamten Welt. Von Las Vegas als Spielort bis Pamela Anderson als Assistentin. Dieser Mann weiß, wie eine gute Show funktioniert. Routiniert entführt Klok sein Publikum in die Welt der Magie. Dabei dürfen natürlich auch sämtliche theatralischen Showeffekte und Gesten nicht fehlen. Da fehlt nur noch die Windmaschine.
Zum Abschluss gibt es einen herzlichen Gruß an seine verstorbenen Freunde und Mentoren Siegfried und Roy. Der Applaus fällt zum Finale mitunter etwas knapp, aber nicht minder herzlich für den schnellsten Magier der Welt aus.

Review: ROCK OF AGES (Tour)

von Marcel Konrath
rezensiert am 03.05.2023
“We’re not gonna take it / No, we ain’t gonna take it / We’re not gonna take it anymore / We’ve got the right to choose, and / There ain’t no way we’ll lose it / This is our life, this is our song / We’ll fight the powers that be, just / Don’t pick on our destiny, cause / You don’t know us, you don’t belong.”
Dieser Song könnte exemplarisch für den übersättigten Markt und übermäßigen Konsum der Compilation Musicals stehen. Hinter diesem Begriff verbergen sich Musicals, die aus einer Zusammenstellung oder einer Auswahl verschiedener Songs bestehen, basierend meistens aus bereits vorhandenen Musikstücken bekannter Künstler*innen oder Bands. Von richtig gut („And Juliet“), über mäßig („Mamma Mia“) bis katastrophal („Bat auf Of Hell“) reicht hier die Palette. Mit „Rock Of Ages“ kommt nun eins dieser Compilation Musicals auf Tour nach Deutschland, welches den Fokus auf die Musik der 80er und den Classic Rock legt. Dass die Musik zeitlos ist und nach wie vor Spaß macht steht für jeden außer Frage, und auch wenn die Songs überzeugen, so kann es dieses Musical bedauerlicherweise nicht. Allein dieses Wrack als Musical zu bezeichnen entbehrt jeder Logik und kommt einer Blasphemie gleich.
Mit der wohl belanglostesten Story, den unwitzigsten Dialogen und schlechtesten Klischees schafft „Rock Of Ages“ es mühelos den Inhalt einer Telenovela oder der Gebrauchsanweisung gegen Vomitus zu unterbieten. Die Dialoge sind uninspirierte, unterirdisch schlechte Versuche den Hauch einer Handlung rund um die Songs der 80er zu stricken. Das was als Hommage gedacht ist gerät zu einer frivolen Demütigung. Die „Geschichte“ von „Rock of Ages“ spielt in Los Angeles und dreht sich um das Schicksal des Rock’n’Roll Clubs „The Bourbon Room“. Dort treffen verschiedene Charaktere aufeinander, darunter der aufstrebende Rockstar Drew und die angehende Schauspielerin Sherrie. Die beiden verlieben sich ineinander und versuchen, ihre Träume in der Musikindustrie zu verwirklichen. So weit so uninteressant. Die Autoren probieren aus diesem dürftigen Konstrukt eine, ihrer Meinung nach, Parodie des Sujet Musicals zu basteln. Eine Parodie lässt sich allerdings für mich nicht erkennen, es ist eher ein Faustschlag ins Gesicht und eine Beleidigung für jeden der Musicals liebt oder auch nur ansatzweise mag.
Die „Gags“ bedienen sich sämtlicher Klischees, machen sich lustig über Homosexualität, sind rassistisch und chauvinistisch. Deswegen klage ich getreu dem Song von Twisted Sister an und rufe frei heraus: „We’re not gonna take it anymore!” Schluss damit aus jedem Auffahrunfall ein Musical zu zimmern. Liebe Autor*innen, wenn ihr nichts zu erzählen habt dann lasst es doch bitte direkt bleiben und verschwendet nicht die kostbare Zeit, das Geld und die Geduld eures Publikums. Denn schon Teschow wusste: „An der miserablen Qualität unserer Theater ist nicht das Publikum schuld.“ Jedoch wer diese Gags lustig findet, lacht wahrscheinlich auch über Verstopfungen und hält „Richterin Barbara Salesch“ für intellektuelle Fernsehkunst. Ich habe schon Besuche beim Zahnarzt erlebt die lustiger waren und würde mich freiwillig einer Wurzelbehandlung unterziehen als mir „Rock Of Ages“ noch einmal anschauen zu müssen. Nicht dass wir uns falsch verstehen. Ich finde es auch toll mich auf leicht bekömmliche Unterhaltung einzulassen und abzuschalten, ich möchte als Zuschauer allerdings nicht an der Nase herumgeführt werden. Von den Darstellern ist einzig die großartige Amanda Whitford zu nennen, die stimmlich so richtig rocken und punkten kann und die der einzige Lichtblick dieser traurigen Produktion bleibt. Kevin Thiel spielt als Lonny so sehr auf Witz, dass es schon fast körperliche Schmerzen auslöst. Wenn er unumwunden zugibt diese Show sei keine „Andrew Lloyd Sondheim Show“ ist das ein kläglicher Versuch einen Hauch von Ironie in dieses Opus des Grauens zu hauchen. Und irgendwo auf einer Wolke sitzt Sondheim und vergießt bittere Tränen für diesen Affront. Die fünfköpfige Live Band versucht ihr Bestes aus den Songs das maximale heraus zu kitzeln, ist aber leider aufgrund des dürftigen Sounddesigns häufig übersteuert und übertönt die Darsteller weitestgehend.


Rock-Hymnen der 80er, wie „Here I Go Again“ von Whitesnake, „The Final Countdown“ von Europe, „Can’t Fight This Feeling“ von Reo Speedwagon, „I Want To Know What Love Is“ von Foreigner sind einige der Songs die Nostalgie heraufbeschwören sollen, es aber nicht so richtig transportieren können. Richtig gut klingt das tatsächlich dann, wenn das gesamte Ensemble gemeinsam singt. Einige der Songs wie z.B. „We Built This City“ werden allerdings nur als Rezitative verwendet und erklingen leider nicht in voller Länge. Dies ist insofern enttäuschend, dass selbst die Songs so verstümmelt werden um sie der nicht vorhandenen Handlung zum Fraß vorzuwerfen. Felix Freund als Drew schreit sich unangenehm durch die Show, während Julia Tschler als Sherrie mit einigen Tönen meilenweit daneben liegt. Die Sparte Schauspiel scheint bei der lieblosen Inszenierung von Alex Balga und Natalie Holtom, überhaupt keine Rolle zu spielen und ist damit non-existent und ausgeklammert. Das was die Akteure bieten kommt über das Niveau „Amateurtheatergruppe“ nie hinaus. Die Bühne ist statisch und verändert sich im Laufe des Abends nur marginal. Dies ist allerdings auch von keiner großer Bedeutung, da „Rock Of Ages“ auch mit einem aufwändigeren Bühnenbild nicht an Tiefe und Substanz gewönnen hätte. Wer hier seine Erfüllung findet, dem sei es gegönnt und ist mit diesem Autocrash einer Show bestens bedient. Für alle anderen die meinen „We’re not gonna take it anymore“ sei hier eine 80er Jahre Party oder ein Konzert Tribute ans Herz gelegt. „Oh, you’re so condescending / Your call is never ending / We don’t want nothin‘, not a thing from you / Your life is trite and jaded / Boring and confiscated /If that’s your best, your best won’t do.”
Review: Anna Depenbusch (KUZ, Fulda)

von Marcel Konrath
rezensiert am 30.04.2023
Es war einmal eine Liedermacherin aus Hamburg, die ihren Sommer aus Papier aus buntem Glanzpapier kreierte, die mysteriöse Madame Clicquot, die im Morgengrauen im Casino alles verspielt beschwor und die pointiert von ihrem Bekanntenkreis mit „Tim liebt Tina“ erzählte. Dabei wurde sie von ihrer fulminanten, multitalentierten Band begleitet und saß selber am Piano und erzählte: von Matrosen, Reisen, angeflogenen Ideen, Astronauten, eigenen Ängsten und Sehnsüchten und dem Leben. Es ist die fabelhafte Welt der Anna Depenbusch. Schaut und hört man sich die fantasievollen, lyrischen Exponate von Frau Depenbusch an fühlt man sich beseelt. Ihre Lieder sind wie eine wohlige Umarmung, ein Gespräch mit einem guten Freund und ein willkommener Eskapismus. Es sind kleine Geschichten, reizende Anekdoten und poetische Kurzfilme die vor den Augen des aufmerksamen Konzertbesuchers entflammen und aufleuchten. „Ich träume virtuos in Slowmotion-Videos / Für meine kleine Freiheit“ singt Depenbusch in ihrem Song „Echtzeit“. Dabei überzeugen nicht nur ihre starken Texte, für die Anna Depenbusch verantwortlich zeichnet, sondern auch die starken, direkt ins Ohr gehenden Melodien.

Sie entwirft Szenarien und Utopien, Zufluchtsorte für Herz und Seele, hinterfragt kritisch, ist mal melancholisch mal entwaffnend romantisch und herrlich albern. Auf Knopfdruck könne sie zwar nicht schreiben, aber auf Knopfdruck Inspiration hereinlassen. Sie nenne das den „kreativen Bereitschaftsdienst“. Deswegen starte sie jeden Tag auch um 09.00 Uhr an ihrem heimischen Klavier. Dort wartet sie auf die Ideen, die zu ihr fliegen und sie zu einer oder gar mehrerer Zeilen inspirieren und die Kreativität anregen und die letztendlich in einem Song münden. „Ich weiß, ich fall‘ so aus der Zeit / Weil ich mit Schreibmaschine schreib‘ / Und weil ich tagträume stundenlang“ genau solche wunderbaren, akrobatisch poetischen Attitüden gelingen Anna Depenbusch auf das vortrefflichste. Dabei lässt sie so tief in ihr Künstlerinnenherz blicken und gibt damit soviel von sich selber preis, dass die Zuschauer sie nur zu gern auf ihrer Reise und ihren Geschichten begleiten. Anna erzählt dabei auch von schweren Zeiten während der Pandemie, der Ungewissheit und der tränenreiche Neustart während des ersten Konzertes nach einer langen, unfreiwilligen Bühnenabstinenz. In „Heimat“, entstanden während ihrer dreimonatigen Reise nach Island, greift sie die eigene Bedeutung, Wirkung und kritische Selbstreflexion dieses Ortes auf. „Meine Heimat hat Narben / So tief für den Rest / Dieser Zeit / Ich hab sie nie so gesehn / Sie ist wunderschön / Es hat mich immer ins Weite getrieben / Ich bin ihr jedesmal treu geblieben / Weil ich hier her gehör / Ob ich will oder nicht.“
Sie erzählt und philosophiert sympathisch („Kommando Untergang“), ist immer gradlinig authentisch („Glücklich in Berlin“) und dabei zauberhaft fantasievoll in ihren Zeilen („Benjamin“), Immer wieder bezieht Depenbusch das Publikum eloquent mit in ihr Programm ein und singt als Zugabe ihr „Tretboot nach Hawaii“ sogar komplett unplugged und ohne Mikrofon. „Ich bin dein Kapitän / Wenn wir uns’re Runden dreh’n / Bis am Himmel tausend Sterne steh’n / Denn genau dann halt ich das Boot an / Weil uns hier niemand mehr sehen kann / Und ich frag dich leise / Ob du noch mitwillst auf eine kleine Reise?“ Auf diese charmante Frage kann die Antwort nur uneingeschränkt „Ja!“ lauten. Sie ist fabelhaft, diese eigenwillige, bunte, schwarz-weiße und vielschichtige Welt der Anna Depenbusch.
Alle Infos zu Anna Depenbusch und ihren Alben hier: Anna Depenbusch | Liedermacherin

Review: SCHOLL - DIE KNOSPE DER WEISSEN ROSE
(Stadttheater Fürth)

rezensierte Vorstellung: 20.04.2023
von Marcel Konrath
Die Geschichte rund um die Geschwister Sophie und Hans Scholl ist eine tragische und wurde bereits in Opern, Theaterstücken und Filmen erfolgreich adaptiert. „Die weiße Rose“ war die Widerstandsgruppe in der die Geschwister mit anderen jungen Student*innen aktiv waren und die sich gegen die nationalsozialistische Regierung und ihre Ideologie des Rassismus und Antisemitismus wandten. Sophie und Hans Scholl spielten eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Flugblättern und anderen Materialien, die den Nationalsozialismus und den Krieg kritisierten. Sie wurden im Februar 1943 von der Gestapo verhaftet, nachdem sie Flugblätter an der Universität von München verteilt hatten. Sophie und Hans wurden zum Tode verurteilt und am 22. Februar 1943 hingerichtet. In dem Musical von Thomas Borchert und Titus Hoffmann wird nun die Geschichte vor dem Zusammenschluss der weißen Rose beleuchtet, der titelgebenden Knospe, dem Ursprung der Bewegung.
Tirol, 1941/42: Die Geschwister Hans, Sophie und Inge Scholl verbringen zusammen mit ihren Freund*innen Traute, Ulla und Freddy den Jahreswechsel in der einsam gelegenen Coburger Hütte in den Tiroler Bergen. Politisch und weltanschaulich sind diese jungen Erwachsenen sehr unterschiedlich – sie eint aber ein breites literarisches Interesse und das Bedürfnis nach einer Auszeit von Reichsarbeitsdienst und Fronteinsatz im nationalsozialistischen Kriegsdeutschland. Sie vertreiben sich die Zeit mit Skifahren und lesen gemeinsam (politisch verbotene) Werke der Weltliteratur. Inge hat – wie immer – alles im Griff, Sophie freut sich auf ihr bevorstehendes Studium, und Traute hofft auf eine Wiederbelebung ihrer Sommerromanze mit Hans. Im letzten Moment zu Hause geblieben ist Hans‘ Freund und Vertrauter Shurik. Was Hans nicht daran hindert, in seinen Gedanken und in Erinnerung in ständigem Zwiegespräch mit Shurik zu stehen. Denn die Notwendigkeit politisch und privat zu seinen Überzeugungen zu stehen, beschäftigt Hans sehr. Denn da gibt es eine versteckte Seite seiner Persönlichkeit, die so gar nicht recht zu dem Wehrmachtssoldaten und Frauenschwarm passen will, den die anderen so gut kennen …


Ein sehr sensibles Thema also, dem sich das Kreativ Team in dieser Uraufführung auf behutsame Art und Weise nähert. Die jugendliche Naivität der Freund*innen kollidiert mit dem Hass und der Ignoranz des Nationalsozialismus in der klaustrophobischen Enge der Skihütte, die hier kongenial von Stephan Prattes schwebenden Holzbalken konstruiert wird. Wie ein Damoklesschwert schweben die Holzbalken über den Protagonist*innen und deuten bereits offensiv, teils versteckt ein Hakenkreuz und drohendes Unheil an: die Katastrophe naht. Doch das gut durchdachte Bühnenbild ist Segen und Fluch zugleich, denn durch das immer gleichbleibende Setting wirkt die Handlung oft sehr statisch und steril.
Bewegung gibt es zwar in Form der Choreografie von Andrea Danae Kingston (und im Song „Am Sonntag kommt zum Kaffeeklatsch..“) doch über die gut 2.5 Stunden ändert sich wenig am Bühnenbild. Das Stück wäre in seinem Kammerspiel und Sensibilität in einem intimeren Rahmen sicherlich besser aufgehoben, als auf der großen Bühne des Stadttheaters Fürth. So wird es schier unmöglich eine mentale, affektive Bindung mit den Figuren herzustellen.
Musikalisch gelingt Thomas Borchert in seinem Debüt als Musical Komponist nicht immer der Spagat zwischen Pop, Schlager und Kitsch. Borchert versucht sondheimesk Referenzen an den amerikanischen Komponisten einzustreuen, doch wirken die Melodien austauschbar und generisch. Es gibt wenig Titel die ins Ohr gehen und hängen bleiben. Ausnahme bildet hier „Das Leben ist anderswo“ das von Aufbau und Struktur an „Sincerley, Me“ aus „Dear Evan Hansen“ erinnert und sich mehrere Male innerhalb des Abends wiederholt. Anrührend gelingen die Balladen „Diese Worte bleiben“ und „Schweigen“ jeweils mit den Original Texten von Hans Scholl. Für die restlichen Songs steuert Titus Hoffmann die Texte bei, der auch die Regie übernahm. Das als Hymne gedachte „Widerstand“ ist mitunter unangenehm atonal, während „Gemeinsam“ auch als Schlager durchgehen könnte. „Entartet“ ist ein zwanghafter Versuch auf den Spuren von „Hamilton“ zu wandeln, der aber katastrophal schief geht.
Die Besetzung ist durchweg erstklassig und die Darsteller*innen bilden ein homogenes Ensemble, aus dem vor allen Sandra Leitner (mit einer frappierenden Ähnlichkeit zu ihrem historischen Vorbild) als Sophie Scholl und Judith Caspari als Traute herausstehen. Leitner überzeugt stimmlich beim anspruchsvollen „Gott ist fern“ und ist auch schauspielerisch großartig, während Caspari mit „Der Doppelgänger“ punkten und auftrumpfen kann.
Woran liegt es aber, dass die Show emotional nicht überzeugen kann? Der großartigen Besetzung trifft hier keine Schuld, denn die versuchen aus dem vorhandenen Material das maximale herauszuholen. Alexander Auler ist ein empathischer, stimmlich beeindruckender Hans. Dennis Hupka hat als naiver, aber sympathischer Freddy ein paar Lacher auf seiner Seite und Fin Holzwart liefert mit „Propaganda“ ein starkes Solo zu Beginn des zweiten Aktes, welches marginale Erinnerungen an „Kitsch“ aus „Elisabeth“ wachruft. Wunderbar und eine echte Entdeckung ist Karolin Kohnerts eindringliche Darstellung der Inge. Ulla wird überzeugend von Lina Gerlitz gespielt.


Der Zuschauer wird über weite Strecken mit einer wahren Flut an Informationen, Fakten und historischen Ereignissen überfrachtet und alleine zurückgelassen – hier liegt auch das essentielle Problem. Über weite Strecken kommt man sich als Konsument*in vor wie der Schüler, der im Geschichte Leistungskurs mit erhobenem Zeigefinger gemaßregelt wird. Gleich mehrere Male wird betont, dass die „weiße Rose“ als Überschrift der ersten vier Flugblätter der Aktivist*innen diente und nicht als definitiver Name der Gruppe. Zu häufig bleibt man als Zuschauer*in ahnungslos zurück, wenn zu viel Zeitsprünge, Traumsequenzen und zukünftige Ereignisse eingebaut werden, die die Sicht und das Verständnis erheblich schmälern. Ohne etwas Vorbereitung auf die historischen Ereignisse und Hintergründe wird es schwierig dem Stück zu 100% zu folgen. Zu verworren die Zeitsprünge zu Hans und seinem Freund Shurik. Auch die nur zaghaft angedeutete Homosexualität zwischen den beiden Protagonisten bleibt spannungslos und verwirrend. Hier fehlen die dramaturgische Struktur und etwas Feinschliff was auch dazu beiträgt, dass das Stück eindeutig zu lang und etwas schleppend im Tempo geraten ist. Die letzte Sequenz birgt dann aber genau die richtige Dosis an emotionaler Qualität, die während des gesamten Stückes dieser Uraufführung so schmerzlich fehlte.
So gelingen Regisseur Titus Hoffman einige, durchaus originelle Einfälle, die allerdings das zu skizzenhafte Musical als Gesamtwerk zu ausgegoren erscheinen lassen.
„Scholl- Die Knospe der weißen Rose“ kann mit einem überzeugend aufspielenden Ensemble aufwarten, letztendlich fehlt aber der zündende Funke und die treibende Kraft diese Rose zum Erblühen zu bringen.
Review: ROMEO UND JULIA (Theater des Westens, Berlin)

rezensierte Vorstellung: 04.04.2023
von Marcel Konrath
In seiner langen Geschichte hat das Traditionshaus an der Kantstraße schon einige Musicals, Konzerte, Operetten, Opern und Künstler*innen beherbergt. Das Theater des Westens in Berlin. Maria Callas sang hier unter Herbert von Karajan die „Lucia di Lammermoor“. In den 1980ern war Helmut Baumann Intendant und sorgte u.a. mit „La Cage Aux Folles“ für ausverkaufte Vorstellungen. Dann zogen mit u.a. „Die drei Musketiere“, „Chicago“ und „Tanz der Vampire“ verschiedene Musicalproduktionen in das 1896 eröffnete Theater im Herzen von Charlottenburg. Das Theater des Westens ist ein wichtiger Bestandteil der Berliner Kulturszene und ein Ort, an dem Menschen aus aller Welt zusammenkommen um den einzigartigen Charme des Theaters und der drin gebotenen Spektakel zu erleben. Und dieses Haus wird zurecht geliebt. Die Architektur ist einfach wunderschön und ich komme nicht umher, jedes Mal, wenn ich hier bin den Geist der Theatergeschichte einzuatmen und mich innerlich davor zu verbeugen. Dieses Theater erzeugt so eine bestimmte, wohlige Stimmung und ist ein allumschlungener Kontrast zu steril errichteten Musical Tempeln. Nun hat „Romeo und Julia“ von Peter Plate (ehemals Bandmitglied von Rosenstolz) und Ulf Sommer seine Uraufführung. Die beiden Künstler sind keine Unbekannten für das Haus, feierten sie doch mit dem Musical „Ku’damm 56“ einen großen Einstandserfolg.



Sich dem Thema Romeo und Julia zu nähern, birgt eine gewisse Gefahr. In der Popkultur hat das Stück einen festen Platz und diente in unzähligen Adaptionen für Film, Fernsehen, Bühne, Musik und anderen Kunstformen immer wieder als Materie. Die Geschichte des Liebespaares Romeo und Julia, deren Familien verfeindet sind und die tragisch endet, ist so alt wie die Zeit selbst. Und gerade deswegen eröffnet sich zwangsläufig der Konflikt und stellt sich die berechtigte Frage: muss dieses Thema wirklich noch einmal neu erzählt werden? Wenn man es so geschickt wie Plate und Sommer angeht dann lautet die Antwort eindeutig: „ja!“. Denn dass, was in der exzellenten Regie von Christoph Drewitz in gut drei Stunden auf die Bühne gezaubert wird, ist innovatives und hervorragend gemachtes Musicaltheater. Als besonderen Clou verwenden die Schöpfer die legendäre deutsche Übersetzung von August Wilhelm Schlegel, bleiben also sehr nahe bei William Shakespeare. Insbesondere der Kontrast der klassisch gesprochenen Dialoge mit den leicht ins Ohr gehenden Pop Songs ist eine sehr reizvolle und spannende Kombination.
Die Songs fügen sich alle mühelos in die bekannte Handlung ein, von denen besonders „Wir sind Verona“, „Es lebe der Tod“ und „Es tut mir leid“ hervorstechen. Ein „wiederhören“ gibt es zusätzlich mit dem Rosenstolz Klassiker „Liebe ist alles“, der sich kommod in die Handlung einfügt und allein schon wegen dem Titel prädestiniert ist den Weg ins Musical zu rechtfertigen. „Halt dich an die Reichen“ erinnert deutlich an die frühen Rosenstolz Songs und geht direkt ins Ohr.
Das durchweg junge, talentierte und frische Ensemble leistet eindrucksvolle Arbeit, auch wenn der Spagat zwischen Schauspiel und Gesang nicht immer konsequent gelingen will. Insbesondere den Dialogen fehlen dann doch die nötige schauspielerische Finesse, Qualität und Kraft und wirken mitunter etwas hölzern und leer. Dem starken Gesamtauftritt den das Musical abliefert, tut dies nur einen sehr dezenten Abstrich. Shakespeares Geschichte erwacht zu neuem Leben und erstrahlt in frischem Glanz für eine neue Musical Generation. Dabei webt Drewitz in seiner Regie clevere Reminiszenzen an „Hamilton“, „Spring Awakening“ und „Elisabeth“ ein. Atemberaubend ist die Choreografie von Jonathan Huor, der die Schönheit, filigrane Raffinesse und Stärke des Tanzes kongenial vereint. Das ist eine Choreografie auf ganz hohem, erstklassigem Niveau.




Yasmina Hempel und Paul Csitkovics verkörpern Romeo und Julia die gesanglich nicht immer vollkommen homogen funktionieren, denen man das Liebespaar aber durchaus glaubhaft abnimmt. Besonders bei den beiden Protagonist*innen wäre eine intensivere Charakterstudie und Auseinandersetzung mit der literarischen Quelle wünschenswert gewesen. Gerade der zweite Akt ist recht dialoglastig und hätte mit mehr schauspielerischer Raffinesse sicher zusätzlich gewonnen. Dass der Todesengel mit Countertenor Joël Zupan besetzt wurde, ist ein großer Coup für das Stück. Er hat nicht nur sprichwörtlich und sinnbildlich die Zügel in der Hand um die Protagonisten wie Marionetten zu steuern und zu führen, er ist auch stimmlich eine ungewöhnliche Bereicherung für das Stück. Nico Went gelingt mit seiner Darstellung des in Romeo verliebten Mercutio, eine sensible Charakterzeichnung und singt mit „Kopf sei still“ eine starke, kraftvolle Hymne. Großartig ist Philipp Nowicki als Pater Lorenzo, der sowohl schauspielerisch, wie gesanglich ganzheitlich überzeugen und punkten kann. Besonders der Opener „Kein Wort tut so weh wie vorbei“ und die Nummer „Mutter Natur“ beeindrucken auf ganzer Linie. Linda Rietdorff ist als Lady Capulet herrlich überdreht und gnadenlos egoistisch und oberflächlich. Im Duett mit Julias Amme ist dies besonders schmerzlich erkennbar. Während die Amme ihr „Lämmchen“ behütet und beschützen will, fordert die eigene Mutter ihre Tochter Julia auf „Halt dich an die Reichen“. Steffi Irmen vollbringt mit ihrer Amme eine tour-de-force Performance und wird zum Publikumsliebling mit ihrer Nummer „Will nicht mehr jung sein“, die als leise Ballade beginnt und in einen 70er Jahre Schlager Stakkato Rhythmus mündet. Großartigen und starken Support gibt es von Samuel Franco als Tybald und Edwin Parzefall als Benvolio. Die erbitterten Kämpfe der verfeindeten Rivalen werden hier durch die starke Choreo sehr eindringlich und imposant herausgearbeitet. Das Ensemble singt und bewegt sich vorzüglich in Jonathan Huors wunderschöner Choreografie. Das Bühnenbild ist einfach, aber extrem effektiv gehalten. Auch der klassische Balkon, an dem sich die Liebenden treffen und an dem Romeo emporklimmt, ist vorhanden. Dazu ergänzt das stimmige und geschmackvolle Lichtdesign von Tim Deiling einen weiteren exquisiten Faktor der zum Gesamtkunstwerk „Romeo und Julia“ beiträgt. Besonders emotional ist als Epilog „Der Krieg ist aus“ gelungen, der mit einem besonderen Effekt zum finale ultimo aufwartet. Das mag zwar ein wenig manipulativ sein, funktioniert aber de facto und beweist abermals das Regisseur Drewitz hier großartig der Spagat zwischen klassischem Shakespeare der Vergangenheit und einem zeitgemäßen Gewand der Gegenwart gelungen ist. „Romeo und Julia“ bietet alles, was ein gutes Musical ausmacht: Eingängige Melodien, tolle Kostüme, mitreißende Choreografien und ein junges, hoch motiviertes Ensemble machen klar: Dieser Shakespeare ist im Hier und Jetzt angekommen und wird sicher einige Zeit im Theater des Westens bleiben.
Review: Ein Amerikaner in Paris, Tour (Stadttheater Fürth)
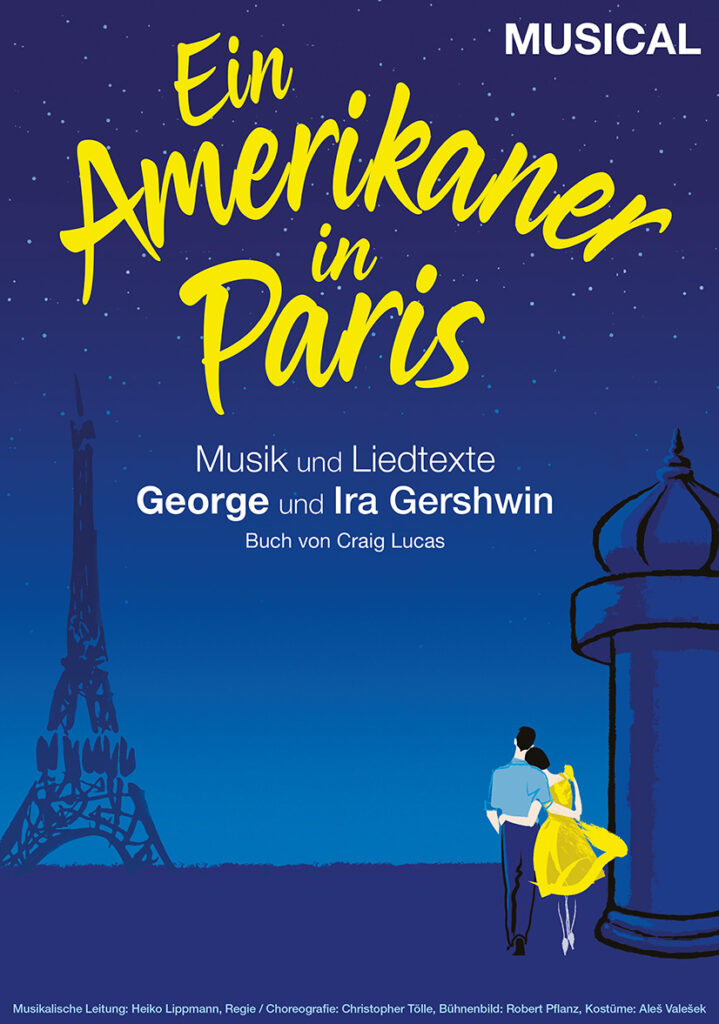
rezensierte Vorstellung: 30.03.2023
von Marcel Konrath
„An was denken Sie, wenn Sie an Paris denken?“ fragt Loïc Damien Schlentz in der Rolle des Adam Hochberg und adressiert dabei direkt das Publikum, noch bevor ein Ton des Krzysztof Klima Festival Orchester, Krakau erklingt. Mit dem Durchbrechen der vierten Wand kommen natürlich die obligatorischen, zu erwartenden Antworten: Eiffelturm und Champs Elysees. Dabei ist Paris soviel mehr als eine Reduzierung auf seine Sehenswürdigkeiten und L’amour. Ich selber habe einige Zeit in der französischen Hauptstadt gelebt und geliebt. Und meine Erinnerungen an die Metropole an der Seine sind durchweg positiv, wenn auch das verklärte, romantisierende Bild der Stadt sich nicht ganz bestätigt je länger man dort wohnt. Allerdings habe ich Paris auch so richtig erst während der Pandemie kennengelernt. Da waren die Möglichkeiten sich in einem größeren Radius zu bewegen extrem marginal und äußerst eingeschränkt.
Aber Paris ist eben auch ein Lebensgefühl: wunderschön, atemberaubend, beklemmend und einschüchternd zugleich. Das Essen ist so großartig wie alle Welt schwärmt, die Sprache melodisch aber voller gemeiner Stolperfallen und wenn die Stadt im Frühling erblüht und erstrahlt ist sie noch wundervoller, attraktiver und einladender denn je. Paris ist Baguette, Confit de canard und Pain au chocolat, Paris ist Marais, Père Lachaise, Parc des Buttes-Chaumont und die Opéra Garnier. Magnolien die sich im Wind bewegen und „wenn Du das Glück hattest […] in Paris zu leben, dann bleibt die Stadt bei Dir, einerlei wohin Du in Deinen Leben noch gehen wirst, denn Paris ist ein Fest fürs Leben.“ wusste schon Ernest Hemingway und ja, er hat vollkommen recht. Ich denke immer gerne an Paris, den Charme und Esprit und die einzigartige Architektur der Stadt zurück. Paris ist eben auch ein Gefühl. Umso enttäuschender ist es, dass bei der Inszenierung von Christopher Tölle sich dieses Gefühl so gar nicht manifestiert.
„Ein Amerikaner in Paris“ spielt im Jahr 1945, wo der angehende amerikanische Maler Jerry dem Charme der Pariserin Lise erliegt. Doch Jerry ist nicht ihr einziger Verehrer. Es gibt da noch den Revuestar Henry Baurel, dem sich Lise verpflichtet fühlt. Für zusätzliche Verwicklungen sorgen Jerrys Freunde, der Komponist Adam Cook, und die ebenso attraktive wie reiche Milo Roberts, eine Amerikanerin mit einem Faible für Künstler. Soweit, so unspektakulär die Handlung wären nicht die wundervollen Melodien von George Gershwin. Die Songs wurden leider ins deutsche übertragen, was der Übersetzung von Kevin Schröder etwas arg schlagerhaftes verleiht. Das Bühnenbild (Robert Pflanz) der Tournee Produktion besteht im wesentlich aus einer Leinwand, auf die Animationen projiziert werden. Dies sind teilweise sehr verpixelt und von unzureichender Qualität. Immer wieder wird der Eiffelturm in allen nur denkbaren Perspektiven gezeigt, von der Ferne, von unten, von der Seite, von oben. Stellenweise erinnern die Projektionen etwas (mit ganz viel Phantasie) an die Poster von Jules Cheret. Es ist aber eine vertane Chance, dass, wenn man schon auf Projektionen zurückgreift, nicht die Möglichkeit nutzt und den Protagonisten selber „sein“ Paris malen lässt. In fast jeder Szene in der er auftaucht, wird erwähnt wie begabt und talentiert Jerry Mulligan als Maler ist. Bis auf eine kurze Skizze sehen wir allerdings als Zuschauer nichts, was sehr bedauerlich ist. Wenn er doch so toll malen kann, warum dies nicht auch zeigen als nur behaupten? Die Idee die Szenen wie eine Art Filmsequenz im Hintergrund zu zeigen, geht nur teilweise auf, weil dies nie zu Ende gedacht wird und die Inszenierung hindurch nicht konsequent verfolgt wird.


Als Jerry ist Andrew Chadwick ein passabler Tänzer und Schauspieler, aber leider mit keiner großen Stimme gesegnet. Sein Zusammenspiel mit Mariana Hidemi als Lise hat keinerlei Chemie und das Liebespaar nehme ich den beiden zu keiner Sekunde ab. Zu haptisch und mechanisch ist ihre Beziehung, zu leidenschaftslos der Tanz. Hidemi ist als Lise überall und nirgendwo. Dafür, dass sie eine der Hauptprotagonistinnen ist, macht sie sich recht rar, was natürlich am Original Buch von Craig Lucas liegt. Loïc Damien Schlentz (Adam Hochberg), Tilmann von Blomberg (Henri Baurel) bleiben stimmlich etwas flach und schauspielerisch sehr ausbaufähig. Lichtpunkt ist Kira Primke als Milo Davenport, die aus ihren wenig substanziellen Szenen das Beste macht. Mit guter Stimme und starker Präsenz gehört sie zu den Highlights des Abends. Es gibt storybedingt sehr viele Szenenwechsel, die vom Ensemble oft tänzerisch charmant gelöst und erledigt werden. In der Choreografie von Christopher Tölle und Nigel Watson haben die Tänzer*innen viel zu tun, denn hier wird, wie schon wie im Original Film, ein großes Hauptaugenmerk auf die Bewegung gelegt. „Ein Amerikaner in Paris“ ist eher als Ballett zu verstehen, mit mehr tänzerischen Etüden als Musical Songs. Auch wenn die bekannten Gershwin Hits „I Got Rhythm“, „The Man I Love“, „’S Wonderful“, „They Can’t Take That Away From Me” mit dabei sind, ist der Tanz hier extrem dominierend. So mag auch das Stück nicht jeden Geschmack treffen und daher auch wenig mit dem Sujet Musical gemein haben. Das französische Flair kann diese Inszenierung leider nicht elaborat transportieren. Ein paar Bistrotische oder Beret reichen da nicht aus. Damit schöpft Regisseur Tölle das volle Potential des Stückes nicht aus und versprüht damit nicht mehr als ein laues Sommerlüftchen. Die französische Kultur und Paris insbesondere sind aber noch so viel mehr. Oder wie die Amerikanerin und Autorin MJ Rose schrieb: „Paris riecht nicht nur süß, sondern melancholisch und neugierig, manchmal traurig, aber immer verführerisch. Sie ist eine Stadt für alle Sinne, für Künstler und Autoren und Musiker und Träumer, für Fantasien, lange Spaziergänge, guten Wein, für Verliebte und Geheimnisse.“
Review: Siegfried & Joy (Kulturzentrum E-Werk Erlangen)

rezensiert am 29.03.2023
von Marcel Konrath
Sie sind das, was man gemeinhin wohl als Internet Sensation bezeichnet. Ihre Shows sind immer und überall ausverkauft und egal wo sie zu sehen sind: sie verbreiten gute Laune und sorgen für strahlende Gesichter: die Magier Siegfried und Joy. Ja genau… Joy – nicht zu verwechseln mit dem ähnlich klingenden Duo, welches jahrelang ihre Magie in Las Vegas versprühten.
Für ihre preisgekrönte Debütshow wurden die Berliner in unzähligen Theatern und auf Festivals gefeiert. „Wer braucht da schon Las Vegas?!“ Also: „Hallo Erlangen“ heißt es an einem Mittwochabend im Kulturzentrum E-Werk. Es ist eine Show, angesiedelt irgendwo zwischen Kindergeburtstag, Fasching und ernstzunehmender Zaubershow. Es ist eine Bestätigung und gleichzeitig eine Widerlegung sämtlicher, gängiger Zauberklischees. Diese Ambivalenz und die herrliche Selbstironie rückt zwei Magier in den Vordergrund die mal albern, mal erstaunlich tiefgründig, aber immer loyal und mit Hingabe ihrer Profession verpflichtet sind. Die große Stärke der zwei liegt in einer guten Dosis Selbstironie, die Zauberei wird aber nie der Lächerlichkeit preisgegeben. Nur gängige Klischees bekannter Illusionisten werden charmant auf die Schippe genommen, denn selbstverständlich haben Siegfried und Joy auch einen Tiger mit dabei – genauer gesagt eine Tigerin namens Pamela.
Wer das ein oder andere Video der beiden kennt weiß, dass jenes fast immer nach demselben Schema abläuft: ein goldener Vorhang wird hochgehalten und einer der beiden „verschwindet“ wie durch Zauberhand, begleitet von „It’s all coming back to me now“ von Celine Dion. Dabei ist häufig deutlich zu sehen, dass.. nunja die Tricks eher mit einem Augenzwinkern zu verstehen sind.
Entsprechend skeptisch war ich auch beim Besuch der Show. Doch ich kann berichten: ja, es wird tatsächlich gezaubert und das Resultat ist äußerst amüsant und kurzweilig. Mit viel Publikumspartition verzaubern Siegfried und Joy das Auditorium und laden immer wieder zum Staunen ein. Hier und da hätte es der einen oder anderen Nummer aber nicht an einem stimmigeren Konzept geschadet. Einige Segmente wirken dann doch zu willkürlich und unausgegoren. Die beiden verstehen es zwar vortrefflich ihr Publikum zu unterhalten, improvisieren und spielen fantastisch mit den Erwartungen des Publikums, doch geht einiges auch im Chaos verloren. Und so weiß man nicht, ob beispielsweise einige Probleme mit der Technik zum Gesamtkonzept des sympathischen Duos gehören oder tatsächlich dem Versagen der Hightech Anlage geschuldet ist.
Einzelne Nummern zu spoilern wäre an dieser Stelle unfair, von daher the hype is real, denn auch das Publikum wird als homogene Masse, Teil einer Illusion, die einen gut gemachten, cleveren Kartentrick beinhaltet. Wer einen entspannten und witzigen Abend zum abschalten sucht und auch gewillt ist über ein oder andere Lückenfüller hinwegzusehen, der ist bei den Jungs genau richtig. Wer allerdings eine durch inszenierte, stringent designte und choreografierte Magic Show erwartet, für den ist Siegfried & Joy nicht ganz das richtige. Wobei etwas Choreografie gibt es tatsächlich, wenn die zwei zu „Magic Moments“ von Perry Como ihre Hüften kreisen lassen. Und ich komme nicht umher zu denken, wieviel sichtbare Freude die beiden dabei haben ihren persönlichen Traum zu leben und wie sehr das gesamte Publikum sich mit ihnen darüber freut. Und alleine dafür muss man Siegfried und Joy lieben.
Review: CABARET (Theater Dortmund)
rezensierte Vorstellung: 24.03.2023
von Marcel Konrath
Es gibt Zeiten, da sitze ich vor einer Rezension und muss in Ermangelung an Quellen erfinderisch werden und tief in die Recherche eintauchen. Dies kann sich auf englischsprachige Texte beziehen, auf eigene Erinnerungen selbst besuchter Vorstellungen oder externe Fach Literatur spezialisieren. Bei einem Musical wie „Cabaret“ ist dies nicht erforderlich. Es gibt soviel Material zum Lesen, anhören und ansehen das einem schwindelig wird. Wo also beginnen? „Let’s start at the very beginning, a very good way to start.“ Ok … das ist nicht aus „Cabaret“, sondern aus „The Sound Of Music“, passt aber in diesem Fall besonders gut.
Meine erste Erfahrung mit „Cabaret“ hatte ich noch vor dem Film mit Liza Minnelli. Denn wie es für einen Theaterliebhaber wie mich vorbestimmt war, fand die erste Berührung und Begegnung mit „Cabaret“ im Theater statt. Michael Wedekind inszenierte das Stück in Aachen mit Ursula Vincent als Sally und Karl Walter Sprungala als Conférencier. Eine Inszenierung die mich in meiner Haltung und Zuneigung zu „Cabaret“ stark geprägt hat und an der sich zwangsläufig jede weitere Produktion messen musste. Auch wenn es schon einige Jahre zurückliegt, sind meine Erinnerungen an diese Produktion immer noch sehr präsent.
Mir und jedem anderen Im Publikum stockte damals der Atem als der Conférencier in der finalen Szene und seiner Reprise von „Willkommen“ mit „Auf Wiedersehen“ und seinem letzten Goodbye in die Gaskammer eines namentlich nicht genannten Konzentrationslager sich für immer verabschiedete. Hier lag nicht nur die große Brisanz, sondern auch die Genialität und Kraft von Wedekinds Inszenierung.
Gerade diese Entscheidung polarisierte, aber genau das muss Theater und auch die Sektion Musical sollte dies nicht ausklammern. Auch wenn Musical manchmal leider immer noch als die leichte Muse belächelt wird.
Doch „Cabaret“ ist so viel mehr als reine Unterhaltung und die großartigen Melodien von John Kander. Es ist nicht nur eine Zeitreise in das Berlin der späten 20er Jahren, sondern eine treffsichere Charakterstudie und zeitgleich eine tiefgründige, zeitgeschichtliche Retrospektive. Vor allem ist „Cabaret“ zutiefst menschlich und emotional vor dem Hintergrund der politischen Instabilität und des sozialen Wandels der Weimarer Republik.


Musical Veteran Gil Mehmert inszeniert „Cabaret“ nun, nach dem Erfolg an der Wiener Volksoper, für die Oper Dortmund. Angesiedelt im Berliner Kit Kat Club folgt das Stück der Beziehung zwischen dem amerikanischen Schriftsteller Cliff Bradshaw (Jörn-Felix Alt) und der britischen Sängerin Sally Bowles (Bettina Mönch). Während die beiden versuchen, ihre Beziehung aufrechtzuerhalten, verschärft sich die politische Situation in Deutschland und die Nationalsozialisten beginnen, ihre Kontrolle zu festigen. Der Club und seine Künstler*innen werden zunehmend bedroht und diskriminiert wie auch der Conférencier des Kit Kat Clubs (Rob Petzer). Er ist eine schillernde Figur, diabolisch, sarkastisch und der Master of Ceremonies. Auch die Pensionswirtin Fräulein Schneider (Angelika MIlster) und ihr Freund und Nachbar Herr Schultz (Tom Zahner) werden zu Opfern ihrer Zeit.
Obwohl „Cabaret“ in der Vergangenheit eher auf kleineren Bühnen Einzug fand und vom Konzept auch ideal in ein kleines Clubtheater passt, inszeniert Gil Mehmert das Musical nun episch für die große Bühne. Hier kann er opulent und dekadent zeigen und alles aufgefahren was eine aufwendige Inszenierung ausmacht. Die Drehbühne wird hier äußerst effektiv zum Einsatz gebracht und bietet einen Blick in den KitKat Club während auf der Rückseite intime Einblicke in die Pension von Fräulein Schneider preisgegeben werden. Heike Meixner hat hier großartiges geleistet mit ihrem Design. Das gigantisch anmutende Klavier, auf dem der Conférencier die Partitur des Lebens spielt, ist dabei effektiv wie genial erdacht. So bietet die Bühne eine überdimensionale Spielwiese für die Protagonisten. Und was für eine!
Jörn-Felix Alt ist ein starker Cliff. Er ist emotional und zart, dann wieder leidenschaftlich und zurücknehmend. Selten habe ich einen so guten Schauspieler wie Sänger in dieser Rolle gesehen. Eine rundherum großartige Leistung. Bettina Mönch stattet ihre Sally mit einer großen Belt Stimme aus und ihre Hit Songs „Cabaret“ und „Maybe This Time“ sitzen und sorgen daher zu Recht für fulminante Beifallsstürme des Publikums. Ihre Sally liebt und lebt bedingungslos, ist manipulativ, verrucht und herzzerreißend. Der Conférencier von Rob Pelzer führt nicht nur zynisch und provokant durch den Inhalt des Stückes, er ist zu dem lakonischen Begleiter, Beobachter und zeitgleich ein Provokateur sexueller und politischer Anspielungen. Zudem setzt Mehmert ihn auch immer wieder in anderen Momenten des Abends ein. So fungiert er mal als Kontrolleur, mal als Taxifahrer. Er ist zudem ein Symbol für den moralischen Verfall der Gesellschaft und auch die zunehmende Gewalt und Radikalität. Pelzer ist facettenreich, herrlich ironisch, singt und spielt grandios und wickelt so das Publikum sofort um den kleinen Finger. „Do you feel good?“ Doch bei der Replik bleibt einem schnell die Antwort im Halse stecken. Pelzer fungiert in seiner Rolle als Beobachter und Kommentator. Gleichzeitig ist er Teil der Geschichte, fungiert als Verbindungselement zwischen den Szenen und zwischen den Welten. Er durchbricht damit die vierte Wand und spricht das Publikum direkt an. Pelzer gibt seiner Figur ein bedrohliches und berechnendes Kalkül, das ihn unnahbar und zeitgleich sehr zugänglich macht. Sein Charakter bleibt distanziert in seinem Kosmos und ist unberechenbar in seiner Dynamik. Eine exzellente Leistung!


Sehr berührend und wunderbar fein inszeniert ist das Kammerspiel von Angelika Milster und Tom Zahner als verliebtes Paar, welches sich leider früher als später der Realität stellen muss. Wie die beiden Schauspieler dies herausarbeiten und so einfühlsam, echt und empathisch darstellen ist ein großer Gewinn für die Produktion und so avancieren die beiden zu den heimlichen Stars des Abends. Milster singt, nicht anders als zu erwarten, hervorragend und Tom Zahner rührt mit seiner nuancierten, intelligenten Darstellung zu Tränen. Überzeugend Samuel Türksoy als schleimiger Ernst Ludwig und wunderbar polternd und berlinernd die Fräulein Kost von Maja Dickmann. In der fulminanten Choreografie von Melissa King tanzen die Kit Kat Boys und Girls („each and everyone a virgin“) virtuos. Die Kostüme von Falk Bauer unterstreichen dazu perfekt die 20er Jahre in Berlin.
Die Songs von Kander und Ebb sind, hier unter dem kraftvollen Dirigat von Damian Omansen, neben den bekannten Hits, kritisch und politisch motiviert. „If You Could See Her With My Eyes“ sticht dabei besonders hervor. Eisige Gänsehaut gibt es zum Finale des ersten Aktes mit “Der morgige Tag ist mein“. Hier wird die Stimmungsmache der Nationalsozialisten besonders schmerzlich deutlich. Mehmert inszeniert dies als einen überdeutlichen, eindringlichen Fingerzeig und Weckruf. Leider ist dieser Teil aktueller denn je.
Als Jens Schmidl „Cabaret“ am Theater Freiburg inszenierte gelang ihm ein ganz spezieller Coup: der Regisseur platzierte vor Beginn jeder Vorstellung Mitglieder des Opernchores im Publikum, die während „Der morgige Tag ist mein“ sukzessive aufstanden und den rechten Arm emporstreckten. Das habe einiges an Überzeugungskraft gekostet, verrät Schmidl in einem Telefonat mit mir. Hatten doch die Sänger*innen Angst vor einer möglichen Attacke der Zuschauer. Ich sah die Produktion während meines Studiums und kann mich noch gut daran erinnern wie schockiert, paralysiert und ungläubig ich aus dem Augenwickel sah, wie mein potentieller „Sitznachbar“ sich erhob. Ja, es war Teil der Inszenierung aber ein Moment, so intensiv und eindringlich, dass ich ihn nie vergessen werde. Schmidl hatte damit den Keim des Bösen freigelegt und eindringlich demonstriert, dass Mitläufer und Anhänger rechtsradikaler Gruppierungen mitten unter uns sind. Niemand kann sicher sein.
Musikalisch hat die Show einiges zu bieten. Neben den bekannten Nummern gehen vor allem „Heirat“, „Don’t Tell Mama“ und „Two Ladies“ ins Ohr. Schön das mit „I Don’t Care Much“, eine Nummer die in der Original Broadway Inszenierung 1966 nicht mit dabei war und 1987 zum ersten Mal eingefügt wurde, mit dabei ist und vom Conférencier gesungen wird.

Mehmert schafft es, das intime Kammerspiel von „Cabaret“ kongenial auf die große Bühne zu transportieren. „Cabaret“ ist eine Parabel aus Versuchung, Verführung, Hedonismus und politischen Aspekten, die uns sehr deutlich zeigt wieviel Aktualität das Musical immer noch hat. Mit einem stark aufspielenden, erstklassigen Ensemble ist diese „Cabaret“ Inszenierung eine für die Ewigkeit, so „come to the cabaret“.
Review: WEST SIDE STORY (Tour)
rezensierte Vorstellung: 21.03.2023,
Capitol Theater Düsseldorf
von Marcel Konrath
Lonny Price hat eine lange Vergangenheit mit dem Werk von Stephen Sondheim. Angefangen hat für ihn alles nicht als Regisseur, sondern als Schauspieler in der Hal Prince Inszenierung von „Merrily We Roll Along“. Das Musical das rückwärts erzählt wird, wurde bei seiner Uraufführung zum desaströsen Flop, entwickelte im Laufe der Jahre aber eine treue Schar an Bewunderern und wird Ende 2023 mit Jonathan Groff, Daniel Radcliffe und Lindsay Mendez an den Broadway, nach einer ausverkauften off-Broadway Reihe transferiert. Die Entstehungsgeschichte von „Merrily“ ist auch Thematik der äußerst interessanten und sehr sehenswerten Dokumentation „Best Worst Thing That Ever Could Have Happened“, doch um diese soll es an dieser Stelle nicht gehen. Vielmehr zeichnet Price nun verantwortlich für ein Musical, das mit Superlativen der internationalen Presse nicht spart, die Times schrieb: „No.1 Greatest musical of all time“ und zu dem Sondheim die Lyrics beisteuerte. Sondheim war damals 25 Jahre jung, als er mit seiner Arbeit begann und noch ganz am Anfang seiner Karriere.

Zusammen mit dem großen Leonard Bernstein zu arbeiten war für ihn Ehre und Herausforderung zugleich. Sondheim arbeitete lieber allein, während Bernstein den gemeinsamen kreativen Prozess von Komponisten und Texter bevorzugte. Also fanden beide einen ungewöhnlichen Kompromiss: sie kommunizierten über das Telefon. So fand eine der wohl bedeutendsten Arbeiten der amerikanischen Musicalgeschichte auf recht unkonventionelle Art statt. Die Symbiose der beiden Jahrhundert Künstler resultierte in einem Musical, das Geschichte schrieb.

Die kürzliche Neuverfilmung durch Oscar Preisträger Steven Spielberg macht deutlich, wieviel Kraft immer noch in der Musik von Bernstein steckt und wie unsterblich diese ist. Umso erstaunlicher ist es, dass in der neuen Inszenierung von Lonny Price die Show merkwürdig kalt und generisch daherkommt. Alles ist zwar makellos getimt, doch die initiale, emotionale Zündung bleibt aus. Woran liegt es also, dass diese „West Side Story“ nur marginal berührt? An dem exzellenten Dirigat von Grant Sturiale liegt es sicher nicht. Mit ganz viel Drive und Gusto führt der Maestro sein Orchester durch die Partitur Bernsteins: Jazz, lateinamerikanische Elemente und auch klassische Oper erfüllen immer noch ihre Bestimmung und zeigen die formvollendete, tiefe Schönheit und satte Qualität der Musik. Songs wie „Something’s Coming“, „Tonight“ und „Somewhere“ haben auch nach über 60 Jahren nichts von ihrer Strahlkraft eingebüßt. Gesungen und gesprochen wird bei der internationalen Tour auf Englisch. Übertitel gibt es zwar keine, dies dürfte aber aufgrund der Bekannt- und Beliebtheit des Stückes wenig problematisch sein. Überhaupt ist eine Aufführung in der Originalsprache in der Oper, bis auf sehr wenige Ausnahmen, Pflicht. Im Musical wird eine Aufführung in der Originalsprache hierzulande allerdings eher selten gezeigt und auf deutsche Übersetzungen zurückgegriffen.
Lose basiert das Musical auf Shakespeares „Romeo & Julia“ und spielt im New York der 1950er Jahre. Im Mittelpunkt der Handlung stehen die zwei rivalisierenden Straßengangs, die „Jets“ (weiße Amerikaner) und die „Sharks“ (Puerto-Ricaner) und natürlich Tony und Maria, die sich unsterblich ineinander verlieben und aus den jeweils revoltierenden Gangs kommen. Und wir alle als Zuschauer wissen: diese Verbindung endet tragisch.
Als Tony ist Jadon Webster rein optisch eine Idealbesetzung für Tony. Auch wenn seine Singstimme im konträren Gegensatz zu seiner Sprechstimme steht, kann er gesanglich überzeugen, schauspielerisch aber wenig punkten. Zu aufgesetzt und wenig elaboriert ist sein Spiel, als dass es wirklich emotional berührt. Bei ihm sieht man auch gut den Knackpunkt der Inszenierung und die fehlende, mangelnde emotionale Bindung zu den Protagonisten. Ja man fühlt förmlich die Regieanweisungen von Lonny Price. „Geh jetzt hier hin – dann dort hin und verweile hier.“ Das mag zwar grundsolide sein und auch für einige Rezipienten ausreichen, mir war das allerdings zu wenig und zu statisch und vor allem fehlt das Feuer und essentielle Hingabe. Eine wirkliche Haltung und tiefe Diskrepanz fühlt man bei Websters Tony bedauerlicherweise nicht. Michel Vasquez als Maria ist da schon etwas positiver hervorzuheben. Ihr Sopran ist anrührend schön anzuhören und ihr Schauspiel etwas akzentuierter als das ihres Bühnenpartners. Allerdings fehlt ihr die jugendliche Unbekümmertheit und eine richtige Chemie mit Webster ist eher abstinent als richtig spürbar. Ein Highlight hingegen, in der ohnehin sehr dankbaren Rolle ist tänzerisch, gesanglich und schauspielerisch Kyra Sorce als Anita. Bei ihr spürt man den Drive, die Passion und Hingabe für ihre Rolle. Ihre Anita ist leidenschaftlich, liebt und hasst bedingungslos. Etwas mehr von diesen Attributen hätte auch der gesamten Produktion gutgetan. Etwas blass und unscheinbar ist Anthony Sanchez als Bernardo und hinterlässt damit keinen bleibenden Eindruck. Taylor Harley als Riff spielt rollendeckend. Bemerkenswert präsent ist Anthony J. Gasbarre,III als Action. Hier hätte ich es spannend gefunden, wie er wohl die Rolle des Tony interpretiert hätte (wäre er besetzt worden). In seinen wenigen Szenen ist Gasbarre ein starker und leidenschaftlicher Action, der auch tänzerisch beeindruckt. Guten Support gibt es von Laura Leo Kelly als Anybodys und Christopher Alvarado als Chino.


Tänzerisch bleiben keine Wünsche offen, orientiert sich die Choreo von Julio Monge doch stark an der legendären Original Choreografie von Jerome Robbins. Das bei einer Tourneeproduktion keine Hydraulik und fahrende Bühnenelemente zum Einsatz kommen liegt auf der Hand, doch die teilweise sehr lauten Bühnenumbauten der einzelnen Elemente und Fassaden von Anna Louizos, katapultierte mich als Zuschauer immer mal wieder aus dem Bühnenzauber zurück in die Realität des Theatersaals und meinen Sitz. Dennoch sind die typischen New Yorker Feuertreppen, die auch maßgeblich im Original Artwork der Produktion zu finden sind, gut umgesetzt und erfüllen funktional ihren Zweck. Auch die Häuser als aufklappbare Puppenhäuser zu nutzen, geht (buchstäblich) auf.
Schön und feinfühlig gelingt Price die Traumsequenz zu „Somewhere“: ein starkes Plädoyer für Liebe und eine deutliche, strikte Ablehnung von Rassismus, Homo- und Transphobie und Hass aller Art.
Unterm Strich bleibt und bestätigt mit der neuen Inszenierung dieser „West Side Story“ die Erinnerung daran, wie großartig das Musical immer noch ist und wie elementar wichtig Toleranz, Akzeptanz und Empathie für jeden von uns sind. Der letzte Funke, in dieser Neu-Inszenierung will dann am Ende aber leider nicht überspringen.
Photo credit: Johan Persson
Review: This Is The Greatest Show (Tour)

rezensierte Vorstellung. 01.03.2023
Deutsches Theater München
von Marcel Konrath
Es ist schon ein ehrgeiziges und kühnes Unterfangen eine Musicalgala „This Is The Greatest Show“ zu nennen. Wenn auch die Anspielung auf den beliebten Film „Greatest Showman“ mit Hugh Jackman offensichtlich ist, denn bereits das Plakat zur Show weist deutlich darauf hin, werden hier die Ansprüche sehr hoch angesetzt. Das Konzept ist ein einfaches und effektives Rezept: man nehme eine tolle, sechsköpfige Band, erstklassige Sänger und Musicalstars, garniere dies mit einer Moderation und einer Retrospektive auf die Welt des Musicals. Und ja, dieses Rezept geht bestens auf denn dass was in dieser Gala präsentiert wird ist ein purer wohlschmeckender Genuss aus einer Michelin Sterneküche. Schon der Opener erzeugt eine wohlige Ganskörpergänsehaut. Denn womit könnte man das Konzert besser beginnen als eben mit „This Is the greatest Show“?
Die creme de la creme der Musicalstars hat sich an diesem Abend eingefunden um das Sujet Musical zu zelebrieren. Und was für eine Feier den Besucher erwartet! Maya Hakvoort begeistert in ihrer Paraderolle der Elisabeth und „Ich gehör nur mir“ ebenso wie mit „Let It Go“ aus „Frozen“ und „Gold von den Sternen“ im Duett mit Michael Schober aus dem Kunze und Levay Werk „Mozart!“ – mit Ausrufezeichen wie Moderator Andreas Bieber bemerkt, der gut gelaunt und eloquent durch den Abend führt. Schön wie Hakvoort immer wieder ihre Songs nicht nur singt, sondern detailliert mit schönen Phrasierungen ausstattet. Eine Sternstunde des Musicals!
Erfrischend ist die Auswahl der einzelnen Musical Songs. Auch wenn sich naturgemäß lieb gewonnene Klassiker mit einschleichen, so begeistern vor allem neue und frische Songs aus „Hamilton“, „KU’DAMM 56“, „The Prom“, „Robin Hood“, „Moulin Rouge“ oder „& Juliet“. Großartig das Duett „Meer sehen“ aus „Knockin‘ On heavens Door“ in der Version von Drew Sarich und Jonas Hein. Die sehr stimmige Auswahl der einzelnen Songs hebt „This Is The Greatest Show“ aus dem generischen Einheitsbrei anderer Best Of Formate sehr deutlich hervor. Gänsehaut bei „Wer kann schon ohne Liebe sein“ aus den „Drei Musketieren“. Wie sich hier die Stimmen von Maya Hakvoort, Michaela Schober und Froukje Zuidema zu einer Symbiose vereinen und auf den songeigenen Klimax zusteuern ist eine einzige, unbändige Ausschüttung an Glückshormonen.
Drew Sarich gelingt das Kunststück in jeder seiner Auftritte jedem Song seinen ganz eigenen Stempel aufzudrücken. Grandios sein „Letzter Tanz“ aus dem Welterfolg „Elisabeth“ (eine Schande, dass ihn bislang niemand in der Rolles des „Tod“ besetzte), überzeugend sein Eintauchen in die Welt von „Hamilton“ („Warte noch“) und stark seine Reunion mit dem „Glöckner von Notre Dame“ nachdem er 1999 in der Welturaufführung die Titelpartie verkörperte. Wieder einmal beweist Sarich sein internationales Star Appeal und seine absolute Perfektion und Hingabe in allem was er macht.
Eine echte Entdeckung ist Michaela Schober, die mit „This Is Me“ einen starken Auftritt abliefert, für den sie verdientermaßen stehende Ovationen erntet. Friedrich Rau kann gleich in mehreren Rollen sein Können unter Beweis stellen. „Robin Hood“, „Joseph“, „& Juliet“ und „Starlight Express“ gehören u.a. zu seinem Repertoire. Jonas Hein punktet mit „Into The Unknown“ aus „Frozen 2“, lädt zum Bummel über den „Ku’damm 56“ ein und begeistert mit „& Juliet“. Etwas blass und hinter den Erwartungen zurück bleibt Jan Ammann, der zwar mit „From Now On aus „Greatest Showman“ mit seinem Bariton solide singt, aber nicht die Qualität und Emotionalität eines Hugh Jackmans erreicht. Außer seiner Paraderolle des von Krolock in einem kurzen Ausschnitt aus „Tanz der Vampire“ und dem mäßigen „Mamma Mia“ Medley hat er auch nicht sonderlich viel zu tun und wenig Möglichkeiten zu glänzen.
Einen großen und wichtigen Teil nehmen die Songs aus „Greatest Showman“ ein und das Publikum liebt und umarmt diese Entscheidung spürbar. Immer wieder kommt es zu stehenden Ovationen. Vor allem die grandiose Verena Mackenberg ist eine Sensation und erzielt mit ihrer eigenen Version von „Never Enough“ eine Flut an Gänsehautmomenten. Eine exzellente, hervorragend gesungene und interpretierte Leistung, für die es vollkommen zurecht stehende Ovationen gibt.
Welch wunderbare Entscheidung auch Songs aus „The Prom“ für die Gala zu inkludieren. Bedauerlicherweise hat es dieses großartige Musical über Toleranz, Offenheit und Liebe bislang noch nicht auf die großen deutschen Bühnen geschafft. Melissa Laurenzia Peters und Froukje Zuidema verzaubern mit „Unruly Heart“ und ja dieser Song trifft direkt ins Herz. Sophie Alter lädt mit „Bad Romance“ stimmstark ins „Moulin Rouge“ ein und Sergey Mishchurenko beweist als Pole Dancer zu „Rewrite The Stars“ aus „The Greatest Showman“ seine perfekte akrobatische Körperbeherrschung. Es ist ein Abend der Superlative, aber es ist ja auch „The Greatest Show“: ein absoluter Volltreffer und eine Verbeugung vor dem Genre Musical. Bravo!
Review: Carmen (Staatsoper Berlin)

Staatsoper Berlin
rezensierte Vorstellung: 22.02.23
von Marcel Konrath
„In dieser Oper opfert der spanische Sergeant Don José seine militärische Karriere und gesicherten Pensionsanspruch für Carmen, eine Dame […] mit zweifelhaftem Ruf und häufigem Partnerwechsel.“ So umreißt Loriot in seinem Kleinen Opernführer die Handlung von Carmen, dem Meisterwerk von Georges Bizet. Das 1875 uraufgeführte Werk ist aus dem Opernrepertoire internationaler Bühnen nicht mehr wegzudenken. Regisseur Martin Kušej entscheidet sich in seiner Inszenierung an der Staatsoper Berlin für eine behutsam modernisierte Version. Heutzutage kaum vorstellbar, aber als Bizet seine Carmen in Paris uraufgeführt wurde, war der Erfolg eher mäßig und rief empörte Reaktionen hervor: die moralisch verkommende Carmen, ein charakterlich schwacher und beeinflussbarer Offizier, die Handlung inmitten einer niederen Schicht – all das kam der Pariser Gesellschaft fast einem Skandal gleich. Künstlerisch wurde das Stück allerdings gelobt, vor allem die Leistung der Sänger. Die Wiener Aufführung in deutscher Sprache 1875 gab den Ausschlag für den Erfolg des Stückes in Europa und der Welt. Von dort aus wurde Bizets Carmen bald zu einer der bekanntesten Opern weltweit. Den gigantischen Erfolg erlebte Bizet selber leider nicht mehr mit und verstarb bereits mit 36 Jahren an einem Herzanfall.
Kušej verzichtet in seiner Regie weitestgehend auf überflüssiges und widmet sich klar strukturiert den essenziellen Charakteren seiner Protagonisten. Die stilisierte, karge Bühne von Jens Kilian trägt maßgeblich dazu bei, dass der Fokus auf dem Ursprünglichen und den agierenden Personen liegt.
Die französische Mezzosopranistin Gaëlle Arquez ist als Carmen eine Idealbesetzung. Sie ist leidenschaftlich und wütend, zerbrechlich und aufbrausend, emanzipiert und teuflisch. Mit ihrer Habanera erntet sie vom Publikum minutenlangen Beifall und überzeugt dabei mit exzellenter Stimme. Ihr zur Seite steht mit Stanislas de Barbeyrac ein starker Don Jose zur Seite, der mit „La fleur que tu m’avais jetée“ eine eindrucksvolle Darbietung der Arie abliefert. Heimlicher Star des Abends ist allerdings Pretty Yende, die ihre Micaela mit vorzüglicher Stimme und einnehmender Bühnenpräsenz ausstattet und nachhaltig begeistert. Serena Sáenz als Mercédès und Maria Hegele als Frasquita ergänzen hervorragend und glänzend singend das Ensemble. Die wie immer fulminant aufspielende Staatskapelle Berlin wird kongenial dirigiert von Bertrand de Billy.
Es ist immer noch beeindruckend wie Bizet die Kultur und die Atmosphäre von Sevilla in seine Musik integriert hat. Dabei war der Komponist nie in Spanien. Seine Inspiration nahm er aus Liedsammlungen und Einzelkompositionen. Einzelne Arien sind Klassiker und auch aus unserer heutigen Kultur nicht mehr wegzudenken. Sobald die ersten Takte der Habanera („L’amour est un oiseau rebelle“) oder das Lied des Torero Escamillo (Lucio Gallo): „Toréador en garde!“ erklingen, stellt sich bei den meisten ein vertrauter Wiedererkennungseffekt ein.
Musikalisch hält die Oper einige Ohrwürmer bereit, zumal das Torero-Lied an vielen Stellen als Erinnerungsmotiv auftaucht. Hervorzuheben ist auch der Chor der Arbeiterinnen im ersten Akt („Dans l’air, nous suivons des yeux la fumée“), der verdeutlicht, warum man sich nicht auf einen Mann einlassen sollte.
Im 4. Akt gibt es eine Arie, in der Carmen und José singen, die aber kein Duett ist: „La fleur que tu m’avais jetée“, in der José die Anfänge der Beziehung revidiert. Vorher singt Carmen ein Tanzlied, bei dem sie ab und an von José unterbrochen wird. Das ‚Duett‘ zeigt sehr gut, auch anhand der Instrumentierung, dass José in einem inneren Konflikt steht, zwischen Pflichtbewusstsein und Leidenschaft für Carmen.
„Carmen“ ist eine Oper, die viele Themen wie Liebe, Eifersucht, Freiheit und Tod anspricht. Sie ist auch ein Spiegelbild der Gesellschaft ihrer Zeit, in der Frauen oft als Objekte der Begierde betrachtet wurden. Carmen ist jedoch keine typische Frau ihrer Zeit, sondern eine unabhängige und selbstbestimmte Frau, die sich ihrer Leidenschaft hingibt und sich nicht den Konventionen der Gesellschaft unterwirft. Durch ihre Handlungen und ihr Verhalten provoziert sie die Männer um sie herum und fordert damit die gesellschaftlichen Normen heraus. Dies hat Kušej in seiner Arbeit sehr gut herausgearbeitet.
Auch nach den Jahren der Premiere übt die Oper mit der unsterblichen Musik von Georges Bizet eine ungemeine Faszination aus, die sowohl musikalisch als auch inhaltlich beeindruckt. Die tragische Geschichte von Leidenschaft, Eifersucht und Freiheit, die auch heute noch relevant ist und das Publikum auf der ganzen Welt fesselt, löst zum Schlussapplaus in der Staatsoper Berlin begeisternde stehende Ovationen aus.
Review: Meine Liebe zu "Sunset Boulevard"
von Marcel Konrath
„You there. Why are you so late?” tönt eine Stimme aus den Lautsprechern des Adelphi Theatres in London. Ich war damals auf Abschlussfahrt mit meinem Jahrgang in Großbritannien und hatte ein Ticket für „Sunset Boulevard“, dem damals neusten Werk von Andrew Lloyd Webber ergattert. Obwohl ich nur „With One Look“ in der Version von Barbra Streisand aus ihrem Album „Back To Broadway“ kannte, gefiel mir dieser Teaser und kurzentschlossen vergaß ich alle Vorsätze.
Meine Lehrerin wusste nämlich nichts von meinem Vorhaben mir alleine in London eine Show anzusehen. Später meinte sie dann zu mir, ich hätte ihr doch Bescheid geben können, sie wäre mitgekommen. Sie war nämlich nicht nur meine Englischlehrerin, die mir die Liebe zur englischen Sprache und zu Großbritannien näherbrachte, ich war auch ihr Lieblingsschüler. Damals war mir das nicht so bewusst, doch in der Retrospektive ist es nicht zu leugnen. Und warum sollte ich das auch? Ich habe ihr viel zu verdanken. Die Liebe zu London ist bist heute bedingungslos geblieben. Und auch die Liebe zu „Sunset Boulevard“.
Vielleicht weil es mein erstes Musical in London war, vielleicht weil ich ein nostalgischer Mensch bin oder weil ich Elaine Paige als Norma Desmond sah. Ihre Stimme war es, die ich über die Lautsprecher vernahm.

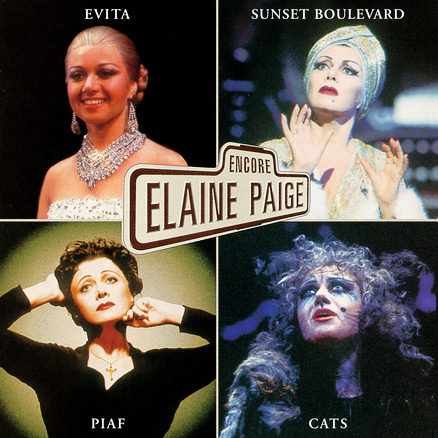
Sie ist der Inbegriff eines Musicalstars. Im Vereinigten Königreich heißt sie nicht ohne Grund die First Lady Of British Musical Theatre: Sie war die „Evita“ der Welturaufführung, Grizabella in „Cats“ und später sah ich sie noch als Anna in „The King Andi I“.
Paige vereint die Symbiose aus Schauspiel und Gesang in makelloser Perfektion. Ihre Norma war artifiziell, illusioniert, träumerisch und zart. Dann wiederum konnte ihr Mezzo stark und durchdringend sein. So stark, dass die Lautsprecher des Adelphis bebten. Ihre feinen Details mit denen sie ihre Rolle kreierte und zum Leben erweckte, konnte ich selbst aus dem ersten Rang sehen. Es war fast als würde sie nur für mich spielen und singen.
„We didn’t need words, we had faces“ sagt Norma zu Joe. Diese Mimik und das theatralische gestikulieren der Hände sind mir noch sehr präsent.
Spätestens bei „With One Look“ war es um mich geschehen. Es war wie ein sich lösendes Ventil, wie ein Eintauchen in einen mir bislang unbekannten, neuen Kosmos: das war die Stimme, nach der ich so lange suchte. Wie eine Berührung schmeichelte, liebkoste und beseelte mich diese Stimme. Ich war schockverliebt. Waren noch andere Darsteller auf der Bühne (ein großartiger Alexander Hanson als Joe und Michael Bauer als Max) so hatte ich nur Augen und Ohren für Elaine Paige. Jede ihrer Auftritte war ein Starauftritt – jede ihrer Nummern eine Tour-de-force Extravaganza. Ein Hauch von Hollywood umgab ihre Norma.
Bei ihrer Rückkehr in die Paramount Studios in dem legendären von Anthony Powell designtem Kostüm aus Pelzstola und Pfauenfeder Fascinator, steht sie still, fast bewegungslos da. Als sie ihr „As If We Never Said Goodbye“ beginnt, ist es so still im Theater, dass auch ich nicht wage zu atmen. Als der Climax anschwillt und sie „I’ve come home at last“ singt ist dies eine Ganzkörpergänsehaut die ich heute noch spüre, wenn ich daran denke. Ohne Zweifel steht hier ein echter Musicalstar center stage. Tosender Applaus nach dem Song, das Publikum ist außer sich vor Euphorie. Eine Tatsache die bei britischem Publikum, wie ich im Laufe der Jahre noch bemerken sollte, nicht selbstverständlich ist. Als Elaine Paige dann als Norma im Wahnsinn die fulminante Treppe ihrer Villa herunter schreitet und ihr letzten Zeilen singt gehört das zu den eindringlichsten und größten Augenblicken der jüngeren Musicalgeschichte. Die exzellente Regie von Trevor Nunn, die elegische Musik von Andrew Lloyd Webber, die immer noch für mich zu seinen besten zählt sind unvergessliche Erinnerungen, die sich tief in mein Herz gebrannt haben.

Review: Sunset Boulevard (Heilbronn)

Theater Heilbronn
11.02.2023
von Marcel Konrath
„Mein“ Sunset liegt mir sehr am Herzen. Ich habe über die Jahre viele verschiedene andere Inszenierungen als die Original Produktion von Trevor Nunn gesehen. Einige waren großartig, einige ok und andere wiederum möchte ich lieber vergessen. Nun inszeniert Tilman Gersch „Sunset Boulevard“ für das Pfalztheater Kaiserslautern, das nun im Theater Heilbronn gastiert. Es gibt Licht, aber auch sehr viel Schatten bei dieser Produktion. Gleich zu Beginn vertraut Gersch nicht auf die Ouvertüre, sondern lässt den toten Joe Gillis quirlig auf der Bühne Spazierengehen. Richtig viel zu tun hat dieser erstmal nicht als überflüssige Faxen zu veranstalten, daher wirkt der Beginn etwas unbeholfen und deplatziert.
Eine der größten Fehler der Produktion und das wird schon recht früh klar ist der Einsatz von Statisten. Diesen dann auch noch Text zu geben, halte ich für ein waghalsiges Unterfangen. Nicht nur ist es eine Ohrfeige für jeden professionellen Schauspieler, der mehrere Jahre eine Schauspiel- oder Musicalausbildung absolviert hat, unweigerlich wird man als Zuschauer auch aus der Illusion der Inszenierung gerissen.
Die Ausstattung von Julia Hattsein trifft den Tenor des Stückes gut, vor allem die 40er Jahre Kostüme, für die sie ebenfalls verantwortlich ist, sind exquisit. Ausgerechnet die Kostüme von Norma Desmond fallen dagegen etwas einfallslos aus. Die Original Kostüme von Anthony Powell bleiben auf immer unvergessen und unerreicht. Der erste Auftritt von Norma ist grundsolide. Debra Hays ist eine Norma, die ihr „Nur ein Blick“ routiniert singt, bei dem schauspielerisch aber so gut wie nichts passiert. Ihr Gesicht wirkt hier recht teilnahmslos. Überhaupt wirkt ihre Norma nicht manisch oder exzentrisch genug um glaubhaft zu vermitteln sie lebe in ihrer eigenen Welt. „Nur ein Blick der dich tief berührt nur ein Blick, schon bist du entführt“ stimmt hier leider nicht. Ihr Tanz als Salome („die Frau, die alle Frauen war“) wirkt leider albern und kindisch und wenig überzeugend. Stark dagegen Daniel Eckert als Joe. Stimmlich und schauspielerisch trifft er genau die richtigen Nuancen und Facetten. Leider hat Daniel Böhm als Max einen schauspielerischen Totausfall zu beklagen. Wenn auch der Stimmsitz vorhanden ist, wird der Figur des Butlers jedes Mysteriums beraubt und verkommt hier zur Witzfigur. Wie er später bei „Das perfekte Jahr“ hilflos versucht kleine Schirmchen in die Cocktails zu drapieren ist einfach nur peinlich und überflüssig. Was hat sich die Regie dabei nur gedacht? Adrienn Cunka ist als Betty stimmlich sehr gut, wirkt aber zu unsympathisch, wenn sie im Gespräch mit Joe versucht wie eine verbissene Fräulein Rottenmeier ihn zum gemeinsamen Drehbuchschreiben zu bewegen. Ihren Verlobten Artie mit Peter Floch zu besetzen ist eine eklatante Fehlbesetzung, denn dieser ist mindestens 20 Jahre älter und passt damit für mich nicht ins Rollenprofil.
Grandios aufspielend ist hingegen das Orchester und eine wahre Freude so einen opulenten Sound aus dem Orchestergraben zu vernehmen. Selbstverständlich wird personaltechnisch auf den eigenen Chor zurückgegriffen. Leider hat den Damen und Herren anscheinend niemand vorher mitgeteilt dass „Sunset Boulevard“ keine Oper, sondern ein Musical ist. So wirken einige Ensemblerollen etwas out of place. In der besuchten Vorstellung waren zudem einige Mikrofine der Darsteller nicht oder wahlweise zu spät eingeschaltet. Das ist leider ein unverzeihlicher Fauxpas. Die Bühne ist in ihrer Konzeption durchaus zweckdienlich, wenn auch nicht sehr opulent ausgestattet. Besonders der Villa von Norma wird zu wenig Raum geboten. Kaum zu glauben das in dieser kargen Umgebung ein echter, vermögender Filmstar leben soll. Warum die gesamte Schlussszene ausgerechnet vor der Villa stattfinden muss, wobei dort nur die Fassade zu sehen ist, ist nicht nachvollziehbar. Etwas befremdlich sieht es aus, wenn Norma ein Fenster dieser Fassade öffnet und umständlich dahinter mit Betty telefoniert. Immer wieder setzt die Regie auch das hauseigene Ballett Ensemble ein. Diese wirken bei Eckerts Interpretation des Titelsongs aber sehr fehl am Platz so dass der Fokus nicht mehr auf Joe und dessen Anklage liegt, sondern mehr auf dem Tanz. Schade, dass hier dem guten Hauptdarsteller keine richtige Plattform ermöglicht wird auch solo zu glänzen. Daniel Eckert hat als Joe Gillis starke Momente, wird oft aber auch von der Regie allein gelassen wird.
„Sunset Boulevard“ ist nach wie vor ein starkes Stück, mit wunderschöner, kraftvoller Musik und einem interessanten Plot, basierend auf Billy Wilders Meisterwerk. Ich werde immer bereit für die Nahaufnahme sein auf meinem „Sunset Boulevard“.
Review: Perplex

Premiere 10.02.2023
Stadttheater Fürth
von Marcel Konrath
Nach dem gemeinsamen Urlaub ist die Wohnung von Robert und Eva merkwürdig verändert. Die Pflanzen sind neu arrangiert, der Strom ist abgestellt und ein mysteriöses Paket gibt Rätsel auf. Das befreundete Paar Sebastian und Judith hätte sich eigentlich um die Wohnung kümmern sollen, doch ausgerechnet die nehmen nun plötzlich die Position der „wahren“ Bewohner ein. Was dann beginnt ist ein skurriler Reigen von Identitätsverwandlungen und boulevardesker Sinnestäuschungen von Autor Marius von Mayenburg. In seiner Regie feierte das Stück bereits 2010 Premiere an der Berliner Schaubühne und wird nun in Fürth von Stefan Butzmühlen neu inszeniert und interpretiert.
Die Raffinesse mit der Butzmühlen gekonnt mit den Erwartungen der Zuschauer spielt und grotesk seine hervorragenden Schauspieler mit und gegeneinander ausspielt ist so raffiniert wie genial und voller Finesse. Im Bühnenbild von Peter Wendl entsteht ein an M.C. Escher erinnerndes labyrinthartiges auf und ab. Wie bei Escher entsteht bei Butzmühlen Darstellungen perspektivischer Unmöglichkeiten und absurder Wahrnehmungsphänomene. Ist wirklich alles so wie es scheint oder verbirgt die Realität ihr wahres Gesicht? Was ist echt und was ist nur Theater? Wer liebt wen in dieser surrealen Anordnung von Beziehungen? Sebastian Robert oder Robert Judith oder doch Eva Sebastian? Oder ist vielleicht alles ganz anders in diesem Mikrokosmus?
Hannah Candolini, Sunna Hettinger, Mark Harvey Mühlemann, Frederick Redavid sind ein starkes und rasant auftrumpfendes Quartett die mühelos die fadenscheinige und mal feine, mal brachial schmerzende Doppeldeutigkeit des Stückes entlarven und dabei hervorragend homogen als Team funktionieren. Da wird mit Herzblut gespielt, gelacht, geflucht, geliebt und gehasst, dass es eine Freude ist dies mitzuerleben. Egal ob Skifahrer, Vulkan oder SS Uniform: Susanne Suhr beweist ein sicheres Geschick mit ihren Kostümen.
Wenn dann auch noch die vierte Wand durchbrochen wird, das Saallicht angeht und einige Zuschauer nervös auf ihren Sitzen umherrutschen (der ein oder andere hat sich wohl schon als Teil der Inszenierung betrachtet) werden wir, das Publikum direkt konfrontiert. An dieser Stelle wäre es aber gemein zu spoilern: nur soviel sei erwähnt: neue, ungewöhnliche Blickwinkel werden eröffnet.
„Perplex“ ist ein Stück, dessen Geburtsstätte, die Schaubühne, eindeutig spürbar ist und Thomas Ostermeier atmet. Die Namen der Protagonisten sind identisch mit den Namen der Schauspieler*innen der Uraufführung: Eva Meckbach, Judith Engel, Robert Beyer und Sebastian Schwarz. Der Regisseur der Fürther Fassung Stefan Butzmühlen findet jedoch einen neuen, frischen, süffisanten und sehr lebendigen Weg seiner eigenen, pointierten Interpretation die mit tosendem Premierenapplaus belohnt wurde.
Photo: Thomas Langer
Review: Die Nacht der Musicals

Meistersingerhalle Nürnberg
06.02.2023
von Marcel Konrath
Ich habe da diese eine Freundin und immer, wenn ich bei ihr als Beifahrer mit im Auto sitze, komme ich unentwegt in die Versuchung mitzubremsen. Sie hält sich nämlich weder an Geschwindigkeitsbegrenzungen, rechts vor links gibt es nicht und sowieso hat sie immer Vorfahrt. In einer Tour brettert sie so durch die Landschaft. Ein Wunder, dass bislang kein Unfall passierte und umso erfreulicher, dass niemand personellen Schaden nahm, bis auf mein fragiles Nervenkostüm.
Und an diese eine Freundin musste ich denken, als ich das sah was man nur als Auffahrunfall mit erhöhter Schwere bezeichnen kann. „Die Nacht der Musicals“. Wie meine Freundin ihr Auto und meine Nerven malträtiert, brettert das Musical Konzert ohne Rücksicht auf Verluste durch die Welt des Musicals und presst mich, ohne die Möglichkeit den Haltegurt anzulegen in den Sitz. Der Tritt auf die imaginäre Bremse will nicht gelingen, so sehr ich mich auch bemühe dem dargebotenen Grauen zu entfliehen, die Zentrifugalkraft ist schlauer und schneller.
Gleich zu Begin wird die Frage gelöst, was wirklich mit Baby Jane geschah. Die spielt nämlich jetzt Musical und mimt auf Michelle Williams in „Greatest Showman“ mit weißer Schminke und gefühlt 40 Jahre zu alt für die Partie. Was bei Bette Davis im Film „What ever happend to Baby Jane” noch gewollt unheimlich aussah, verkommt hier zur sterilisierten Farce des Grauens. Warum sich Merle Saskia Krammer berufen fühlte im Operettengesang wie eine debil schauende Aufziehpuppe auf Valium durch die Gegend zu staksen, kann wahrscheinlich nur der nicht namentlich genannte Regisseur beantworten. Im Verlauf des Abends wird Krammer die Zuschauer u.a. noch als Elisabeth, Christine und Janet beglücken, wobei das ein Verb ist was ihre Gesangskünste nicht annährend und gebührend ausdrückt . Es ist der identische Effekt, den Fingernägel auf einer Schultafel verursachen oder der geißelnde durchdringende Bohrer beim Zahnarzt: So oder so weiß jeder sofort: das ist nicht angenehm und nicht wohlklingend.
Und so wird es tatsächlich ein langes Programm. Nicht falsch verstehen, wo bekommt man an einem Abend schon die Möglichkeit Ausschnitte aus „Tanz der Vampire“, „Rocky“, „Wicked“, „Die Eiskönigin“ und „We Will Rock You“ zu erleben? Da es aber eine ganze Flut an best of Musical Galas gibt die querfeldein durch deutschsprachige Hallen touren, sei hier ausdrücklich erwähnt was Qualität, Finesse und technische Umsetzung betrifft rangiert „Die Nacht des Musicals“ eindeutig auf den hinteren Plätzen. Alles an diesem angestaubten Programm wirkt lieblos zusammengeschustert, die Kostüme sind billige Überbleibsel vom Grabbeltisch der Resterampe und die Zusammenstellung der Stücke wirkt manchmal fragwürdig, oft uninspiriert und häufig schmerzvoll.
Ich habe Fragen! Warum werden Ausschnitte aus der Netflix Serie „Haus des Geldes“, ein Ed Sheeran Popsong und „Vivo per lei“ von Andrea Bocelli verwurstet und was haben sie bei einem best of Musical zu suchen? Hätte es dazu mäßig inspirierte Tanzeinlangen gebraucht? Ich sage nein! Wäre es bei der „Greatest Showman“ Sektion verzichtbar gewesen einem der Darsteller Schuhe an die Knie zu binden, so dass dieser als kleinwüchsig herhalten muss? Und warum kommt die komplette Musik als Halbplayback vom Band. Warum muss ein Off-Sprecher extra drauf hinweisen, dass sämtliche Interpret*innen live singen? Warum singt Alessandro Frick den Judas aus „Jesus Christ Superstar“ so als hätte er ADHS und zusätzlich Koks in seinem Frühstückskaffee? Warum wird Carolin Rossow wenig charmant angekündigt mit „Letztes Jahr spielte sie im Paderborner Weihnachtszirkus“? Fragen über Fragen! Warum war Bruno Grassini zwar First Cast in der Wiener „Elisabeth“ Produktion von Harry Kupfer, singt aber keinen einzigen Song aus der Show? Und warum wird der Fremdschämfaktor bis auf Anschlag gedreht, wenn Alessandro Frick als Frank’n’Furter völlig überdreht und spaßbefreit das Publikum mit peinlichen Stöhnlauten belästigt?
„Die Nacht der Musicals“ ist eben das Paradebeispiel eines Auffahrunfalls: absolut vermeidbar, überflüssig, sehr schmerzvoll und es können Personen aka das Publikum zu Schaden kommen. Ich denke beim nächsten Mal steige ich nicht zu meiner Freundin ins Auto, sondern nehme lieber die öffentlichen Verkehrsmittel oder setze mich selber an Steuer und achte bei meiner Fahrweise vor allem darauf umsichtig und defensiv unterwegs zu sein. Über „Die Nacht der Musicals“ hingegen hülle ich den Schleier des Vergessens.
Review: Live in Concert The Music of Harry Potter

Meistersingerhalle Nürnberg
23.01.2023
von Marcel Konrath
Als J.K. Rowling 1995 ihren ersten Harry Potter Band „Harry Potter und der Stein der Weisen“ beendete, konnte wohl niemand ahnen welche Welle der Euphorie sie damit in Wallung befördern würde.
Auch gut 25 Jahre später gehören Harry und seine Freunde Ron und Hermine zum internationalen Kulturgut und sind aus keinen Kinder- und Jugendzimmern wegzudenken. Auch bei vielen Erwachsenen erfreut sich der Zauberspößling stetiger Beliebtheit. So war es auch nicht weiter verwunderlich, dass alle Verfilmungen der Buchreihe für volle Kinokassen sorgten.
Was neben den kongenialen Umsetzungen aller Teile bleibt, ist neben der großartigen Besetzung vor allem die fantastische Musik. Filmkomponist Legende John Williams, der für legendäre Scores wie „E.T.“, „Der weiße Hai“, „Jurassic Park“ und „Schindlers Liste“ verantwortlich ist, schuf mit der Musik zum ersten Harry Potter Film ein weiteres Meisterwerk und einen Meilenstein der Filmmusik Geschichte. Inspiriert wurde er bei seiner Komposition vor allem von klassischen Komponisten wie Tschaikowski.
Unvergesslich und sofort ins Ohr geht beispielsweise „Hedwigs Theme“ des mehrfachen Oscar Preisträgers, welches die Cinema Festival Symphonics während des Konzertes „The Music Of Harry Potter“ als Opener spielen. Der üppige, satte Sound des Orchesters lässt den Zuschauer (und Hörer) von Sekunde eins in die magische Welt von Hogwarts eintauchen. Bei dem aus über 80 Mitwirkenden bestehenden Ensemble sorgen neben dem hervorragend aufspielenden Orchester auch Chor und eine Solistin für die ideale symphonische Begegnung mit der ikonischen Musik.
Neben John Williams, der insgesamt drei Filme vertonte, gibt es auch die Gelegenheit die Musik von Patrick Doyle („ Harry Potter and the Goblet of Fire“), Nicolas Hooper („Harry Potter and the Order of the Phoenix“ & „Harry Potter and the Half-Blood Prince“) und Alexandre Desplat („Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 & 2) zu genießen.
J.K. Rowling erschuf mit ihren Worten und Gedanken einen Romanhelden, der auf ewig in unseren Herzen leben wird und die Musik macht die Filme unsterblich. Tosender Applaus für alle Beteiligten und viele zufriedene, beseelte Gesichter beim Schlußapplaus.
Review: Falstaff

Premiere: 22.01.2023
Staatstheater Nürnberg, Opernhaus
von Marcel Konrath
Als Falstaff seine Welturaufführung feierte, war sein Komponist bereits fast 80 und hatte bis dahin, heute als Klassiker erachtete Werke vertont, darunter „Don Carlos“, „Aida“, „Nabucco“. Und in den Jahren 1851 bis 1853 verfasste er die drei Werke, mit denen er praktisch die italienische Oper neu definierte: „Rigoletto“ (1851), „Il Trovatore“ (1853) und „La Traviata“ (1853): Giuseppe Verdi.
Mit „Falstaff“ entstand gleichzeitig Verdis letzte Oper. Es ist sein Alterswerk, sein letztes Vermächtnis, mit dem er noch einmal zeigen konnte was ihn ausmacht. Eindrucksvoll ist seine Musik auch heute noch, wirkt sie doch um einiges durchkomponierter und kommt ohne spezielle Gassenhauer Arien aus als frühere Opern. Auf einen Gefangenchor a la „Nabucco“ oder ein „Libiamo, ne’ lieti calici“ aus „La Traviata“ wartet man bei „Falstaff“ vergebens. Doch es gibt viele Gründe die gewitzte und leicht ins Ohr gehende Partitur Verdis auch gut 120 Jahre nach ihrer Erstaufführung zu schätzen. Kritiker attestierten Verdi hier sogar eine Nähe zu Wagner. Sicher ist die Musik sehr ausdrucksstark und kann sich bestens gegen etwaige Konkurrenz Werke behaupten.
Da Falstaff selten gespielt wird, ist die Inszenierung im Staatstheater Nürnberg eine willkommene Begegnung mit Verdis Spätwerk. Doch als der Vorhang sich an diesem Sonntagabend öffnet wird schnell klar, dass hier kein Mensch der Maßlosigkeit und Völlerei zu sehen ist, sondern ein trauriger Schatten seiner selbst. Falstaff (Claudio Otelli) ist ein blasser Emporkömmling, der in einer Trabantenstadt mit unzähligen kleinen Balkonen und Satellitenschüsseln ein tristes Dasein fristet. Zwischen Döner Spieß, Müll und Straßenkämpfen führt er ein trauriges und ereignisloses Leben. Zusammen mit seinen Dienern Bardolfo (Martin Platz) und Pistola (Nicolai Karnolsky) die hier als Halbstarke ihr Unwesen treiben, schmiedet er Pläne wie er die verheirateten Frauen Alice und Meg verführen kann. Es geht ihm hier ganz klar ums Geld, mit dem er sein Leben finanziell aufwerten kann. Falstaff wird in allen literarischen Vorlagen als Säufer, Vielfraß und hemmungsloser Lügner beschrieben. In der Inszenierung von David Hermann ist er einfach nur ein Langweiler, der lustlos und unmotiviert seine amourösen Affären intrigiert. So sind es vor allem die Damen die hier richtig glänzen können. Sie werden hier als „Desperate Housewives“ mit Villa und Porsche entlarvt.
Brilliant Emily Newton als Alice Ford, makellos Chloë Morgan als ihre Tochter Nannetta, virtuos Almerija Delic als Mrs. Quickly und bravourös Corinna Scheurle in der Partie der Meg Page. Der wundervollen weiblichen Besetzung ist es auch zu verdanken, dass der Abend nicht ganz entgleitet. Hermann findet nicht den richtigen Weg zwischen Satire, Dramatik und Slapstick. So fehlt seiner Inszenierung besonders im 1. und 2. Akt der nötige Biss. Einfallsreich sind hingegen die Projektionen von Jo Schramm. Rätsel geben dagegen die Kostüme von Carla Caminati auf. Vor allem im dritten Akt erinnert Falstaffs Verkleidung fast beängstigend genau an Chewbacca aus „Star Wars“. Großartig dirigiert Björn Huestege die bestens aufgelegte Staatsphilharmonie Nürnberg. Dort wo es Hermanns Produktion an Ideenreichtum etwas vermissen lässt, beflügelt sein hervorragendes Ensemble die Melodien Verdis. Zum Finale ist dann zwar nicht alles gut und die Konstellationen der Protagonisten nicht vollständig aufgelöst, aber tutto nel mondo è burla, l’uom è nato burlone. (Alles ist Spaß auf Erden, der Mensch als Narr geboren.)
Review: Chocolat

Stadttheater Fürth
21.01.2023
von Marcel Konrath
Eine szenische Lesung ist ein mysteriöses Zwischenwesen von erstaunlicher Ambivalenz. Eine Symbiose aus klassischem vorlesen und darstellerischen Spiel. Es bedarf einer punktgenauen und behutsamen Adaption des Originalstoffes und einer treffsicheren Inszenierung um daraus eine abendfüllende, gehaltvolle Produktion zu zaubern. Martin Mühleis ist dies mit seiner Adaption von Joanne Harris Roman „Chocolat“ vollends geglückt.
Die Fabel von der Vianne Rocher, die in ein französisches Dorf in der Bourgogne kommt um dort eine Chocolaterie zu eröffnen, ist noch durch den Film von Lasse Hallström gut in Erinnerung und mit Juliette Binoche, Johnny Depp, Alfred Molina und Judi Dench hochkarätig besetzt. In der szenischen Lesung verkörpern vortrefflich Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer die beiden Widersacher Vian und Dorfpfarrer.
Beide schaffen es vorzüglich die amüsanten Reibereien, aber auch das französische Flair auf die Bühne zu bringen. Die Beschreibung wie Viviane die ihre Schokolade verarbeitet und zu Pralinen veredelt ist so sinnlich und verführerisch, dass man diese schokoladigen Träume gerne probieren würde. Zur zauberhaften Vianne in Form von Ann-Kathrin Kramer steht der stets nörgelnde, von seinen eigenen Ängsten und Zweifeln geplagte Harald Krassnitzer kongenial gegenüber. Wie die beiden aneinandergeraten und Krassnitzer der Versuchung der Schokolade erliegt ist äußerst komisch und wunderbar gespielt. Beide laufen zu Höchstform auf, so dass schon rasch die Grenzen zwischen Lesung und Spiel verschwimmen.
Unterstützt werden die beiden Schauspieler musikalisch von Les Manouches du Tannes (eine Anspielung auf das fiktive Örtchen, in dem der Roman spielt). Das Quartett sorgt dabei mit Musik von Django Reinhardt und Charles Aznavour für den luftig einnehmen Hauch Frankreichs.
„Chocolat“ ist ein Märchen für Erwachsene, dass aber auch wichtige Themen wie Toleranz, die Würde des Menschen aber ebenso für die Freude am Leben plädiert.
Durch eine einfache Leinwand wird der Ortswechsel zwischen den beiden Protagonisten dargestellt. So befindet sich Vianne auf der rechten Seite, gemeinsam mit den Musikern. Sichtbar ist dann links eine Leinwand mit einem projizierten, gemalten Bild ihrer Chocolaterie. Kommt dann wieder ihr Gegenspieler zum Einsatz wird die Leinwand kurzerhand nach rechts verschoben und gibt den Blick auf Pfarrer Francis frei. Mit einfachen Mitteln wird so maximales erreicht.
Diese Lesung löst sich immer wieder vom geschriebenen Wort. Die Akteure kleben also nicht sklavisch an den vorhandenen Textbüchern, sondern können ihr Spiel frei entfalten. Bringt der Roman noch mehrere andere Handlungsebenen zusammen, konzentriert sich Mühleis in seiner Adaption auf die Konstellation zwischen Vianne und dem Pfarrer. „Chocolat“ versprüht eine intensive Verführung aller Sinne und kann dank der hervorragenden Schauspieler*innen samt musikalischer Begleitung überzeugen. Man sieht dem bunten Treiben auf der Bühne nur zu gerne zu. Dieser kurzweilige Abend geht garantiert nicht auf die Hüften, denn hier werden häufig die Lachmuskeln gefordert. Ob der ein oder andere Zuschauer nach der Vorstellung zu hochwertigem Naschwerk greift, ist dabei natürlich voll und ganz eine persönliche Entscheidung.
Review: Kleiner Mann - was nun?

Theater Erlangen
Premiere am 20.01.2023
von Marcel Konrath
Eine Fernbedienung ist schon eine verdammt gute Erfindung. Beliebig kann der geneigte Zuschauer selber entscheiden mit was genau er seine oft karge Freizeit verbringen möchte. So ist ein Umschalten auf einen anderen Sender oder auf ein anderes Streaming Portal problemlos realisierbar. Doch birgt ein solches Sehverwalten nicht auch etwaige Risiken mit sich? Sind wir als Zuschauer Opfer unsers eigenen Konsums? Sind wir gar nicht mehr in der Lage uns für eine limitierte Zeit einem komplexen Thema zu widmen? Ist nicht gerade das Theater immer noch der beste Multiplikator um uns für mehrere Stunden einem Thema zu widmen, bei dem wir beim Streaming Anbieter schon nach kurzer Zeit die Fernbedienung zücken würden? Gerade erst startete die vierte Staffel von „Babylon Berlin“ auf einem solchen Streaming Portal. Die Serie von Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handloegten ist nicht nur eine der kostspieligsten und aufwändigsten Deutschen Serien aller Zeiten, sie ist auch klar eine der besten. Das Berlin der 20er und 30er Jahre wird hier so rau, dreckig und eloquent genau dargestellt wie selten zuvor. Zuletzt schaffte Dominik Graf mit seinem „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“ eine exzellente Zeitreise in die Dekade der Weimarer Republik. Hans Fallada traf mit seinem Portrait des politisch wankelmütigen Kleinbürgertums den Puls der Zeit. Die Protagonisten sind Menschen mit echten Problemen, Träumen und Ambitionen. Sie sind Abbilder ihrer Zeit in der sich der damalige Leser sicher gut wiederfinden konnte. Der österreichische Literat Paul Elbogen schrieb damals: „Dass einer aus dieser Dreckzeit [..] nicht nur keine Spottgeburt, sondern etwas herrliches machen kann, DAS ist das Mirakel! Pinneberg und Lämmchen werde ich nie vergessen. Wer weiß, ob in fünfzig […] oder in hundert Jahren einer ihr Buch noch verstehen wird – aber heute versteht man es.“
Verstanden hat Regisseur Thomas Kruppa, der seine Inszenierung von „Kleiner Mann, was nun“ am Markgrafen Theater Erlangen präsentiert, allem Anschein nach nicht. Denn dass war sich wie ein eitriges Geschwür auf die Bühne erbricht ist ein nicht enden wollender Betriebsunfall. Angesiedelt auf einem Kinderspielplatz mit Sand (oder vielmehr Sägespänen) und Klettergerüst kraxeln, schlingen, winden und mühen sich die sieben Schauspieler für zähe 2,5 Stunden. Dabei sind im Hintergrund beliebige, lustlos ausgewählte Animationen und Bilder zu sehen, die entweder so aussehen als seihen sie mit dem letzten noch existierenden Commodore PC der Welt designt wurde und von jemanden erstellt, der sich weder mit dem Stück noch mit der Materie an sich auseinander gesetzt hat. Kommentiert wird die Fassung von Sibylle Bachung und Michael Thalheimer von einem Chor, der jegliche zwischenmenschliche Kommunikation und Emotion im Keim erstickt. So wirkt der Text von Fallada („Nur nicht arbeitslos werden“) als monoton aufgesagte Pamphlete nicht etwa anregend und stimulierend sondern nervtötend und einschläfernd. Schade, sind doch so viele von Falladas Sätzen so aktuell wie selten zuvor. Besonders das Thema Arbeitslosigkeit und der Gedanke immer gefallen und funktionieren zu wollen und nichts wert zu sein ohne Arbeit ist aktueller denn je. Leistungsdruck in einer Leistungsgesellschaft eben.
Johannes Rebers als Pinneberg und Alina Valerie Weinert als Lämmchen spielen im Rahmen ihrer gegeben, inszenatorisch limitierten Möglichkeiten solide und zaubern immer mal wieder, kleine schöne Momente, die schnell wieder von Kruppas brachial utopischer Regie zerstört werden. In der Essenz hätte das ein eindringlicher, interessanter Abend werden können, aber da hätte die Regie um einiges tiefer in die Materie eintauchen müssen. Es ist wie eine Spielfilmfolge von „Babylon Berlin“: Nur ohne Talent, Budget, Spannung und Kreativität. Diese Inszenierung ist wie der schale Geschmack von abgestandenem Wein, wie ein schimmliges Zimmer dass nach Entlüftung verlangt oder eine gammlige Banane in der Obstschale: man möchte sie am liebsten sofort und augenblicklich entsorgen oder am besten: einfach umschalten auf ein anderes Programm. Falladas Figur Pinneberg formuliert es im Roman treffend: „Der Arbeiter kriegt sein gut Essen nicht, und ich krieg mein Theater nicht: Es ist alles die gleiche Wichse.“
Review: Hairspray

Staatstheater Nürnberg, Opernhaus
rezensierte Vorstellung: 30.12.2022
von Marcel Konrath
Es liegt schon ein paar Jahre zurück, da sah ich eine nicht näher namentlich genannte Produktion in einer X-beliebigen Stadt, die mich an meiner Liebe für das Theater stark zweifeln ließ. Die Inszenierung war so unteririsch schlecht, dass sich jede Minute anfühlte wie ein tiefer Schlag in die Magengrube. Eine Tortur von Anfang bis Ende, bei dem ich fassungslos in meinem Zuschauersitz versank und die gesamte Theaterwelt anzweifelte. Und dann gibt es wiederum Abende, die mir bewusst machen warum ich Live Theater so sehr liebe. Melissa King inszeniert „Hairspray“ von Marc Shaiman am Staatstheater Nürnberg und plötzlich ist die Welt wieder in Ordnung. Die vielseitige King sorgt bei „Hairspray“ nicht nur für den richtigen Feinschlief und inszenatorische Stärke, sie kümmert sich wie fast immer in ihren Arbeiten, auch kongenial um eine exzellente Choreografie. Beides meistert Melissa King formidabel. Das was sie auf die Nürnberger Bühne zaubert hat internationales Niveau und glänzt nur so vor espritvollen und starken Einfällen, Liebe zum Detail und exzellenten Ideen.
Getragen wird das Stück von der sensationellen Beatrice Reece als Tracy Turnblad. Reece triumphiert dabei in Gesang, Tanz und Schauspiel und brilliert in einer der besten Leistungen, die ich seit sehr langer Zeit in einem Musical auf einer deutschsprachigen Bühne gesehen habe. Ihre Tracy hat ein großes Herz und eine Stimme zum niederknien. Reece überzeugt von Sekunde eins mit „Good Morning Baltimore“ bis zum schweißtreibenden Finale von „Niemand stoppt den Beat“. „Tracy liegt mir besonders am Herzen, weil sie ein so optimistischer Mensch ist und ihre Mitmenschen nicht nach dem Äußeren bewertet.“ sagt Melissa King über ihre Protagonistin. „Die Autoren haben es geschafft, über so viele Themen zu sprechen, die heute leider immer noch aktuell sind: LGBTQ+ Rechte in der Figur der Edna, Rassismus gegenüber Schwarzen, Feminismus und Body Shaming in der Figur von Tracy.“
Baltimore, 1962. Die „Corny Collins Show“ ist das Zentrum von Tracys Welt. Jeden Tag präsentieren hier die „Nicest Kids in Town“ die neuesten Tanzschritte. Einmal dabei zu sein, ist Tracys großer Traum. Doch dafür scheint sie zu dick und zu unangepasst. Als sie beim Nachsitzen die coolen Tanzschritte der schwarzen Mitschüler*innen kennenlernt, ist ihre Chance gekommen. Keine Chance bekommen dagegen ihre schwarzen Freundinnen, denn sie dürfen in der Fernsehshow wegen der herrschenden Rassentrennung gar nicht erst auftreten. Damit gibt sich Tracy jedoch nicht zufrieden…
Neben der herausragenden Star Performance von Beatrice Reece, ist die Kombination aus Andrea Pagani als Edna und Hans Kittelmann als Wilbur, Tracys Eltern pures Comedy Gold. „Du bist zeitlos für mich“ wird dabei zu einem der vielen, fabelhaften Highlights der Produktion. Tradionell wird, wie in allen anderen Produktionen auch, die Rolle von Mutter Edna von einem Mann gespielt. Kristin Hölck ist als manipulative Velma van Tussle herrlich bösartig und singt dazu erstklassig. Ihre Bühnentochter Amber wird als zickig überkandidelt wunderbar von Marie-Anjes Lumpp gespielt. Benjamin Sommerfeld holt aus Link Larkin ordentlich Witz heraus und singt und tanzt wundervoll. Malcolm Quinnten Henry als Seaweed brilliert gesanglich wie vor allem tänzerisch. Deborah Woodson hat mit „ich weiß wo ich war“ einen echten Showstopper mit dem sie buchstäblich stimmlich das Opernhaus zum beben bringt. Wer hier keine Gänsehaut und feuchte Augen bekommt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen. Vanessa Weiskopf, Meimouna Coffi und Taryn Nelson Di Capri triumphieren als das Dynamite Trio, die wie ein griechischer Chor immer wieder singend das Geschehen kommentieren. Und es geschieht so einiges bei dem Musical, welches 2002 am Broadway uraufgeführt wurde und es über 2.500 Vorstellungen und eine Verfilmung schaffte.
Die Nürnberger Produktion zeigt hervorragend, dass sich das Staatstheater vor keiner en suite Großproduktion verstecken muss. Ganz im Gegenteil: das was King und ihr fulminantes Kreativteam und Cast auf die Beine gestellt haben hat West End und Broadway Klasse. Hier stimmt einfach alles: die multifunktionale Bühne von Knut Hetzer, die wunderbaren Kostüme von Judith Peter, die ganz den 60ern entsprechend designt sind und das großartige Orchester unter dem Dirigat von Andreas Paetzold. Es bleibt der unbändige Wunsch, dass das Staatstheater Nürnberg mehr Musicals auf dem Spielplan einziehen lässt. Der frenetische Beifall und die stehenden Ovationen lassen eindeutig erkennen, wieviel Potential dafür auch im Publikum steckt. Niemand stoppt den Beat dieser grandiosen, alles an Erwartungen übertreffenden Produktion, die hoffentlich noch lange im Repertoire bleiben wird.
Review: Disney Die Schöne und das Biest

Rezensierte Vorstellung: 29.12.22
Frankenhalle Nürnberg
von Marcel Konrath
Als Angela Lansbury ihre Version von „Beauty and the Beast“ aus der Feder von Alan Menken und Howard Ashman für den Zeichentrickfilm sang, war noch nicht auszudenken welchen Legendenstatus sie damit manifestierte. Über Generationen hinweg ist der Zeichentrickfilm von Disney tief in die Herzen des Publikums eingebrannt. Von zeitloser Schönheit erzählt „Die Schöne und das Biest“ (ursprünglich La Belle et la Bête ) das klassische Märchen zwar nicht komplett neu, aber mit soviel Charme, Esprit und liebenswerten Figuren dass man auch beim wiederholten anschauen immer wieder neue Details entdeckt. Und ja, dann gibt es diese grandiosen Melodien von Disney Legende Alan Menken. Menken, der auch als Musical Komponist glänzt, erschuf unvergessliche, virtuose Klänge die auf keiner Best of Musical Gala fehlen dürfen. Der Film war der erste Animationsfilm, der in der Kategorie „Bester Film“ für einen Oscar nominiert wurde. Celine Dion und Peabo Bryson nahmen den Oscar prämierten Titelsong auf, der sich auf Platz 62 des Amerikanischen Filminstitut der besten Songs der amerikanischen Filmgeschichte befindet.
Nach dem überwältigenden Filmerfolg von der Schönen war es also nur eine Frage der Zeit bevor eine Bühnenadaption realisiert wurde. Die Musik dazu offeriert sich buchstäblich auf einem Silbertablett, so organisch und aus einem Guss komponierte Menken seine Partitur. 1994 fand die Broadway Premiere statt und brachte es auf 5,461 Vorstellungen, lief 13 Jahre und landet damit auf Platz 10 der am längsten laufenden Broadwayshows. Für stolze 9 Tony Awards wurde das Musical nominiert. Insgesamt sechs Songs wurden der Inszenierung neu hinzugefügt und bieten so etwas üppigeres Futter für ein abendfüllendes Musical.
Nun hat „Disney Die Schöne und das Biest“ zum wiederholten Male den Weg auf die deutschsprachigen Bühnen gefunden. In der Inszenierung des Budapester Operettentheater von György Böhm erstrahlt die Geschichte in neuem Glanz. Das routinemäßig tourneetaugliche Bühnenbild von István Rózsa mit Drehbühne und einem Konstrukt, dass gleich auf zwei Ebenen mit Treppe seine Wirkung entfaltet, fügt sich gut und funktional in die Geschichte ein. Triumphal ist das Orchester unter der Leitung von Marton Racz. Es ist ein purer Genuss Menkens Komposition in so üppiger und klangvoller Besetzung zu erleben. Gerade an großen deutschen Musicalbühnen wird an der musikalischen Umsetzung und Besetzung oft leider sehr gespart. Umso erfreulicher ist es hier dem satten, luxeriösen Orchestersound zu lauschen. Als Belle ist Flora Széles eine Idealbesetzung. Mit ihrem Mezzo Sopran und ihrem natürlichen Spiel verzaubert sie im Handumdrehen das Publikum. Ihr zur Seite als Biest steht mit Sándor Barkóczi ein starker Partner, der vor allem gesanglich mit seinem warmen Bariton punktet.
Auch wenn die Textverständlichkeit nicht bei allen Darstellern zu jeder Zeit gegeben ist, sind die verzauberten Bediensteten des Schlosses immer wieder für zahlreiche Lacher gut. Vor allem Tamás Földes als von Unruh hat sichtlich Spaß in seiner Rolle und spickt diese immer wieder mit kleinen schönen Einfällen. Im Gegensatz zum Film ist die Annährung von Belle und dem Biest wesentlich plausibler nachvollziehbar, welche Regisseur Böhm mit entzückenden Details und guter Personenführung liebevoll hervorhebt. Die Kostüme von Erzsébet Túri sind kreativ und mit Sinn für Detail gestaltet. So hat Tassilo (Berzsián Markó), der Sohn von Madame Pottine einen Zuckerwürfel auf seinem Kopf und Lumiere (András J. Karsai) kann aus seinen drei Kerzen echte Flammen entzünden.
Die Eröffnungszene mit Schattenspiel (Regie: Ágnes Kuthy) ist beeindruckend und hätte auch gerne im Laufe der Inszenierung erneut aufgegriffen werden können. Die Choreographie von Éva Duda ist solide, enthält aber keine großen Überraschungen parat. Vor allem beim Opener „Belle“ wirken die Bewegungen schon sehr gewollt und gestelzt. Etwas enttäuschend fällt leider „Sei hier Gast“ aus. Hier wird etwas viel Effekthascherei betrieben und auch wenn die tanzenden Gabeln und Löffel nun mal mit dazugehören, wirken die Tänzer an dieser Stelle eher wie Fremdkörper und seltsam deplatziert.
Enttäuschend ist Norman Szentmártoni als Gaston, der zwar optisch 1:1 auf sein Animations-Ich passt, schauspielerisch und gesanglich aber nicht überzeugt und hölzern und blutleer seinen Part verenden lässt.
Singt das Ensemble gemeinsam, so leidet die Textverständlichkeit erheblich und ein breiiger Klangteppich legt sich über die deutsche Einstudierung von Martin Harbauer.
Nikolett Füredi (ungarische Singstimme von Elsa in Disneys Animationswelterfolg „Die Eiskönigin“) überzeugt hingegen als Sympathieträgerin Madame Pottine und berührt mit dem Titelsong das Publikum. Großartig gelöst ist die Verwandlungsszene des Biestes in den Prinzen, die mit einem überraschenden Kniff aufwartet.
So bietet „Disneys Die Schöne und das Biest“ eine phantasievolle, größtenteils gelungene Neuinterpretation des beliebten Disney Klassikers und kann, abgesehen von marginalen Kleinigkeiten, auch in der Tourneeversion überzeugen, denn „Märchen schreibt die Zeit immer wieder wahr.“
DISNEY DIE SCHÖNE UND DAS BIEST ist auf Tour im Theater am Marientor Duisburg vom 04. – 08.01.23 sowie München vom 11. Bis 22.01.23 im Deutschen Theater zu erleben.
Alle weiteren Infos und Karten hier Disney DIE SCHÖNE UND DAS BIEST – Einer der größten Erfolge aus dem Hause Disney in der Original-Musicalfassung. (die-schoene-und-das-biest-musical.de)
Review: The Swingin' Hermlins (Konzert)

Nürnberg, Kleine Meistersingerhalle, 27.12.22
von Marcel Konrath
„Als wir heute in Nürnberg ankamen, hat uns erstmal der Schlag getroffen“. Andrej Hermlin und sein Orchester gastieren an diesem Tag nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag im kleinen Meistersingersaal. Nun steht der Namensgeber der swingenden Hermlins am nostalgischen Standmikrofon und verkündet leicht verwundert, dass für das heutige Konzert ein Weihnachtsprogramm angekündigt wurde, andere Quellen aber auf das aktuelle Swing Programm der Formation hinweisen und auf das die Kombo vorbereitet war. Nun ist es also am Publikum demokratisch abzustimmen, welches Konzert sie wählen und siehe da: ein überwältigendes Gro entscheidet sich für das „Swing is in the air“ Programm. Eine vorzügliche Wahl wie sich schnell herausstellt. Denn auch wenn hier und da noch ein paar wenige Weihnachtssongs auftauchen, ist die Zeitreise in die 20er und 30er ein wahrhaft willkommener Eskapismus.
Die Konzertbesucher tauchen ein in die Welt von Billie Holiday, Duke Ellington und Ella Fitzgerald. Es ist schön zu erleben, wieviel sichtliche Freude es den Vollblut Musikern macht diese Epoche auf das hervorragendste zu zelebrieren und aufleben zu lassen. Hier sitzt jeder Ton und jede Note. Das einzige was an diesem Abend fehlt ist der rauchige, enge Nachtclub in dem das Programm so viel besser aufgehoben wäre. Kellner, die sich mit dem bestellten Gin oder Whiskey an eng aufgestellten Tischen vorbeidrängen. So ist der kleine Meistersingerssal sicher nicht die beste aller Welten, in der das Orchester auftrumpfen kann, aber dennoch eine mehr als willkommene Gelegenheit die swingenden Hermlins live und hautnah zu erleben. Dies ist eine Würdigung von gut gemachter, exzellent ausgeführter und gelebter Musik. Jedem der 8 Musiker merkt man die uneingeschränkte Liebe zur Musik an. Und das Talent bringt jeder, was durchaus förderlich ist, sowieso mit. Und so überträgt sich die gute Stimmung der Band auch nahtlos auf das Publikum.
Rachel Hermlin und ihr Bruder David, der furios und virtuos Schlagzeug spielt und auch noch exzellent steppt, bereichern den Abend durch ihre Gesangskünste: „All Of Me“ (bekannt durch Frank Sinatra) und „I Found my Yellow Basket“, dass Ella Fitzgerald 1938 aufnahm, gehören dabei zu den vielen Highlights des Abends. Es ist eine Reise in die Vergangenheit wo Männer in gutsitzenden Bundfaltenhosen, eleganten Westen und Seidenkrawatten glänzen konnten. Frauen eiferten dem Chic und Glamour Hollywoods, dem goldenen Zeitalter nach, in dem Designer wie Travis Banton und Walter Plunkett glamouröse Roben für Stars kreierten. Rund 2,5 Stunden bietet Andrej Hermlin, der auch gekonnt als Conférencier durch den Abend führt und sein Orchester musikalischen Höchstgenuss für alle Liebhaber von Swing und Jazz. Dass Kultur beseelt und beflügelt wird bei diesem Konzert sehr greifbar und so kann man die Worte von Hermlin sehr deutlich fühlen, endlich wieder vor live Publikum spielen zu dürfen. Sein Aufruf wieder mehr Theater, Kino und Konzerte zu besuchen ist dabei erkennbar eine Herzensangelegenheit, die mit viel Beifall bedacht wird. Denn ohne Kultur, wäre unser Dasein um einiges ärmer und blutleerer. Ein Chapeau an alle Künstler*innen des Abends für diese Zelebrierung und reiche Erkenntnis und auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen mit den swingenden Hermlins.
Denn wie Johann Nestroy so wunderbar sagte: „Kultur beginnt im Herzen jedes einzelnen.“
Review: Flashdance (Tour)

rezensierte Vorstellung:
Nürnberg, Meistersinger Halle, 18.12.22
von Marcel Konrath
Schulterpolster, Stirnband und Kassenrekorder. Die 80er waren sicher nicht immer über Stil und Klasse erhaben, aber sie sind nach wie vor Kult. Sinkt die Stimmung auf der heimischen Party? Kein Problem, denn sobald die Hits aus den 80ern laufen, erholt sich jede noch so lahme Festivität. Diese Musik ist immer noch ein Garant für gute Laune, bei der selbst der müdeste Motorikverweigerer die Hüften kreisen lässt. Neben unzähligen Evergreens, gehört auch sicher Irene Caras „What A Feeling“ aus dem Jahre 1983 zu den all time Favoriten. Der Song gewann sowohl den Oscar, Golden Globe wie auch den Grammy und wurde für den Film FLASHDANCE geschrieben. Beides wurde zu Kult: sowohl Film wie Song haben die Jahre überdauert und besonders der Titelsong ist auch heute noch ein Muss für jede 80er Jahre Party.
Die Weltpremiere des Musicals FLASHDANCE fand dann im britischen Plymouth 2008 statt bevor es 2010 im Londoner West End Premiere feierte. In Deutschland und der Schweiz war FLASHDANCE bereits an einigen Stadttheater zu sehen. Nun macht die Show, in der Inszenierung von Christoph Drewitz wieder Station auf den Bühnen des Landes. Wer hier ein Eintauchen in die 80er Jahre erwartet, wird zunächst vor nüchterne Tatsachen gestellt, denn Drewitz verzichtet weitgehend auf ein Revival der 80er. Weder Schulterpolster, breite Gürtelschnallen, nicht mal Stirnbänder tauchen bei seiner Interpretation auf. Alle Kostüme wirken eher aus der neueren Zeit, als in der Thatcher/Regan Ära verwurzelt.
FLASHDANCE erzählt die Geschichte von Alex Owens, einer jungen Frau aus Pittsburgh. Tagsüber arbeitet sie in einem Stahlwerk und in der Nacht als Tänzerin in einer Bar. Doch sie träumt davon, professionelle Tänzerin zu werden. Als sich Alex in ihren Chef Nick Hurley verliebt, öffnen sich Türen, die vorher verschlossen blieben und sie bekommt die Chance ihres Lebens – ein Vortanzen an der renommierten Shipley Tanzakademie. Doch schon bald wird sie mit den Schattenseiten ihres Vorhabens konfrontiert und muss sich entscheiden: Lebt sie ihr bisheriges Leben weiter oder kämpft sie für ihren Traum?
Im multifunktionalen und clever designten Bühnenbild von Adam Nee tanzt ein energiegeladenes und hoch motiviertes Ensemble zu allen Hits des Films: „Maniac“, „Gloria“, „Manhunt“ und „I Love Rock & Roll“. Besonders Tamara Pascual als Gloria zieht alle Register ihres Könnens: so brilliert sie gesanglich und tänzerisch und gehört damit zu den Highlights des Abends. Drewitz zeichnet eine gute Personenführung und entdeckt innerhalb der Geschichte immer wieder schöne und stimmige Momente und Zwischentöne. Julia Waldmayer ist als Alex tänzerisch wie gesanglich erstklassig und bringt die Halle mit der finalen „What A Feeling“ Nummer zum Kochen. Das Lied worauf alle gewartet haben, zündet vielleicht nicht so ganz wie erhofft, offeriert aber trotzdem ein großes, klassisches Finale für die Choreografie von Kerstin Ried.
Enttäuschend ist allerdings der Sound, denn einige Darsteller sind entweder so stark herunter gepegelt, dass sie kaum zu hören sind oder die Musik ist so laut, dass die Lautsprecher kurz vor einer Rückkopplung stehen. Besonders die Textverständlichkeit von Karina Schwarz als Hanna ist mitunter eine Herausforderung. So braucht es einige Anläufe um den Titel ihrer Solonummer „Eins zu ‚ner Million“ auch inhaltlich zu verstehen.
FLASHDANCE bietet gelungene und kurzweile Unterhaltung. Wenngleich ein Handlungsstrang um den selbst ernannten Stand Up Comedian Jimmy sehr bemüht wirkt und schwerfällig ins Leere läuft. Dieser Plot hätte gut und gerne gestrichen werden können. Weder Figur noch Storyline bringen die ohnehin sehr dünne Handlung weiter und bremst die Show nur unnötig aus. Schade ist auch, dass das Original Kreativ Team nicht die Chance genutzt hat mehr 80er Jahre Songs ins Stück zu integrieren. Denn so richtig extatisch wird das Publikum nur bei den Original Songs des Films, die restlichen neu komponierten Songs von Robbie Roth und Robert Car können nur mit Einschränkung überzeugen und haben keinen wirklichen Ohrwurmcharakter. Doch es lohnt allemal die Leggins anzuziehen, die Stulpen überzustreifen, den Walkman auf höchste Stufe zu stellen und die 80er wieder aufleben zu lassen. What A Feeling!
Review: Flic Flac - X-mas Show





Nürnberg, 15.12.2022
von Marcel Konrath
Zugegeben: Das einzige was an diesem kalten, schneebedeckten Abend in Nürnberg im FlicFlac Weihnachtszirkus weihnachtlich ist, ist die illuminierende Kopfbedeckung des Komiker Duos Clown and a Drummer. Was dann nach dem Opener folgt, ist eine schiere Explosion an unbändiger Akrobatik, Artistik und Entertainment.
Die Künstler*innen sind dabei so unterschiedlich wie individuell vielfältig. Die Truppe Monstertramp beeindrucken mit einem geschickten Trampolin Akt. George Gummi verinnerlicht, was es wirklich bedeutet sich buchstäblich verbiegen zu können. Das Duo Pile ou Face begeistern mit einem zärtlichen und gleichzeitig kraftvollen Einsatz am Sway Pole, einer Art biegsamen Laterne. Artsiom Haurylik zeigt in akrobatischer Höchstleistung seine Kunst des Cyr Wheel. Ein einzelner Reifen wird mit ihm dabei zu einer wendigen Sensation, die kunstvoll und poetisch ist. Mit dem Motorrad demonstrieren Kieran & Rubens ihre filigranen Fähigkeiten mit einem Motorrad umzugehen. Mukhamadi Sharifzoda beweist absolut perfekte Körperspannung und Beherrschung mit seinem Handstand. Zu den Klängen von „Le jardin des larmes“ und den Stimmen von Zaz und Till Lindemann setzt plötzlich durch Bühnenmagie der Regen ein und das Duo To Be Free präsentieren eins der vielen sehenswerten Highlights des Abends. In schwindelerregender Höhe vollziehen die beiden eine fliegende Kollusion der Elemente aus Wasser und Luft, die jeder Schwerkraft trotzt. Das herrlich aufspielende Komiker Duo Clown and a Drummer, die auch zwischen Umbauten der Show wunderbar unterhalten, werden schnell zu Publikumslieblingen. Auch der Ventriloquist Willer Nicolodi sorgt mit seiner Bauchrednerkunst für viele Lacher, während The Flyers Valencia mit ihrem Wheel of Death für Nervenkitzel und atemberaubende Spannung sorgen. Die Helldrivers veranstalten dann zum Finale der FlicFlac Christmasshow im Globe of Speed, einer Weltkugel ähnlicher Vorrichtung, in der letztendlich um die 10 Motorräder spektakulär ihre Runden drehen, einen würdigen Abschluss.
Diese Show ist eine Sensation: eine Symbiose aus Unterhaltung, Spannung und immer wieder auftauchender Gänsehautmomenten, bei denen dem Zuschauer schier den Atem stockt. Visuell bietet die Show zusätzlich ein hervorragendes, punktgenaues Lichtdesign, die die Magie wunderschön einfängt und viel zum Erlebnis beiträgt.
21 Nummern bieten kurzweilige und handwerklich hervorragend gemachte Unterhaltung, die einen beeindruckenden und exzellenten Abend garantieren, der jeder Gravitation trotzt. Und die Weihnachtsstimmung kommt dann garantiert auch noch: spätestens beim zweiten Glühwein auf dem Christkindlesmarkt.
Review: Sugar

Altes Schauspielhaus Stuttgart
rezensierte Vorstellung: 10.12.20022
von Marcel Konrath
Wir befinden uns im Jahr 1972 und Schauplatz ist der berühmte, legendäre Broadway. An diesem 09. April feiert das neueste Musical von Jule Styne Premiere. Styne war zu diesem Zeitpunkt bereits ein etablierter und respektabler Komponist sowie Tony und Oscar Preisträger. Er schrieb die, heute Kultstatus besitzenden, Shows „Funny Girl“ und „Gypsy“. Barbra Streisand verdankt ihm den großen Durchbruch und er arbeitete mit Musical Legende Stephen Sondheim zusammen. 1972 war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr. Besonders tragisch als es während der olympischen Sommerspiele in München zur Geiselnahme israelischer Athleten kam, skandalös als die Watergate Affäre entdeckt wurde und besonders für die musikalische Welt: ABBA nahmen 72 ihre erste Single auf. Es ist das Jahr des Umbruchs und der politisch unruhigen Zeit. Da wirkt ein Broadway Musical mit jazzig angehauchtem Stil wie ein Relikt aus einer anderen Zeit, dass etwas aus dem Raum-Zeit-Kontinuum fällt.
„Sugar“ basiert auf dem legendären Meisterwerk „Some like it hot“ (dt.: „Manche mögens heiß“) von Billy Wilder. Es ist einer dieser Filme, die man immer rund immer wieder sehen kann, weil sie nichts von ihrem Witz, Charme und Esprit verloren haben. Der Witz entsteht vor allem daraus, dass Jack Lemmon und Tony Curtis gar keine andere Wahl haben, sich als Frauen zu kostümieren. Denn es geht hier um Leben und Tod in der Zeit der Prohibition und Al Capone, und nicht um alberne Sperenzien und Kostümierungen. Nie war die Monroe schöner und witziger als in diesem Film. Wilder beweist eine erzählerische wie inszenatorische Genialität und einen Rhythmus, der seinesgleichen gut. Die Szene, in der Jack Lemmon von seinem steinreichen Liebhaber Osgood erzählt, ist unerreicht. In vieler Hinsicht war der Film wegwesend und seiner Zeit weit voraus. Geschlechterrollen werden über den Haufen geworfen, demontiert und neu zusammengesetzt. Der letzte Satz „Nobody is perfect“ ist dabei soviel mehr als eine amüsante Schlussnote. Er beweist, dass es bei Liebe letztendlich egal ist, wen man liebt, denn Liebe ist Liebe, egal ob Mann, Frau, Trans oder non-binär.
So ist es fast ein Wiedersehen mit alten Bekannten im Alten Schauspielhaus Stuttgart als Sugar Kane, Joe aka Josephine und Jerry aka Daphne die Bühne im Musical „Sugar“ versüßen.
Jule Styne bietet in seiner Komposition gewohnt routiniert ein Potpourri aus Jazz, Swing und klassischem Broadwaysound, wenngleich deutlich ärmer an eingängigen Melodien, die sofort ins Ohr gehen. Styne hat mit „People“, „Don’t Rain on My Parade“ (beide aus „Funny Girl“) und „Roses Turn“ aus Gypsy unsterbliche Hymnen geschrieben. Woran liegt es also, dass die Musik bei Sugar nicht so recht zünden mag? Vielleicht ist es die nicht mehr ganz zeitgemäße musikalische Umsetzung, vielleicht war Styne ein wenig aus der Übung, lagen seine Hitshows doch schon einige Jahre hinter ihm. Kein Song geht so richtig ins Ohr außer vielleicht „The Beauty That Drives Men Mad“ (dt.: „Schönheit“)
Und woran liegt es, dass die Inszenierung von Klaus Seifert nicht so recht zünden mag?
Nun zum einen mag es durch die limitierten bühnentechnischen Möglichkeiten begründet sein, zum anderen an dem zu großen Respekt vor dem Original Film, der übermächtig über der Produktion thront. Zu zwanghaft wird hier versucht den Film 1:1 zu reproduzieren. Regisseur Seifert verneint dies zwar in einem Interview im Programmheft, aber nie lässt sich das Wilders Geniestreich verleugnen, allerdings in stark reduzierter personeller Besatzung auf der Stuttgarter Bühne.
Genau hier liegt auch die Quiddität, denn eine so gewaltige Vorlage zu nutzen um daraus etwas Eigenständiges zu kreieren und mit neuem, frischem Leben zu durchdringen ist eine schwierige Herausforderung. So gelangt die Inszenierung auch schnell an ihre Grenzen und hat nicht den langen Atem das Gagfeuerwerk des Films aufzufangen und neu zu modellieren.
Dabei ist die Besetzung gelungen. Maja Sikora ist als Sugar, trotz blonder Marilyn Perücke, keine bloße Kopie der Monroe und singt und tanzt vorzüglich. Samuel Schürmann und Björn Schäffer als ungewolltes Damen Duo harmonieren gesanglich wunderbar miteinander. Schauspielerisch schliddern die beiden etwas zu holprig ins Slapstick Genre und nicht jeder Gag sitzt immer und zu jeder Zeit. Die Verwandlung zur Frau passiert zu plötzlich und abrupt. Teilweise ist der Witz zu forciert gespielt und oft sitzt das Timing nicht. Ralph Morgenstern hat als Osgood merklich Spaß an seiner Rolle und hat die große Ehre den legendären Schlusssatz nonchalant zum Besten zu geben. Abgerundet von einem starken Ensemble bietet Sugar gediegene, aber auch etwas biedere Unterhaltung. Ja, das Musical fällt etwas aus der Zeit, aber Ablenkung ist doch momentan etwas, dass wir alle sehr gut gebrauchen können.
Review: Sherlock Holmes - Next Generation

von Marcel Konrath
Selbst der wahre Sherlock Holmes würde hier vor einem großen Rätsel stehen. (Fast) kein weiterer Romanheld wurde und wird, so häufig in Serien, Filmen, Videospielen, Geschichten und Musicals recycelt.
Warum das Team um Regisseur und Autor Rudi Reschke sich berufen fühlte ein Musical aus dem erstmalig 1886 veröffentlichten Roman von Arthur Conan Doyle zu kreieren, dürfte ein weiteres Geheimnis bleiben.
So viele Rätsel in diesem Musical, die es zu lösen gilt!
Doch scheint die finale Konklusion dazu wirklich lohnend und spannend zu sein?
Wir befinden uns im London des frühen 20. Jahrhunderts. Sherlock Holmes (Ethan Freeman) ist etwas in die Jahre gekommen, aber zusammen mit seinem Partner Watson (Matthias Otte) immer noch auf der Suche nach dem neusten, elektrisierenden Auftrag. Aus einem alten, sehr persönlichen Fall von Holmes entspinnt sich eine Krimi- und Liebesgeschichte, bei der die im Titel erwähnte „Next Generation“ zum Einsatz kommt.
An Spannung wird das Musical durch jede mittelmäßige Inspektor Barnaby Folge eingeholt und ist dabei so britisch wie eine Portion Königsberger Klopse. Wo also ist das „spannungsgeladene Abenteuer, das alle Elemente des klassischen Musicals, der Artistik, Stunts und modernster Bühnentechnik miteinander vereint,“ was die Homepage der Produktion verspricht?
„Der Lack ist ab“ sagt Sherlocks Haushälterin Miss Hudson (schrill: Annette Lubosch) in einer Szene und da möchte man ihr von Herzen zustimmen.
Das Bühnendesign (Rudi Reschke und Dietmar Wolf) arbeitet mit zahlreichen Projektionen, die vereinzelt recht gelungen (ein Wasserfall gleich zu Beginn), teilweise eher dürftig (eine Lavalampe) sind. Dass die Möbel und Requisiten nicht via Magie plötzlich den Weg auf die Bühne finden, leuchtet natürlich ein. Die Art und Weise wie die Darsteller diese teilweise sehr unelegant umherschubsen, lenkt allerdings häufig von der Handlung ab. Im Programmheft der Show wird von einem „rasanten Musical über Liebe, Tod und Leidenschaft“ schwadroniert. Ob es sich nun hier tatsächlich um „Sherlock Holmes- The Next Generation“ handelt, bleibt ein weiteres Mysterium des Abends. Denn dass, was da mit behäbigem Tempo und angezogener Handbremse daherkommt ist bestenfalls ein Schauspiel mit Musik, aber kein Musical. Rund 15 Minuten dauert es bis zur ersten musikalischen Nummer „Ein Fall für Sherlock Holmes“, die durchaus ihre Qualitäten hat. Auch wenn die Reime eher nach reim dich oder ich fress dich Prinzip den Weg auf die Partitur fanden: sei es drum, hier ist der einzige erkennbare Ohrwurm dabei.
Die restlichen Kompositionen und Liedtexte von Christian Heckelsmüller liegen irgendwo zischen Kitsch, Jahrmarkt und Fahrstuhlmusik. Einige davon sind sogar hörenswert, aber auch schnell wieder vergessen. Was sich Heckelsmüller allerdings bei dem psychodelisch angehauchten Albtraum „Opium“ (brutal interpretiert und kastriert von Claudio Maniscalco) gedacht hat, bleibt ein weiteres Rätsel für Sherlock Holmes.
Ethan Freeman hat in seiner langen und erfolgreichen Karriere in der Welt des Musicals viele Glanzleistungen vollbracht. „Jekyll & Hyde“, „Mozart!“, „Evita“ und „Aladdin“ sind dabei nur einige seiner Stationen. Was ihn allerdings zur Zusage in dieser Produktion getrieben hat, bleibt… Sie ahnen es. Auch wenn das Musical seinen Namen trägt, so sind die Auftritte von Sherlock sehr spärlich ausgefallen. Da die Songs einfach zu wenig Substanz bieten, kann Freeman hier sein wahres Potential nicht entfalten und bleibt der schwachen Charakterisierung seiner Rolle geschuldet, eher im Hintergrund.
Matthias Otte hat im Gegenzug als Watson wenig bis gar nichts zu tun und fällt daher weder positiv noch negativ auf.
Die „Next Generation“ Kombi aus Florian Minnerop als John und Alice Wittmer als Catherine singen recht ordentlich, können aber aus Heckelsmüllers Songs auch keine Sondheim oder Lloyd Webber Nummer hexen. Da wo sich unvergänglich auf selbstverständlich und Leben auf Wegen reimt fühlt sich der Komponist und Liedtexter zu Haus.
„Da muss doch mehr sein?“ lautet die berechtigte Frage von John im Stück auf die man ein vehementes „Ja, bitte!“ erwidern möchte. Doch die Antwort lautet hier: nein, wirklich mehr gibt es in dieser schwerfälligen und sterilen Inszenierung von Rudi Reschke nicht zu entdecken. Dies ist weit entfernt vom versprochenen „Bühnenspektakel, was den Zuschauer mitten in das Geschehen zieht.“
So bleibt das Rätsel um Sherlock Holmes ungelöst und wird hiermit zu den Akten gelegt.
Oder wie Brecht es ausgedrückt hätte: „Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen // Den Vorhang zu und alle Fragen offen.“
Review: Das SpongeBob Musical

von Marcel Konrath
Was musste in der Vergangenheit schon alles als Musicalstoff herhalten? Da wurde aus einem Boxer als Protagonisten der seltene Versuch gewagt ein sportives Musical zu kreieren („Rocky“), das berühmte Liebespaar Rhett Butler und Scarlett O’Hara musste sich gleich mehrere Male singend ins brennende Atlanta stürzen („Vom Winde verweht“) und Stephens King Horrornovelle „Carrie“ wurde unter selbigem Namen zu einem der größten Flops der Broadwaygeschichte. Da sollte es nur wenig überraschen, dass ein Schwamm zum Helden eines Musicals wird.
Immerhin auf stolze 327 reguläre Vorstellungen brachte es die Multi Millionen Dollar Produktion am Broadway. Also durchaus kein so schlechtes Ergebnis und für Nickelodeon Grund genug die Show in neuer, abgespeckter Inszenierung und deutscher Sprache, auf eine ausgiebige Deutschland Tour zu schicken.
Die Unterwasserwelt ist in Gefahr! Chaos bricht in Bikini Bottom aus, als ein Vulkan droht, die gesamte Stadt zu vernichten. Doch SpongeBob und seine treuen Freunde sind fest entschlossen, ihre Heimat zu retten.
Aber das ist nicht das einzige Problem, das ihnen bevorsteht: Plankton schmiedet einen bösen Plan, um die Bevölkerung von Bikini Bottom auszutricksen. Um den Vulkanausbruch und Planktons üble Machenschaften aufzuhalten, braucht es einen mutigen Helden, doch niemand in der Stadt scheint der Herausforderung gewachsen.
Als das düstere Schicksal von Bikini Bottom immer näher rückt, wird SpongeBob klar, dass sein Zuhause nur gerettet werden kann, wenn er mit seinen Freunden den feuerspeienden Killerberg besteigt und über sich selbst hinauswächst…
In der Inszenierung von Timo Radünz und dem funktionalem, weil tourneefähigem Bühnenbild von Lukas Pirmin Waßmann tummeln sich die Bewohner von Bikini Bottom unter Michiel Janssens als SpongeBob, der seine Sache großartig macht. Er schafft es mit seiner Tonalität der deutschen Synchronstimme von Santiago Ziesmer sehr nahe zu kommen und kann auch gesanglich überzeugen. Ihm Zur Seite steht Benjamin Eberling als Patrick Star leider etwas blass und blutleer gegenüber. Gesanglich liegen zwischen den beiden Protagonisten Welten und erschwerend kommt es auch zu keinerlei Chemie zwischen den zitierten „treuen Freunden“.
Musikalisch merkt man dem Musical deutlich an, dass viele verschiedene Komponisten am Werk waren. Viele Köche verderben den Brei könnte man hier plakativ anwenden, denn so richtig zünden will kaum eine Nummer. Mehr als über den Status „nett“ gehen die Melodien kaum hinaus. Auch wenn die Stücke die Nähe zu Musicals wie „Wicked“ oder „Cabaret“ suchen, ist das Ergebnis eher mau, unausgegoren und schnell vergessen. John Legend, Cindi Lauper und Sara Bareilles zeichnen unter anderem für die Songs verantwortlich. Die Musik ist zu generiert, zu austauschbar um letztendlich voll überzeugen können. Hier fehlt ein ganzheitliches, stimmiges Konzept. Ein großes Minus ist auch die fehlende Live Band, denn die Musik bei SpongeBob kommt aus der Konverse.
So ist der Abend mit SpongeBob und seinen Freunden erstaunlich anstrengend und nur wenig amüsant. Die Gags fallen dem Thema geschuldet flach und leidlich witzig aus. Auch die Textverständlichkeit bei den Songs und Dialogen ist teilweise schlecht und mal gar nicht vorhanden. Die Show ist der verunglückte Versuch für Kinder wie Erwachsene stimmungsvolle und entspannte Unterhaltung zu erzeugen. Mit rund 2,5 Stunden Laufzeit ist die Show eindeutig zu lang und hätte einige Kürzungen gut vertragen können. Der Auftritt des Piraten, der unwitzig noch vor Beginn der eigentlichen Show auf die Bühne stolpert und vom vermeintlichen Saalpersonal (aka Darsteller der Show) zurückgehalten wird, gibt zwangsläufig den Rhythmus der Show vor, von dem sich die Dynamik nicht so recht erholen kann.
So richtig kann sich das Musical auch nicht entscheiden wer letztendlich der Adressat sein soll: für Kinder ist es zu lang, für Erwachsene nicht witzig genug. So bleibt am Ende ein fader Geschmack der Belanglosigkeit zurück, mit einer Show die gut gemeint daherkommt, letztendlich aber nicht überzeugen kann.
Vielleicht war ein Schwamm als Protagonist eines Musicals doch nicht die beste aller Ideen.
Review: LA CAGE AUX FOLLES

Volksoper Wien,
rezensierte Vorstellung: 05. November 2022
von Marcel Konrath
Triumphierend, stolz und berührend steht sie alleine auf der Bühne: es ist das Finale des ersten Aktes und für einen kurzen Moment gibt Zaza einen Blick in ihre Seele frei. „Ich bin was ich bin“ ist der fulminante Höhepunkt einer tour-de-force Performance von Drew Sarich in Melissa Kings Inszenierung von LA CAGE AUX FOLLES an der Wiener Volksoper.
Doch beginnen wir am Anfang, denn dies ist bekanntlich ein guter Weg zu beginnen. Als LA CAGE AUX FOLLES im Jahre 1983 seine umjubelte Broadway Premiere feierte, brach das Musical in vielerlei Hinsicht Rekorde: stolze 6 Tony Awards gewann die Original Inszenierung von Arthur Laurents, aber vor allem brach sie auch mit Konventionen und Tabus. Da war ein liebevolles homosexuelles Paar zu sehen, dass voller Respekt und mit aller Normalität miteinander umging. Auch wenn das ein oder andere Klischee bedient wurde, plädierte und plädiert das Musical nach wie vor für Toleranz und Akzeptanz. Ein absoluter Meilenstein in der LGBTQ+ Musical Geschichte und ja, auch nach all den Jahren hat das wunderbare Buch von Harvey Fierstein, in der deutschen Übersetzung von Erika Gesell und Christian Severin. nichts von seinem Witz und Charme eingebüßt. Schon nach den ersten Takten der Ouvertüre weiß man als Zuschauer, dass hier ein im besten aller Sinne epochaler Broadwaybombast erklingt. Jerry Herman, der auch für so beliebte Stücke wie „Hello Dolly“ oder „Mame“ verantwortlich zeichnet, liefert mit seiner Komposition ein wahre Flut an Ohrwürmern.
Seit zwanzig Jahren sind Georges und Albin ein Paar. Albin tritt jeden Abend als Travestie-Star Zaza in Georges Club „La Cage Aux Folles“ auf und hat für Georges Sohn Jean-Michel die Mutterrolle übernommen. Jean-Michel will nun ausgerechnet Anne heiraten, die Tochter des Abgeordneten Dindon, der u. a. für die Schließung aller Travestie Clubs an der Riviera plädiert. Um vor seinen zukünftigen Schwiegereltern bestehen zu können, braucht Jean-Michel ein untadeliges Familienleben. Und so wird Albin kurzerhand zu Onkel Al..
Was nun folgt ist eine Flut an Lachsalven und hervorragend gesetzten Pointen, die Dank exzellenter Darsteller gekonnt zünden. Als Georges und Albin sind Thorsten Tinney und Drew Sarich ein wundervolles Paar, die sich perfekt ergänzen. Die Liebe und lange Partnerschaft nimmt man den beiden sofort ab. Drew Sarich kann dabei als Albin aka Zaza alle Register seines Könnens ziehen und überzeugt neben seiner hervorragenden Gesangsstimme auch komödiantisch. Jede Geste, jeder Fingerzeig sitzt hier. Dabei gelingt Sarich das Kunststück seine Figur nie der Lächerlichkeit Preis zu geben oder sie zu expressiv und übertrioeben zu gestalten. Hier steht ein echter Charakter, ein Mensch mit Stärken und Schwächen auf der Bühne. Aber vor allem hat seine Zaza ein großes Herz. Wenn Sarich dann center stage alleine auf der Bühne der Volksoper steht und „Ich bin was ich bin“ singt, gehört das zu einem der intensivsten, eindringlisten und vorzüglichsten Gänsehaut Momenten der jüngsten Musicalgeschichte. Sarich beweist damit einmal mehr, dass er zu den ganz großen Stars der internationalen Musicalszene zählt. Eine bravouröse, unvergessliche Leistung!
Thorsten Tinney hat vielleicht nicht die stärksten Songs des Abends zu singen, kann aber durch seine Eleganz und charmantes Spiel dies locker wieder wettmachen. Als Butler und selbst ernannter Zofe reißt Jurriaan Bles jede Szene an sich und wird vom Publikum dafür verdient gefeiert und kann sogar als Stehlampe (ja richtig: Stehlampe) seinen Charme versprühen. Die Cagelles, die im Nachtclub auftreten sind alle erstklassig besetzt und verzaubern in phantasievoll kreativen Kostümen von Judith Peter.
Oliver Liebl singt als Jean-Michel anrührend, Juliette Khalil, Robert Meyer (mit einem Star Auftritt der besonderen Art im Finale) und die glänzend aufgelegte Sigrid Hauser komplettieren das Ensemble.
Regisseurin und Choreografin Melissa King hält für ihre Interpretation einige Überraschungen parat (Bühnenbild: Stephan Prattes) die manchmal absurd in Form von tanzenden Ruth Bader Ginsburgs, aber immer frisch und charmant daherkommt. In der aktuellen Zeit mal komplett abzuschalten und sich mit LA CAGE AUX FOLLES davonzuträumen gelingt King hervorragend. Die Show fühlt sich wie eine lange wohltuende Umarmung an oder ein Besuch von lieben Freunden, die man gerne wieder einladen möchte. Am Ende ertönt „Die beste Zeit ist jetzt“ und ja, trotz vielen Attributen die womöglich dagegensprechen, sollten wir den Moment und das Leben feiern im Käfig voller Narren.
Review: PUTTING IT TOGETHER

Theater Regensburg, Premiere: 15. Oktober 2022
von Marcel Konrath
Ein spektakuläres Bühnenbild mit bewegenden Elementen, ein 25-köpfiges Ensemble und eine fein ausgearbeitete Storyline wird dem Zuschauer bei PUTTING IT TOGETHER nicht geboten – und das macht gar nichts aus. Der eigentliche Star ist hier eindeutig Stephen Sondheim, der wichtigste amerikanische Komponist seit Gershwin, dem dieser Abend gewidmet ist.
Satte 30 Songs bieten einen Querschnitt aus Sondheims Schaffen und werden nun am Theater Regensburg in der Inszenierung von Intendant und Operndirektor Sebastian Ritschel gezeigt. Dass das Theater Regensburg nicht auf Nummer sichergeht und eine Eliza Dolittle oder Eva Peron ins Rennen schickt, ist mehr als ein Applaus wert. Es gehört schon einiges an Chutzpe dazu eine Revue als deutschsprachige Erstaufführung auf den Spielplan zu setzen, von der die meisten Songs dem Groh des Publikums nur mild bis gar nicht bekannt sind. Und doch gibt es sicher nach dem Premierenabend einige, die als neue Sondheims Fans nach Hause gehen. Es wäre ihnen auf jeden Fall zu wünschen. Dass Sondheim an diesem Abend im wunderschönen Theater Regensburg so hervorragend funktioniert, ist vor allem der kongenialen deutschen Übersetzung von Christian Alexander Müller zu verdanken. Mühelos und fast immer eloquent und flüssig fügen sich die deutschen Worte in die Songs ein. So wird aus „Do I Hear a Waltz?“ „Ist das unser Tanz?“, aus „Marry Me A Little“ „Leb an meiner Seite“ und aus „Being Alive“ wird „Heute und hier“.
Die Geschichte, wenn man sie denn so nennen mag, ist zweckmäßig und dient letztendlich nur, den Songs von Sondheim genügend Platz und Raum zu schaffen (Konzept: Stephen Sondheim & Julia McKenzie). Eine Party, zwei Paare (ein jüngeres, ein älteres) und eine Art Conférencier und Erzähler begleiten das Publikum durch den Abend.
Die Inszenierung von Sebastian Ritschel, der auch für das Lichtdesign und die Ausstattung verantwortlich zeichnet, orientiert sich dabei mehr oder weniger stilistisch an der Broadway Produktion von 1999. Eine große Treppe gibt am Ende den Blick auf 5 Großbuchstaben frei: PARTY, die, je nach Song in unterschiedlichen Farben leuchten. Die Drehbühne gibt dann zwischenzeitlich den Blick auf das achtköpfige Orchester, hervorragend von Alistair Lilley dirigiert, frei. Ansonsten ist die Ausstattung sehr dezent und zweckdienlich für diese musikalische Revue.
Die Songs die, „zusammen gefügt“ wurden prallen dabei in herrlichen Gegensätzen aufeinander und offenbaren den gewitzten, intellektuellen und espritvollen Stil Sondheims. U.a. „Sweeney Todd“, „A Little Night Music“, „Merrily We Roll Along“ (welches im Übrigen dringend mal wieder mehr auf deutschen Bühnen gespielt werden sollte) und „Company“ treffen dabei aufeinander.
Das Ensemble besteht aus Franziska Becker, Bruno Grassini, Fabiana Locke, Alejandro Nicolás Firlei Fernández und Felix Rabas in seinem professionellem Rollen Debüt. Hier gibt es viel Licht, aber auch einiges an Schatten, denn nicht immer können die Darsteller zu 100 Prozent überzeugen.
Franziska Becker hat nicht nur einige der besten Nummern, sie ist auch gesanglich wie schauspielerisch eine echte Offenbarung. Ihre „Damen von Welt“ („The Ladies who Lunch“ aus „Company“) wird dabei zum Showstopper des Abends und zurecht mit frenetischem Applaus belohnt. Auch hier noch einmal Kudos an Christian Alexander Müller und seine deutsche Übersetzung., Hier sitzt wirklich jedes Wort und Becker füllt dieses mit viel Seele und Leben. Dies ist eine Sternstunde der Musicalinterpretation und eine Masterclass in „wie erzähle und interpretiere ich einen Musicalsong richtig“. Eine brillante Arbeit, die sich über den gesamten Abend erstreckt. „Heiraten werde ich heut nicht“ („Not Getting Married Today“) ist eine weitere Nummer, in der Becker besonders ihr komödiantisches Talent zeigen kann. Die Worte in ihrem Song sprudeln nur so aus ihr heraus und können trotz schwindelerregender Schnelligkeit durch Präzision und Textverständlichkeit punkten.
Die Textverständlichkeit bei Bruno Grassini ist im Gegenzug leider nicht immer gegeben und macht es, besonders zu Beginn der Revue, sehr schwer ihm textlich wie inhaltlich zu folgen. Zudem hat er auch leider keine 11 o’clock number, in dem er so richtig seine Qualitäten zeigen könnte. Damit bleibt er ziemlich abgeschlagen neben seiner Bühnenpartnerin Franziska Becker zurück und ist während des Abends nicht präsent genug.
Selbiges gilt für Alejandro Nicolás Firlei Fernández, der zwar durch sein Steppen etwas punkten kann, recht sauber und verständlich singt, aber die Emotionen vermissen lässt. Sondheim ist eben kein herunter gesungener Popsong. Hier fehlt einfach der gewisse Drive und den Wunsch eine Geschichte erzählen zu wollen. Besonders enttäuschend wird dann das Duett „All deine Liebe“ („Unworthy of Your Love“) aus „Assassins“ das sich hier eher wie ein Schlager anhört.
Fabiana Locke kann da schon wesentlich mehr Überzeugungsarbeit leisten. Gesanglich wie tänzerisch macht sie ihre Sache sehr gut und hat mit „Lieblich“ (,,Lovely“ aus „ A Funny Thing Happened on the Way to the Forum“) „Heut‘ oder Morgen“ („Sooner or Later“) und „Mehr“ („More“) (beide aus dem Film „Dick Tracy“) tolle Momente ihr Können zu zeigen.
Felix Rabas hat als Conférencier die Aufgabe die musikalische Revue zu eröffnen und liefert hier in seinem Debüt eine solide Arbeit, wobei seine Stärke mehr im Tanz, als im Gesang zu entdecken ist.
„Sich mit einem Sondheim Stück zu beschäftigen, ist immer wie ein Geschenk! Alles ist durchdacht und konsequent.“ sagt Regisseur Sebastian Ritschel. “Ein Komponist wie Stephen Sondheim hatte es viele Jahre schwer auf den Spielplänen deutschsprachiger Theater.“ Umso erfreulicher ist die Wahl des Theater Regensburgs sich für diese sehr lohnende und ungewöhnliche Revue entschieden zu haben. Hoffentlich folgen noch viele deutschsprachige Theater diesem Vorbild, denn wer braucht schon ein spektakuläres Bühnenbild, wenn er im Gegenzug Sondheim haben kann?
