Review: DRACULA
Tournee von ShowSlot

von Marcel Eckerlein-Konrath
Der Untote kehrt zurück – doch in Frank Wildhorns DRACULA, das 2026 in der ShowSlot-Tournee durch Deutschland und Österreich tourt, wird aus Bram Stokers Mythos ein Musical, das wenig frische Inspiration ausstrahlt. Was bereits bei der Broadway-Premiere 2004 nach nur 154 Vorstellungen krachend scheiterte, wird in dieser Produktion unter der Regie von Alex Balga nicht etwa neu interpretiert, sondern lediglich müde reproduziert.
Die zentrale Problematik liegt in der unkritischen Reflexion viktorianischer Geschlechterrollen und der Romantisierung toxischer Machtdynamiken. Das Musical behandelt ein Thema, was im Jahr 2026 geradezu verstörend wirkt: Eine Frau, Mina Murray, unterwirft sich einem übergriffigen, manipulativen Unsterblichen, und diese Unterwerfung wird als „wahre Liebe“ verklärt. Die Beziehung zwischen Mina und Dracula zeigt alle Merkmale einer missbräuchlichen Beziehung: psychische Übergriffigkeit durch telepathisches Eindringen in Minas Gedankenwelt, extremes Machtungleichgewicht durch Draculas übernatürliche Fähigkeiten, Gaslighting und Manipulation zur Entfremdung von ihrem Verlobten Jonathan, und schließlich die perfide Umkehrung von Täter und Opfer, wenn Dracula von Mina verlangt, ihn zu töten – als vermeintlicher Liebesbeweis. Diese Dynamik wird musikalisch verklärt, vor allem im wiederholten Lass mich dich nicht lieben, einer Ballade, die Minas inneren Konflikt thematisiert, ihre Kapitulation aber letztlich als romantische Erfüllung inszeniert.
Während Bram Stokers Originalroman von 1897 durchaus als kritischer Kommentar zur viktorianischen Gesellschaft gelesen werden kann und mit Mina eine für ihre Zeit bemerkenswert selbständige und intelligente Frau präsentiert, die maßgeblich zur Jagd auf Dracula beiträgt, degradiert Wildhorn sie zur passiven Liebenden, deren Hauptfunktion darin besteht, zwischen zwei Männern hin- und hergerissen zu sein. Die Lucy-Figur erleidet ein noch schlimmeres Schicksal: Sie wird zur Strafe für ihre Lebensfreude und ihren Liebeswunsch (Wie wählt man aus?) vampirisiert und vernichtet. Man wünscht sich eine Inszenierung, die diese Aspekte kritischer reflektiert oder zumindest bewusst bricht, statt sie unhinterfragt als romantische Erzählung zu präsentieren. Jonathan Harker wurde von einer bei Stoker durchaus vielschichtigen Figur zu einem farblosen Verlobten reduziert, dessen einzige Funktion darin besteht, als Kontrast zu Draculas dunkler Verführungskraft zu dienen. Philipp Dietrich kämpft nicht gegen eine schwache Darstellung, sondern gegen eine fundamental eindimensionale Rolle, die so flach geschrieben ist, dass selbst ein begabter Darsteller hier gnadenlos scheitern muss.
Musikalisch bewegt sich Wildhorn in vertrautem Terrain. Seine Begabung für große, emotionale Balladen ist unbestritten, und gerade die für Frauenstimmen geschriebenen Nummern gehören zu den Höhepunkten des Abends. Allerdings sind die musikalischen Ähnlichkeiten zu seinen früheren Werken frappierend: Nosferatu und His Work and Nothing More aus JEKYLL & HYDE weisen nahezu identische Strukturen auf, das Wort moment fällt sogar an exakt derselben Stelle. Ein perfektes Leben zeigt in der Balladen-Struktur und Melodieführung eindeutige Parallelen zu When I Look at You aus THE SCARLET PIMPERNEL und Lass mich dich nicht lieben folgt demselben dramatischen Aufbau wie Someone Like You aus JEKYLL & HYDE. Das Lied vom Meister bedient sich der martialischen Rhythmen und Chorpassagen aus By the Sword aus THE CIVIL WAR. Die Wildhorn-Formel ist einfach: große Balladen für die Frauen, rockige Uptempo-Nummern für dramatische Momente.
Es ist kein Zufall, dass die stärksten Momente die Frauenballaden sind – Wildhorn komponierte jahrelang primär für seine damalige Ehefrau Linda Eder. Diese Songs sind vocal showcases, die stimmliche Kraft verlangen, aber dramaturgisch oft die Handlung zum Stillstand bringen. Navina Heyne als Mina bewältigt diese Herausforderung stimmlich hervorragend – ihre Interpretation ist sicher und emotional überzeugend, besonders in Lass mich dich nicht lieben, dem stimmlichen Highlight des Abends. Doch auch die beste Interpretation kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Songs mehr über Wildhorns persönliche musikalische Vorlieben als über die Figur Mina aussagen.

Die Inszenierung von Alex Balga steht vor den typischen Herausforderungen einer Tourneeproduktion: Was stationäre Produktionen mit aufwändiger Technik und versteckten Mechaniken bewerkstelligen, muss hier mit einfacheren Mitteln gelöst werden. Die schwarz gekleideten „Bühnengeister“, die Kulissen verschieben, sind eine pragmatische Lösung, rauben aber zweifellos etwas von der Theatermagie. Man hätte sich gewünscht, dass die Regie diese Einschränkung kreativer nutzt. Stattdessen wirkt die Inszenierung stellenweise sehr konventionell.
Balga schickt sein Ensemble auf eine Choreografie aus Treppen, als habe er sich bei M. C. Escher bedient: Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg, Stillstand. Man möchte ihnen fast Wegezoll zahlen und sie gleichzeitig bitten, endlich den direkten Weg auf die andere Seite der Bühne zu nehmen. Die Choreographie von Natalie Holtom scheint darauf ausgelegt, möglichst viel Bühnenfläche zu nutzen, ohne dabei dramaturgischen Sinn zu ergeben. Bedeutungsschwangere Blicke zwischen Dracula und Mina, die das Publikum elektrisieren sollten, laufen ins Leere, weil die Regie keine echte Spannung aufbaut. Die Chemie zwischen den Figuren muss behauptet werden, sie wird nicht erlebbar. Die sichtbaren Kulissenwechsel zerstören systematisch die Illusion: das ist keine Brechtsche Verfremdung, sondern schlicht eine Notlösung, die zur Ästhetik erklärt wird.

Sam Madwars Bühnenbild ist durchaus ansehnlich, mit viktorianischen Elementen und gotischen Bögen, doch all diese visuellen Elemente bleiben oberflächlich. Es fehlt die Konsequenz und Radikalität, die ein Mythos wie Dracula braucht. Das Lichtdesign von Michael Grundner wirkt willkürlich; entscheidende Momente gehen in diffuser Beleuchtung unter, während unwichtige Szenen überbeleuchtet werden. Dennis Heises Sounddesign ist das akustische Äquivalent dazu: undifferenziert und dumpf. Die achtkopfige Live-Band klingt wie durch Watte gefiltert, Feinheiten in der Orchestrierung gehen verloren, die Balance zwischen Gesang und Instrumenten stimmt nicht – gerade bei einem Komponisten wie Wildhorn, dessen Stärke in melodiösen Balladen liegt, ist das fatal.
Thomas Schreier als Graf Dracula trägt die toxische Last der Titelrolle und muss einen Charakter verkörpern, der gleichzeitig monströs und verführerisch, uralt und zeitlos sein soll, aber irgendwie erschreckend langweilig und einfältig wirkt. Er gibt stimmlich sein Bestes, doch auch er kann die fundamentalen Probleme des Materials nicht überwinden. Navina Heyne liefert die stimmlich überzeugendste Leistung des Abends, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Mina als Figur problematisch konzipiert ist. Philipp Dietrich ist nicht farblos, aber die Rolle des Jonathan ist es und dazu so eindimensional geschrieben, dass selbst ein versierter Darsteller wie er hier kaum Gestaltungsspielraum hat. Munja Viktoria Meier ist solide als Lucy, kann die Reduktion ihrer Figur zum moralischen Warnsignal aber nicht überwinden. Blass bleibt Marius Bingel als Professor Van Helsing. Besonders irritierend ist eine Szene, in der Van Helsing sich selbst einen Schuss zu setzen scheint – möglicherweise, um Dracula mit Blut anzulocken. Ebenso gut könnte es sich jedoch um eine schlicht unklar inszenierte Handlung handeln. Genau darin liegt das Problem: Die Szene wirkt weniger rätselhaft als vielmehr symptomatisch für eine Produktion, die Mühe hat, ihre eigene Dramaturgie verständlich zu vermitteln. Matthias Trattner überzeugt als Renfield, eine der wenigen Figuren mit stimmigem Spannungspotenzial, während Nico Went als Dr. Seward wenig zu tun hat, symptomatisch für Wildhorns Libretto, in dem männliche Nebenfiguren funktional, nicht charakterisiert sind.
Frank Wildhorns DRACULA in der ShowSlot-Tournee scheitert gleich mehrfach: Die Musik pendelt zwischen Balladenglanz und Reprisen-Überfluss, inhaltlich reproduziert das Stück unkritisch problematische Geschlechterbilder und romantisiert toxische Beziehungen. Wildhorn kopiert sich musikalisch selbst, Alex Balgas Regie bleibt ästhetisch einfallslos. Der Vampir ist zurück, doch sein Biss hat über die Jahre deutlich an Schärfe verloren und am Ende des Abends fällt der Deckel der Gruft ohne Nachhall, wie ein Echo aus vergangenen Tagen.

Review: ROMEO UND JULIA
Theater des Westens Berlin

von Marcel Eckerlein-Konrath
Im ehrwürdigen Theater des Westens ereignet sich derzeit mit der Wiederaufnahme von ROMEO UND JULIA etwas Bemerkenswertes: Die alte Schlegel-Übersetzung Shakespeares verschmilzt mit den kraftvollen Songs von Ulf Leo Sommer und Peter Plate zu einem Musical, das nicht nur die Generationen überbrückt, sondern auch die vermeintliche Kluft zwischen Hochkultur und Popkultur mühelos überspringt. Was hier auf die Bühne kommt, ist keine bloße Neuverpackung eines Klassikers, sondern eine symbiotische Neuschöpfung, die der unsterblichen Tragödie ihre Seele lässt und ihr zugleich ein pulsierendes Herz für die Gegenwart einsetzt.
Die Regie von Christoph Drewitz versteht es meisterhaft Momente von zärtlicher Intimität zu schaffen, ohne je ins Kitschige abzugleiten. Die Choreografie von Jonathan Huor (Deutscher-Musical-Theater Preis) – und hier muss man ohne Übertreibung sagen: eine der besten, die gegenwärtig auf deutschen Musicalbühnen zu sehen ist – verleiht der Inszenierung eine physische Dringlichkeit, die Shakespeares Text kongenial entspricht. Bewegung wird hier zur Sprache, Tanz zum Ausdruck dessen, was Worte nicht mehr fassen können. Das Lichtdesign von Tim Deiling ist intelligent gesetzt, schafft Räume der Innigkeit ebenso wie Momente apokalyptischer Bedrohung. In diesem visuellen Konzept offenbart sich das kluge Gesamtkonzept einer Inszenierung, die jeden Aspekt ihres Handwerks in den Dienst der Geschichte stellt.
Die musikalische Dramaturgie wurde behutsam nachjustiert. Mercutios ursprünglicher Song Kopf sei still wurde durch Die Liebe kennt mich nicht ersetzt – eine Entscheidung, über deren Notwendigkeit man durchaus diskutieren kann. Der Austausch verändert die Kontur der Figur subtil, ohne dass zwingend klar wird, ob das Stück dadurch gewonnen hat.
Umso überzeugender die Ergänzung von Wie weit ist vorbei. Dieser Song tut dem Stück unbedingt gut, gibt er doch der männlichen Hauptfigur endlich mehr musikalische Präsenz im zweiten Akt. Shakespeares Romeo ist durchaus eine Figur, die sich in Selbstbespiegelung und sprachlicher Überhöhung ergeht: hier bekommt diese Tendenz zur Dramatisierung des eigenen Schicksals einen adäquaten musikalischen Ausdruck. Clever auch der Einstieg mit Rosalinde, in dem Romeo wie ein Rockstar inszeniert wird: Mikrofon von oben, Auftritt im gleißenden Spotlight. Diese Einführung der Figur trifft den Kern von Shakespeares Figur. Romeo ist zu Beginn tatsächlich ein selbstverliebter junger Mann, der sich in der Pose des Liebenden gefällt, lange bevor er wirklich liebt. Die Rockstar-Ästhetik übersetzt diese narzisstische Selbstinszenierung brillant in unsere Gegenwart.

Und dann diese Besetzung! Hier offenbart sich eine Wahrheit, die im Theaterbetrieb viel zu selten ausgesprochen wird: Die Cover-Darsteller, jene oft im Schatten stehenden Künstler, die bereitstehen, wenn die Erstbesetzung ausfällt, sind keine Ersatzlösung, sondern die eigentlichen Garanten für künstlerische Exzellenz. Sie sind es, die durch ihre konstante Bereitschaft, ihre unermüdliche Arbeit ohne den Glanz der Premierenkritiken, das Theater am Leben halten. Sie sind das Immun-system des Musicalbetriebs, ohne das keine Produktion überleben könnte. Diese Darsteller beweisen, dass echte Theaterkunst nicht in Hierarchien denkt, sondern in Hingabe, Präzision und der Fähigkeit, jeden Abend aufs Neue alles zu geben. An diesem Abend gibt es einige Cover, die das hervorragende Ensemble kongenial und würdig unterstützen.
Laura Schatz verkörpert Julia mit einer Interpretation, die zwischen Schmerz und Hoffnung changiert, ohne je den Halt zu verlieren. Besonders in Ich gebe dich nicht auf entfaltet sie eine unglaubliche Intensität: kompromisslos, mit sicherer Stimmführung, die technische Brillanz und emotionale Wahrhaftigkeit zu einer Einheit verschmelzen lässt. Hier singt eine Schauspielerin, die sich mit aller Kraft gegen das Schicksal stemmt – und die Aussichtslosigkeit dieses Unterfangens in jeder Phrase mitschwingt. Shakespeares Julia ist bei näherem Hinsehen eine erschreckend junge Figur – nicht einmal vierzehn Jahre alt im Originaltext. Sie ist ein Kind, das über Nacht zur Frau werden muss, das in wenigen Tagen die gesamte Spannbreite menschlicher Erfahrung durchlebt: erste Liebe, sexuelles Erwachen, Rebellion gegen die Eltern, Verzweiflung, Tod. Was Shakespeare in dieser Figur einfängt, ist die furchtbare Intensität der Jugend, die keine Grautöne kennt, nur Absolutes. Laura Schatz schafft es grandios diese klassische Figur mit viel Leben und Stimme zu füllen.
Alexander Hartmann gibt einen Romeo von bestechender Viel-schichtigkeit: intelligent, zerrissen, nie eindimensional. Seine Darstellung vermeidet jede romantische Verklärung und zeigt stattdessen einen jungen Mann im Konflikt zwischen Passion und Vernunft. Shakespeares Romeo ist keineswegs nur der schwärmerische Liebhaber: er ist auch sprunghaft, impulsiv, ein Mörder. Er schwärmt für Rosalinde, bis er Julia erblickt. Er tötet Tybalt im Affekt und zerstört damit jede Hoffnung auf ein gemeinsames Leben. Hartmann zeigt diese Brüche, ohne die Figur unsympathisch zu machen. Sein Romeo ist ein Mensch in seiner ganzen widersprüchlichen Unvollkommenheit.
Maike Katrin Merkel setzt als Amme ihre ganz eigene Marke: witzig, charmant und gesegnet mit einer Stimme, die jeden Raum füllt. Sie ist komische Entlastung und emotionaler Anker zugleich – genau wie bei Shakespeare, wo die Amme die einzige Vertraute Julias ist, ihre Ersatzmutter, ehe sie sie am Ende verrät.
Besonders berührt Tim Tauchers Mercutio: intensiv in seiner Darstellung eines Mannes, der hin- und hergerissen ist zwischen seiner Liebe zu Romeo und den eigenen, ungelebten Gefühlen. Hier gewinnt die Figur eine psychologische Tiefe, die über Shakespeares Text hinausweist.
Ebenso stark ist Alexander Auler als Pater Lorenzo. Er fungiert als Erzähler und singt die schmerzhafte Wahrheit: Kein Wort tut so weh wie vorbei. In dieser Doppelfunktion wird er zur Brückenfigur zwischen den Ebenen, zum Chronisten einer Katastrophe, die er mitverantwortet.
Beeindruckend in seiner ätherischen Fremdheit der Countertenor-Part von Joël Zupan als Todesengel, der die Figuren wie Marionetten an (un)sichtbaren Fäden durch ihr Schicksal führt. Diese allegorische Überhöhung verleiht dem Geschehen eine metaphysische Dimension, die an mittelalterliche Mysterienspiele erinnert und zugleich sehr modern wirkt.

Samuel Franco als Tybalt, Dominik Räk als Benvolio, Katrin Merkl und Fredy Kuttipurathu als das Capulet-Paar – sie alle fügen sich zu einem Ensemble, dessen Stärke in der kollektiven Energie liegt. Das gesamte Ensemble, ergänzt durch Mirjam Wershofen, Mareike Heyen, Alessia Trombetta, Michaela Giada Ventura, Rike Wischhöfer, Riccardo Pastore und Wolfram Föppl, trägt zu einem Abend bei, der zeigt, was Musical sein kann, wenn alle Zahnräder ineinandergreifen.
Unter der musikalischen Leitung von Shay Cohen entfalten die Songs von Sommer und Plate ihre volle Wirkung: bühnenwirksam und emotional präzise. Doch es ist das Ende, das diesen Abend unvergesslich macht. Die Zeilen, die das Publikum in die Gegenwart katapultieren, schmerzen in ihrer Wahrhaftigkeit: Der Krieg ist aus / Die Waffen ruh’n / Doch aus der Ferne klingt ihr Lied / Wann hör’n wir auf / Uns weh zu tun / Denn nach dem Krieg ist vor dem Krieg / Und irgendwann singt die Welt ihr letztes Lied. In einer Zeit, in der Krieg wieder nach Europa zurückgekehrt ist, in der alte Feindbilder neu belebt werden und die Spirale der Gewalt sich unaufhaltsam weiterdreht, gewinnen diese Worte eine Dringlichkeit, die über jede theatrale Wirkung hinausgeht.
Shakespeare schrieb über die Fehde zweier Familien in Verona; wir erleben die globale Dimension dieser ewig wiederkehrenden Selbstzerstörung. Der finale Kunstgriff der Inszenierung ist von radikaler Klugheit: Die Darsteller legen ihre Kostüme ab, stehen in ihrer Alltagskleidung vor uns, durchbrechen die vierte Wand und konfrontieren das Publikum direkt. Plötzlich sind sie nicht mehr Capulets und Montagues, sondern Menschen unserer Zeit, die uns die Frage stellen: Wann hören wir auf? Dieser Moment der Entblößung, der Verwandlung von Figur zurück zu Mensch, ist von erschütternder Kraft. Er macht klar, dass diese Geschichte nicht im Gestern verharrt, sondern im Hier und Jetzt ihre eigentliche Sprengkraft entfaltet.
Im Theater des Westens wird Shakespeare zum Pop-Phänomen gemacht – zugänglicher und aktueller denn je, ohne dass ihm die Seele geraubt würde. Was könnte es Besseres geben, um neue Generationen für das Theater zu begeistern, als ihnen zu zeigen, dass die großen Fragen der Menschheit zeitlos sind und dass ihre Beantwortung heute dringlicher ist als je zuvor Dies ist Musical als gesellschaftlicher Diskurs, als Spiegel unserer Zeit, als Warnung und Hoffnung zugleich. Ein Theaterabend, der nachhallt.

Review: DIE AMME
Theater des Westens Berlin

von Marcel Eckerlein-Konrath
Schon der Titel verrät die Perspektivverschiebung: Die Amme ist kein weiteres Romeo-und-Julia-Remake, sondern eine kluge, emotionale und zugleich höchst unterhaltsame Neuvermessung der berühmtesten Liebestragödie der Weltliteratur – erzählt aus dem Blickwinkel jener Frau, die bei Shakespeare oft als komische Nebenfigur erscheint, in Wahrheit aber das emotionale Rückgrat der Geschichte bildet. Steffi Irmen haucht ihrer Protagonistin neues Leben ein und macht die Amme aus Shakespeares Romeo und Julia zur strahlenden Heldin ihres eigenen Abends. Peter Plate und Ulf Leo Sommer, das erfolgreiche Komponistenduo hinter Rosenstolz und zahlreichen Hits für Sarah Connor, haben mit Die Amme ein Musical geschaffen, das weit mehr ist als eine bloße Neuerzählung: es ist eine feministische Neuinterpretation, eine liebevolle Hommage und mitreißendes Pop-Konzert zugleich.
Um die Bedeutung dieses Abends zu erfassen, muss man zunächst die Ursprungsfigur verstehen. In Shakespeares Romeo and Juliet ist die Amme weit mehr als bloßes Dienstpersonal. Sie ist Julias Vertraute, Kupplerin, Mentorin und Mutterersatz: eine Figur von erstaunlicher Vielschichtigkeit. Shakespeare zeichnet sie als warmherzige, geschwätzige, oft derb-komische Frau, die Julia bedingungslos liebt, nachdem sie ihr eigenes Kind verloren hat. Sie ist die Stimme der Erdverbundenheit in einer Tragödie voller hochfliegender Leidenschaft, die Vermittlerin zwischen den Welten, die Komplizin der verbotenen Liebe.
Doch bei aller Bedeutung für die Handlung bleibt sie bei Shakespeare letztlich eine dienende Figur ohne eigene Geschichte. Genau hier setzt Die Amme – Das Musical an: Es gibt dieser Frau, die immer nur für andere da war, endlich eine eigene Stimme, eine eigene Vergangenheit, ein eigenes Recht auf Sichtbarkeit.
Die Inszenierung von Franziska Kuropka und Lukas Nimscheck nutzt die gleiche Bühne wie das Musical Romeo und Julia – Liebe ist alles, flankiert von fünf exzellenten Musikern, die den Abend mit kraftvoller Live-Musik tragen. Doch während dort das große Ensemble die Bühne füllt, steht hier eine einzelne Frau im Zentrum – und das genügt vollkommen.

Steffi Irmen, bereits als Amme in Romeo und Julia zum Publikumsliebling avanciert, entfaltet in dieser One-Woman-Show ihr gesamtes künstlerisches Potential. Sie jongliert virtuos zwischen Slapstick-Comedy und tief berührendem Drama, zwischen selbstironischer Distanz und erschütternder Verletzlichkeit. Die Stimmung im Saal ist außergewöhnlich: Es herrscht eine Atmosphäre, die man eher von Popkonzerten kennt: das Publikum klatscht, singt enthusiastisch mit, eine Flut an Zuneigung ergießt sich über die Künstlerin. Diese Amme wird nicht nur respektiert, sie wird geliebt!
Musikalisch ist der Abend ein buntes Kaleidoskop aus bekannten Rosenstolz-Hits und Songs, die Plate und Sommer für Sarah Connor schrieben. Die Setlist liest sich wie ein Best-of deutscher Popgeschichte, neu kontextualisiert durch die Perspektive der Amme:
Guten Tag liebes Glück eröffnet den Reigen beschwingt Rabenschwarze Nacht – ein besonders starker, intensiver Moment – führt in die dunkelsten Ecken der Seele. Ich halte meinen Mund offenbart die Zerrissenheit einer Frau, die ihr Leben lang funktionieren musste. Mit Hallo Julia und Ich bin ich wird die komplexe Beziehung zwischen Amme und Ziehtochter greifbar.
Vincent und Ich will nur sie vertiefen die emotionale Bandbreite, bevor mit Hormone und Jung sein – zwei Hits aus dem Romeo-Musical – die Sehnsucht nach verlorener Jugend aufbricht. Irmen zelebriert diese Songs mit einer Intensität, die das Publikum mitnimmt. Wie schön du bist ist die umjubelte Zugabe während Mädchen auf dem Pferd witzige und Lass sie reden selbstbewusste Akzente setzen.
Was Steffi Irmen auf dieser Bühne leistet, ist bemerkenswert. Sie ist jederzeit präsent, stimmstark über den gesamten Abend, physisch wie emotional vollkommen engagiert. Ihr Spiel changiert mühelos zwischen überdrehter Komik und stiller Verzweiflung, ihre Stimme trägt sowohl die großen Belting-Nummern als auch die leisen, fragilen Momente. Sie lässt das Publikum lachen, mitsingen, mitfiebern.
Die Inszenierung nutzt geschickt die Möglichkeiten des Formats: Als One-Woman-Show kann sie intimer, direkter, persönlicher sein als jedes Ensemble-Musical. Die Amme erzählt ihre Version der Geschichte, kommentiert, zweifelt, klagt an – und das Publikum ist nicht nur Zeuge, sondern wird zum Vertrauten, zum Komplizen.

Bei aller Begeisterung stellt sich die Frage, ob das Theater des Westens, so prachtvoll es ist, der ideale Rahmen für diese intime Geschichte ist. Ein Crowdpleaser dieser Art würde auf einer kleineren Bühne, in einem intimeren Setting, vermutlich noch intensiver wirken. Die große Opulenz des Hauses schluckt manchmal die feinen Zwischentöne, die gerade in den leiseren Momenten wichtig wären.
Die Inszenierung bewegt sich nicht immer eindeutig auf einer Linie. Mal fühlt sich der Abend wie ein poppiges Konzert mit Showcharakter an, mal wie ein konzentriertes, erzählerisch dichtes Monodrama. Dieser ständige Wechsel zwischen Revue und innerem Bekenntnis, zwischen Entertainment und existenzieller Selbstbefragung ist durchaus reizvoll, wirkt aber nicht durchgehend ausbalanciert. An manchen Stellen wünscht man sich eine klarere Entscheidung: entweder die volle Wucht des großen musikalischen Spektakels – oder den radikalen Rückzug in die leise, intime Seelenbeichte.
Dennoch: Die Amme ist ein sehr unterhaltsamer und lohender Abend. Er gibt einer Frau eine Stimme, die jahrhundertelang nur dazu da war, anderen zu dienen. Er erzählt von Verlust, von unerfüllten Träumen, von der Lebens- und Leidensgeschichte einer Frau, die ihre eigenen Bedürfnisse hinter die anderer stellte – und die am Ende doch nicht verhindern konnte, dass die Geschichte tragisch endet.
Steffi Irmen macht aus dieser Figur keine Heldin im klassischen Sinne, sondern etwas viel Wertvolleres: einen Menschen. Einen Menschen mit Fehlern, mit Schmerz, mit Sehnsucht; und mit einer unbändigen Lebenskraft, die sich selbst durch die dunkelsten Momente nicht brechen lässt.
Die Amme beinhaltet ein zeitgemäßes Statement: Jede Geschichte verdient es, erzählt zu werden. Jede Frau verdient es, gesehen zu werden. Und manchmal sind die interessantesten Protagonisten nicht die jungen Liebenden, sondern die, die im Schatten stehen und alles am Laufen halten.
Die Liebe des Publikums, die Steffi Irmen an diesem Abend entgegengebracht wird, ist der beste Beweis dafür, dass diese Botschaft ankommt. Die Amme hat ihre Bühne gefunden – und sie wird sie so schnell nicht wieder hergeben.

Review: DIE CHER SHOW
Tournee von ShowSlot

von Marcel Eckerlein-Konrath
Wer sich als Besucher für den unwahrscheinlichen Fall fragt, in welcher Show er sich gerade befindet, dem hilft das Bühnenbild auf die Sprünge: CHER. Überall CHER. Der Name prangt in monumentalen Lettern auf LED-Wänden, wölbt sich tunnelförmig in die Tiefe. Ein zentrales Rahmenelement aus weißem Licht fasst die Bühne wie ein gigantisches Proszenium: ein Portal in die Welt der Ikone. Ach ja, es geht übrigens um Cheryl Sarkisian, besser bekannt als C-H-E-R.
Dieses biografische Jukebox-Musical in der Regie von Christopher Tölle über (richtig geraten!) Cher hat in erster Instanz ein strukturelles Problem, das sich nicht weginszenieren lässt: Wie erzählt man ein Leben, das sich über sechs Jahrzehnte erstreckt, ohne in eine bloße Anekdotensammlung zu verfallen?
Die dramaturgische Kernidee von Rick Elice, Autor von Jersey Boys : Chers Lebensgeschichte wird durch drei Alteregos erzählt. Babe verkörpert die junge, unbedarfte Phase, Lady die mittleren Jahre des Aufbegehrens, Star die abgeklärte, gereifte Ikone. Was zunächst wie ein kluger Kunstgriff wirkt, erweist sich bei näherem Hinsehen leider als Fehlkalkulation.

Pamina Lenn als Babe dreht den Camp-Regler bis zum Anschlag auf. Lenn bringt als Babe zwar eine bemerkenswerte Stimme mit, liefert aber genau das ab, was Tölle eigentlich vermeiden wollte: eine überstilisierte Imitation. Ihre Darstellung ist so stark auf äußerliche Nachahmung fokussiert, übertriebene Gestik, karikierte Sprechmuster, Manierismen, dass der Kern der Person, den der Regisseur zu finden vorgibt, vollständig verschwindet. In I Got You, Babe an der Seite von Jan Rogler zeigt sie zwar vokales Können, doch ihre Performance wirkt wie eine Parodie der Parodie, nicht wie eine Interpretation. Wenn sie in Da Doo Ron Ron gemeinsam mit ihren Alter Egos die Bühne erobert, ist ihre Cher eine Karikatur und widerspricht damit fundamental Tölles eigenem Ansatz, den er im Gespräch mit mir betonte.

Hannah Leser als Lady bringt eine kraftvolle Stimme und bühnenpräsente Ausstrahlung mit. In All I Ever Need Is You mit Rogler zeigt sie Momente von Verletzlichkeit, die das Potential ihrer Interpretation andeuten. Doch Regie und Buch geben ihr zu wenig Material, um wirklich zu leuchten. Sie bleibt in einem dramaturgischen Niemandsland gefangen wie eine Mittelfigur ohne echten dramatischen Bogen.
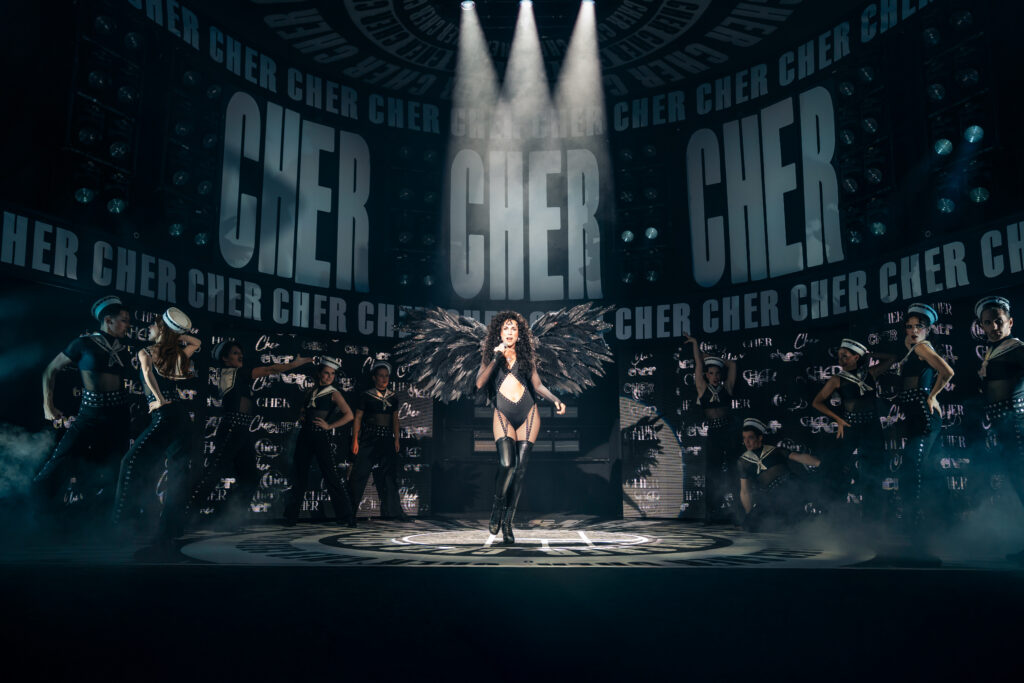
Sophie Berner liefert als Star Cher eine außerordentliche Leistung ab und ist diejenige des Trios, die Tölles programmatischen Anspruch tatsächlich einlöst. Sie erfasst nicht nur die äußeren Manierismen der Künstlerin, sondern findet zu einer differenzierten Darstellung, die zwischen Verletzlichkeit und Stärke changiert. Besonders in The Way Of Love zeigt sie, was diese Produktion sein könnte: ein berührendes Porträt einer Frau, die sich gegen alle Widerstände behauptet hat. Berners Interpretation verleiht dem Abend jene Tiefe, die dem Buch fehlt. Wenn Berner in Vamp die Bühne dominiert, spürt man die Macht und die Einsamkeit gleichermaßen. Ihre Interpretation von I Found Someone mit Simon Rusch als Rob Camiletti trägt eine zerbrechliche Hoffnung in sich, die umso berührender wirkt, weil Berner sie nie sentimentalisiert. Hier steht nicht eine Schauspielerin, die eine Rolle spielt, sondern eine Künstlerin, die versteht, was es bedeutet, zwischen öffentlicher Persona und privatem Selbst zu existieren.
Die Songauswahl aus Chers umfangreichem Songkatalog ist natürlich eine Herausforderung. Mit 35 Nummern versucht die Show, verschiedene Karrierephasen abzubilden, wobei nicht alle Entscheidungen gleichermaßen überzeugen. Einige der ikonischsten Hits fehlen –Walking in Memphis, Love and Understanding, Heart of Stone – während andere Songs eher illustrativ denn narrativ eingesetzt werden. Schlimmer noch: Die Songs erzählen die Geschichte kaum. Meist werden sie als emotionale Satzzeichen eingesetzt, oft wirken sie nicht mehr als Fanservice. If I Could Turn Back Time wird allein wegen seines Titels als Eröffnungsnummer herangezogen: eine naheliegende Wahl, die jedoch rein konzeptionell motiviert ist. Der Song funktioniert als Meta-Kommentar zum Rückblick-Format, erzählt aber nichts über die Figur selbst. Diese Eröffnung etabliert einen Modus, der sich durch den ganzen Abend zieht: Songs werden aneinandergereiht, ohne dass sie wirklich eine Geschichte erzählen.

Bang Bang (My Baby Shot Me Down) als Ensemble-Stück soll das Ende der Beziehung zu Sonny markieren. Die metaphorische Ebene – Liebe als tödliche Wunde – bietet sich an, doch die Inszenierung bleibt seltsam distanziert. Statt die emotionale Sprengkraft auszuloten, wird die Nummer zu einer choreografisch aufwendigen Revue-Einlage.Christopher Tölle und Nigel Watson liefern hier durchaus präzise Arbeit – die Bewegungen sind sauber, das Ensemble synchron, die Formationen visuell ansprechend (hervorzuheben auch bei der Nummer Dark Lady). Doch Präzision ersetzt keine Emotion.
Besonders problematisch ist The Beat Goes On mit umgetexteten Zeilen über Chers Filmkarriere (Da steht Mike Nichols vor der Tür!). Ihr Durchbruch als Schauspielerin – Silkwood neben Meryl Streep, die Oscar-Nominierung, der spätere Triumph und Oscar mit Moonstruck, die Jahre des Kampfes um Anerkennung – wird in wenigen Minuten abgehandelt, als wäre Hollywood eine Fußnote. Obwohl ich immer dafür bin Texte im Original zu belassen, rächt sich die Entscheidung, genau diesen Songtext nicht zu übersetzen. Wichtige biografisch relevante Textpassagen und wesentliche Informationen gehen leider verloren. Eine Übersetzung hätte hier viel mehr Klarheit verschaffen können (Deutsche Übersetzung der Dialoge: Katharina Carl und Dominik Hafner).
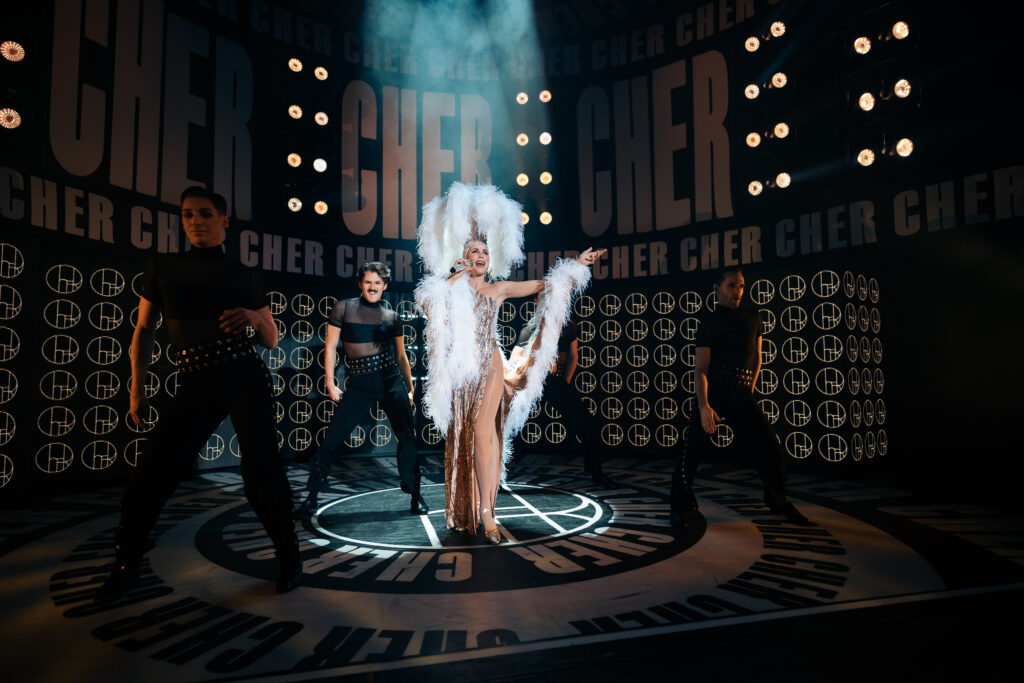
Gypsies, Tramps and Thieves wird zum Ensemble-Spektakel ausgebaut und hier zeigt sich die Stärke der Choreografie. Tölle und Watson schaffen präzise, energetische Bewegungsbilder, die visuell fesseln. Das Ensemble arbeitet mit erkennbarer Professionalität. Doch auch hier die Frage: Was erzählt dieser Song über Chers Leben? Die thematische Verbindung – Outsider-Status, soziale Ausgrenzung – wird angedeutet, aber nicht vertieft. Es ist eine gut getanzte Nummer, die inhaltlich ins Leere läuft.
Believe – Chers Comeback-Triumph von 1998, ihr erfolgreichster Song – erscheint als gemeinsamer Moment aller drei Chers. Die Inszenierung bleibt leider verhalten, als traue sie ihrer eigenen Wirkung nicht. Tölle spricht von hochemotionalen Momenten, doch hier wird ein potentieller emotionaler Höhepunkt verschenkt.
Strong Enough funktioniert als Selbstbefragung, in der alle drei Inkarnationen ihre Zweifel artikulieren – hier gelingt eine der seltenen Szenen, wo das Drei-Cher-Konzept dramaturgisch aufgeht. Doch der Moment wird nicht ausgekostet, sondern rasch zugunsten weiterer biografischer Stationen aufgegeben. Song For the Lonely als Ensemble-Nummer soll Chers Verbindung zu ihren Fans thematisieren. Doch die Umsetzung bleibt generisch: man könnte diesen Song in jedes Star-Musical einbauen, ohne dass sich etwas ändern würde.
Das Finale kombiniert You Haven’t Seen The Last Of Me mit einer Reprise von A Dream Is A Wish Your Heart Makes – ein konventioneller Abschluss für eine konventionelle Show, wenngleich Sophie Berner auch hier zeigt, wie man aus standardisiertem Material etwas Besonderes machen kann.

Dennis Heises Sounddesign kämpft mit grundlegenden Balance-Problemen. Die Band klingt häufig dumpf und übersteuert, während die Stimmen – besonders in Ensemble-Passagen – im Mix untergehen. Der entscheidende zündende Funke will so musikalisch nicht richtig überspringen.
Andrew Exeters Lichtdesign widerspricht dem Qualitätsanspruch deutlich. Immer wieder stehen Darsteller außerhalb der Lichtkegel oder werden von Schatten überlagert – ein gravierender Mangel in einer visuell orientierten Produktion.
Positiv hervorzuheben ist die Choreografie von Christopher Tölle und Nigel Watson, die der Produktion Schwung und visuelle Dynamik verleiht. Die Tanznummern sind präzise, erinnern immer wieder an Bob Fosse und schaffen es, auch schwächere Passagen der Handlung zu überbrücken. Besonders in den Ensemble-Nummern zeigt sich handwerkliches Können, das dem Abend Energie gibt.

Das Buch von Rick Elice ist schwach, die Gags zünden kaum. Chers schwierige Ehe mit dem aus Nashville stammenden Rockmusiker Gregg Allman wird in einer Nummer (Just Like Jesse James) abgehandelt und mit platten, peinlichen Wortspielen garniert: Du kommst aus Nashville? Dann will ich dich ver-nash-en, die jede emotionale Ernsthaftigkeit im Keim ersticken. Später fragt Cher den Geist des verstorbenen Sonny: Bist du wirklich tot? Man wartet förmlich augenrollend auf die Sitcom-Lacher aus der Konserve.
Dabei liegt das Material für ein packendes Drama doch so greifbar nahe: Wie Männer, Ehemänner, Manager und Studiochefs systematisch versuchten, Cher kleinzuhalten und auszubeuten. Wie sie sich wehrte, scheiterte, neu erfand. Ihre Legasthenie, die ihr das Vorsprechen für Rollen zur Qual machte. All das wird entweder nur kurz erwähnt, übersprungen oder so glattgebügelt, dass keine Konfrontation entsteht. Eine Show über Empowerment, die Angst vor echten Konflikten hat. Am auffälligsten ist die Auslassung von Chers anfänglichen Schwierigkeiten mit Chaz’ Coming-out als trans. Dies war ein realer, dokumentierter Konflikt, denn Cher brauchte Zeit, um Chaz’ Identität zu akzeptieren. Diese Geschichte hätte den Star-Jahren dramatische Substanz geben können, hätte zeigen können, dass auch Ikonen lernen und wachsen müssen. Die Show schweigt vollständig dazu: vermutlich, um Cher als perfekte LGBTQ+-Ally zu präsentieren. Das mag politisch opportun sein, ist aber dramaturgisch feige.

Die Figur der Mutter Georgia Holt (Hanna Kastner) ist ein besonders ärgerliches Beispiel für dramaturgische Faulheit. Ihre Funktion erschöpft sich in gelegentlichen Auftritten, in denen sie mahnende oder ermutigende Sätze, wie von einem Apotheken-Werbekalender von sich gibt (Der Song wird dich stark machen!). Sie ist ein wandelndes Narrativ-Gerüst ohne eigenes Leben. Man hätte Chers Kindheitsprägung durch innere Monologe, der drei Chers im Dialog oder auch durch symbolische Szenen lösen können, doch stattdessen steht Kastner herum wie eine Requisite mit Text.
Jan Rogler als Sonny Bono sollte der zentrale Antagonist sein – der Mann, der Cher entdeckte, förderte, kontrollierte und enteignete. Doch Rogler bleibt farblos, ein Platzhalter in schlechtsitzenden 60er-Jahre-Anzügen. Simon Rusch hat mehr Glück: Als Gregg Allman und Rob Camiletti darf er wenigstens ein bisschen Rockstar-Charme versprühen. Maximilian Vogel als Bob Mackie hat nicht mehr als einen Cameo Auftritt: er lässt ein paar Bonmots fallen und verschwindet wieder – ein bedauernswerter dramaturgischer Fehlgriff, wenn man bedenkt, wie zentral Mackie für Chers visuelles Imperium war.
Mackie, der Sultan der Pailletten, schuf nicht nur Kostüme, er baute Chers Image aus Perlen und Federn. Seine Entwürfe waren Manifeste: bauchfreie Glitzerkonstruktionen, bodenlange Federroben, durchsichtige Perlenvorhänge, die mehr andeuteten als verhüllten. Heike Seidlers Kostüme für diese Produktion orientieren sich klar an Mackies DNA und sind handwerklich einwandfrei. Ihre Arbeit steht erkennbar in der Tradition von Mackies Ästhetik: bauchfreie Glitzer-Outfits, federbesetzte Roben, paillettenbesetzte, Regenbogen-Bodysuits, ohne sie sklavisch zu reproduzieren. Doch das legendärste aller Mackie-Kostüme fehlt: das schwarze, transparent-perlenverzierte Ensemble von der Oscar-Verleihung 1988. Dieses Kostüm – eine spektakuläre Kopfbedeckung kombiniert mit einem fast nackten, von Perlen umhängten Körper – war Provokation und Triumph zugleich.

Elices Buch von Die CHER Show verlässt sich auf Metakommentare und Selbstreflexion, um Struktur vorzutäuschen. Star tritt aus der Handlung heraus, kommentiert, ruft ihre Alter Egos zur Konferenz zusammen. Es ist so viel leichter, mit mir selbst zu reden!, sagt sie an einer Stelle – ein Moment selbstironischer Klarheit in einer Show, die sonst auf Autopilot läuft. Obwohl das Stück weibliche Selbstbestimmung verhandeln will, stammt es aus einem rein männlichen Kreativteam. Entsprechend bleibt die Darstellung leider viel zu glatt: Statt biografischer Ecken und Kanten gibt es vertraute Empowerment-Formeln. Cher wird idealisiert, nicht hinterfragt.
Die CHER Show ist solides Unterhaltungstheater mit einzelnen herausragenden Momenten. Sophie Berners Leistung allein rechtfertigt den Besuch, die Choreografie überzeugt, und das Ensemble arbeitet mit erkennbarem Engagement und Drive. Alle aber können nicht retten, was strukturell nicht funktioniert.
Was fehlt, ist der Mut zur dramaturgischen Konsequenz – der Wille, tiefer zu graben, unbequemer zu werden, die Ikone nicht nur zu feiern, sondern zu verstehen. Diese Widersprüche sind nicht einfach Umsetzungsprobleme: sie deuten auf eine grundlegende Unsicherheit darüber hin, was diese Produktion eigentlich sein will. Ein kritisches Porträt einer komplexen Künstlerin? Eine Hommage an eine Ikone? Eine Reflexion über die Konstruktion von Star-Personas? Ein unterhaltsamer Abend mit vertrauten Hits? Die Show versucht, all das gleichzeitig zu sein, und wird dadurch keinem dieser Ansprüche wirklich gerecht.
Am Ende steht eine Show, die ihre Stärken hat, aber unter ihren Möglichkeiten bleibt. Für Cher-Fans ist sie ein unterhaltsamer Abend mit vertrauten Melodien. Für alle anderen eine solide, wenn auch nicht außergewöhnliche Musicalproduktion, die beweist, dass Starqualität auf der Bühne vieles ausgleichen kann – aber nicht alles.
And the beat goes on…

Review: MRS DOUBTFIRE
Capitol Theater Düsseldorf

von Marcel Eckerlein-Konrath
Die Musicaladaption von Mrs. Doubtfire steht vor einer nahezu unmöglichen Aufgabe: Robin Williams’ legendäre Performance aus dem Film von 1993 auf die Bühne zu bringen, ohne in bloße Imitation zu verfallen. Der Film, der weltweit über 440 Millionen Dollar einspielte und Williams für einen Golden Globe nominierte, ist tief im kollektiven Gedächtnis verankert. Die Broadway-Produktion, die im Dezember 2021 ihre Premiere feierte, wagte sich dennoch an dieses Erbe heran – mit gemischten kritischen Reaktionen, aber solidem Publikumserfolg. Nach über 600 Vorstellungen am Broadway folgte 2023 die West End-Produktion im Shaftesbury Theatre, die das Material mit britischem Humor anreicherte und ebenfalls ein dankbares Publikum fand.
Die Geschichte von Daniel Hillard, dem geschiedenen Vater, der sich als schottische Haushälterin verkleidet, um mehr Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, birgt eine zeitlose Prämisse über Elternschaft, Identität und Familie. Das Genre der Cross-Dressing-Komödie hat eine lange Theatertradition – von Shakespeares Twelfth Night über Brandon Thomas’ Charley’s Aunt bis zu moderneren Beispielen wie La Cage aux Folles, Tootsie oder Kinky Boots. Die Gratwanderung zwischen respektvoller Darstellung und platter Klamotte bleibt jedoch stets eine Herausforderung.

Die Produktion im Capitol Theater steht und fällt mit ihrer Hauptbesetzung – und hier liefert in der besuchten Vorstellung Dani Spampinato als Daniel Hillard eine bemerkenswerte Leistung ab. In einer Rolle, die kontinuierliche Bühnenpräsenz, rasante Kostümwechsel, Gesangs- und Tanzeinlagen sowie körperliche Komik auf höchstem Niveau verlangt, demonstriert Spampinato echtes Können. Seine Performance ist keine bloße Robin-Williams-Kopie, sondern findet einen eigenen Zugang zu dieser vielschichtigen Figur. Die Stimmenimitationen – von Kermit bis Donald Trump, von SpongeBob bis Dieter Bohlen – zeugen von technischer Virtuosität, doch wichtiger noch: Spampinato bewahrt die emotionale Authentizität der Rolle. Wenn die Gags zünden, und das tun sie durchaus in den besten Momenten des Abends, dann ist es seinem Timing und seiner Hingabe zu verdanken.
Die Rolle des Daniel Hillard/Mrs. Doubtfire gehört zweifellos zu den anspruchsvollsten männlichen Musicalhauptrollen der Gegenwart. Spampinato ist praktisch durchgängig auf der Bühne, trägt die Show auf seinen Schultern und meistert diese Mammutaufgabe mit bewundernswerter Energie. Das Tür-auf-Tür-zu-Prinzip der Inszenierung von Jerry Zaks, diese mechanische Choreografie des Chaos, wirkt allerdings wie altmodisches Boulevard-Theater: unterhaltsam für Momente, aber schnell ermüdend in seiner Vorhersehbarkeit.
Jessica Kessler findet als Miranda Hillard nicht durchgehend zu einer überzeugenden Balance zwischen Gesang und Spiel; ihre Darstellung fügt sich damit weniger harmonisch in das Gesamtbild des Abends ein. In einer Rolle, die mehr als nur die “böse Ehefrau” sein sollte, fehlt es an Nuancierung und stimmlicher Durchschlagskraft. Die emotionale Tiefe, die nötig wäre, um Mirandas Perspektive nachvollziehbar zu machen, bleibt auf der Strecke.

Bei den Kinderrollen fällt weniger individuelles Unvermögen als vielmehr eine stark gelenkte Regieführung auf: Laya Höflings engagierte Lydia wirkt stellenweise unnatürlich überzeichnet, Karl und Luisa erscheinen als Christopher und Natalie auffallend formatiert. Sie stehen oft wie im Spalier arrangiert, funktionieren gehorsam, aber es fehlt ihnen die kindliche Spontaneität und Lebendigkeit, die diese Familiengeschichte glaubwürdig machen würde. Gerade in einem Stück, das vorgeblich die Beziehung zwischen Vater und Kindern feiert, ist dies ein spürbarer Mangel.
Nicolas Tenerani als Frank, Daniels Bruder hat durchaus witzige Momente, leidet aber unter erheblichen Textverständlichkeitsproblemen. Ähnlich ergeht es Malick Afocozi als Andre Mayem – beide Darsteller kämpfen gegen eine akustische Mischung, die häufig die Musik viel zu laut über die Stimmen legt. Dies ist eines der gravierendsten technischen Probleme der Produktion: Wenn das Publikum die Texte nicht verstehen kann, gehen sowohl Witze als auch emotionale Momente verloren.
Als Wanda Seliner bleibt Tamara Wörners Darstellung insgesamt ordentlich, setzt jedoch weder stimmlich noch darstellerisch nachhaltige Akzente. Christian Funk ist als Stuart Dunmire austauschbar, langweilig und wenig charismatisch: eine Rolle, die mehr Profil vertragen könnte, um als echte Bedrohung für Daniel wahrgenommen zu werden.
Die Inszenierung setzt stark auf die bekannten Szenen aus dem Film – die chaotische Restaurant-Sequenz, angereichert mit einer Flamenco-Einlage, die punktuell funktioniert, wirkt dennoch oft wie pflichtschuldig abgearbeitet und schnell ermüdend. Die Gags sind häufig bemüht und zünden nur auf Sparflamme. Cross-Dressing lebt von Timing, Überraschung und der richtigen Balance zwischen Absurdität und Glaubwürdigkeit: Elemente, die hier zu oft fehlen. Wenn die Komik tatsächlich funktioniert, liegt es an Spampinatos Können, nicht an der Regie oder dem Material selbst.

Die Musik von Wayne und Karey Kirkpatrick bleibt gefällig, aber selten wirklich originell. Sie erfüllt ihre Funktion, bietet einprägsame Melodien und unterstützt die emotionalen Höhepunkte, doch eigenständige Ohrwürmer bleiben Mangelware. Die Songs verlassen sich zu sehr auf bekannte Stilmittel ohne eine eigene musikalische Identität zu entwickeln.
Das musikalische Highlight des Abends ist zweifelsohne Ich muss ’ne Frau sein (im Original Make Me a Woman), die Transformationsszene, in der Daniel zu Mrs. Doubtfire wird. Hier erreicht die Produktion ihr Potential: Die Nummer verbindet Comedy, Charakterentwicklung und musikalische Dramatik in einer Weise, die an die großen komischen Showstopper des Genres erinnert: die Musik unterstützt statt zu dominieren, und für etwa acht Minuten funktioniert alles perfekt. Es ist ein Moment, der zeigt, was diese Produktion hätte sein können.
Als buntes Komforttheater erzählt Mrs. Doubtfire im Capitol Theater eine Geschichte über Familie und bedingungslose Liebe, ohne große Risiken einzugehen. Dani Spampinato überzeugt mit einer herausragenden Leistung, die den Abend klar aufwertet. Gleichwohl ist die Inszenierung vor allem auf ein Familienpublikum zugeschnitten, verläuft stellenweise etwas behäbig und neigt dazu, ihre emotionale Botschaft zu deutlich und schwülstig auszuspielen.
Für Fans des Films und des Genres bietet der Abend durchaus Vergnügen, Lacher in den besten Momenten und die emotionale Wärme, die das Material verspricht. Doch das Potential der Geschichte, wirklich zu berühren und gleichzeitig durchgehend zu unterhalten, wird nur in Ansätzen ausgeschöpft.

Review: CHARLIE UND DIE SCHOKOLADENFABRIK
Theater Regensburg

von Marcel Eckerlein-Konrath
Das Theater Regensburg festigt mit der deutschen Erstaufführung von Charlie und die Schokoladenfabrik seinen Ruf als aufstrebende Musical-Hochburg. Dass Intendant Sebastian Ritschel erneut die Rechte für eine hochkarätige Premiere nach Regensburg holen konnte, ist bemerkenswert und zeugt von strategischer Weitsicht. Diese Produktion beweist eindrucksvoll: Ein Stadttheater kann mit großen Musical-Bühnen mithalten: vorausgesetzt, das künstlerische Team schöpft aus einer klaren Vision und exzellenter Umsetzung das Maximum aus dem Material heraus. Dass dies hier gelingt, ist umso bemerkenswerter, als Marc Shaimans Partitur nicht zu seinen überzeugendsten Arbeiten zählt.
Regisseur Ulrich Wiggers, der gemeinsam mit Maximilian Spielvogel auch für das Lichtdesign verantwortlich zeichnet, hat eine fantasievolle Inszenierung geschaffen, die die Schwächen der Komposition durch visuellen Einfallsreichtum und präzise Charakterarbeit kompensiert. Wiggers versteht Charlie und die Schokoladenfabrik als Einladung zum Träumen – eine Welt voller Magie, Mystik und Fantasie, die bewusst aus dem Alltag herausführt. Diese Vision trägt die Produktion auch dort, wo Shaimans Musik es nicht tut.
Die Ausstattung von Kristopher Kempf ist fantasievoll. Die Kostüme sind nicht nur ästhetisch überzeugend, sondern charakterisieren die Figuren mit feinem Gespür für Nuancen und Überzeichnung. Für eine Stadttheater-Produktion ist die Gesamtausstattung außerordentlich hochwertig. Besonders profitiert die Inszenierung vom absenkbaren Bühnenboden, der spektakuläre Momente ermöglicht: Wenn sich die Bühne öffnet und die magische Welt der Schokoladenfabrik sichtbar wird, entsteht jener Moment des Staunens, den das Musical verspricht.

Marc Shaimans Komposition für Charlie und die Schokoladenfabrik gehört nicht zu seinen stärksten Arbeiten – und das ist das offene Geheimnis dieser Produktion. Während Shaiman bemüht ist, eine stilistische Vielfalt zu schaffen und jeder Figur eine eigene musikalische Sprache zu verleihen, bleiben viele seiner Original-Songs blass und wenig einprägsam. Sie erfüllen ihre dramaturgische Funktion, ohne jedoch nachzuhallen.
Bezeichnend ist, dass die beiden Lieder, die tatsächlich im Ohr bleiben – The Candy Man Can und Im Land der Träume und Illusionen (Pure Imagination) –, ausgerechnet jene sind, die nicht von Shaiman stammen, sondern aus der Filmversion von 1971 übernommen wurden. Leslie Bricusse und Anthony Newleys zeitlose Melodien aus dem Original-Film besitzen eine melodische Kraft und emotionale Tiefe, die Shaimans Neukompositionen weitgehend vermissen lassen. Diese beiden Songs tragen die emotionalen Höhepunkte der Produktion: was weniger ein Kompliment an Shaiman als vielmehr ein Eingeständnis der kompositorischen Hierarchie ist.
Umso bemerkenswerter ist die Leistung von Lucia Birzer als musikalische Leiterin. Birzer gelingt es, aus Shaimans teils sprödem Material das Beste herauszuholen. Ihre Interpretation betont die stilistische Bandbreite – von opernhaften Passagen über jazzige Elemente bis zu modernen Pop-Anleihen – und schafft damit eine klangliche Dichte, die über die Schwächen der Komposition hinweghilft. Das Philharmonische Orchester Regensburg spielt mit Präzision und Spielfreude, unterstützt vom Opernchor und dem Cantemus Chor, die in den großen Ensemble-Nummern ihre Stärken ausspielen.

Birzers Choreinstudierung sorgt dafür, dass die Umpa-Lumpa-Auftritte – die im Musical eine zentrale Rolle spielen – sowohl musikalisch als auch szenisch überzeugen. Yvonne Braschkes Choreografie ergänzt dies mit spielerischer Leichtigkeit und setzt auch humorvolle Akzente, die zeigen: Mit intelligentem Handwerk lässt sich auch aus mittelmäßigem Material Theater von Format schaffen.
Alejandro Nicolás Firlei Fernández als Willy Wonka ist die tragende Säule dieser Produktion. Seine warme, ausdrucksstarke Stimme verleiht dem exzentrischen Chocolatier eine emotionale Tiefe, die weit über die bloße Exzentrik hinausgeht. Sein Wonka ist verletzlich und verspielt zugleich, ein gebrochener Mensch, der seinen Glauben an die Menschheit verloren hat und in Charlie die Möglichkeit einer Wiedergutmachung sieht.
Felix Rabas als Charlie Bucket ist herzerwärmend und authentisch. Er verkörpert die kindliche Reinheit und unerschütterliche Fantasie mit einer Subtilität, die berührt. Rabas’ Charlie ist kein passives Wunschkind, sondern ein intelligenter, empathischer Junge, der Wonka auf Augenhöhe begegnet. Wiggers’ Inszenierungskonzept – die beiden Hauptfiguren als Außenseiter, die einander spiegeln und durch Vertrauen zueinanderfinden – wird durch Rabas’ und Fernández’ Spiel vollständig realisiert. Die Szenen zwischen beiden entwickeln eine emotionale Sogkraft, die über die musikalischen Mittel hinausgeht.

Tom Zahner als Grandpa Joe ergänzt dieses Duo mit warmherzigem Charme. Seine Darstellung ist unprätentiös und ehrlich – ein liebevoller Großvater, der Charlie die Fantasie als Überlebensstrategie vermittelt hat.
Eine gelungene Entscheidung dieser Produktion ist die Besetzung erwachsener Darsteller in den Kinderrollen – und sie geht überraschend gut auf. Vincent Treftz (Augustus Gier), Monika Schweighofer (Veruca Snob), Friederike Bauer (Violet Beauregarde) und Christian Rosprim (Mike Glotzer) liefern bewusst überzeichnete, teils groteske Darstellungen ihrer verwöhnten Charaktere. Diese Entscheidung ist mehr als ein Besetzungstrick: Die Kinder werden zu grotesken Karikaturen ihrer selbst, zu Produkten einer fehlgeleiteten Erziehung.
Wiggers und Dramaturgin Marie Julius legen nahe, dass diese Kinder für den Wunsch nach Liebe und Aufmerksamkeit stehen. Während die vier gescheiterten Kinder ihre Bedürfnisse ins Extreme treiben, erfährt Charlie bedingungslose Zuwendung durch seine Familie – trotz Armut. Dieser Kontrast ist bewusst überzeichnet, fast comichaft angelegt. Die musikalische Vielfalt, die Shaiman diesen Figuren zuweist, macht sie sinnlich erfahrbar – auch wenn die einzelnen Songs nicht so recht überzeugen, funktioniert das Prinzip der charakteristischen Musik.
Besonders gelungen sind die Elternteile: Esther Baar (Frau Gier), Konstantin Igl (Herr Snob), Jakob Hoffmann (Herr Beauregarde) und Fabiana Locke (Frau Glotzer) überbieten ihre Sprösslinge noch an Lächerlichkeit und entlarven sich als die eigentlichen Urheber der kindlichen Fehlentwicklungen. Maria Mucha als Frau Bucket, Andrea Dohnicht-Pruditsch (Grandma Josephine), Christiana Wimber (Grandma Georgina) und David Holz (Grandpa George) bilden den liebevollen Gegenpol – eine Familie, die trotz materieller Not emotionalen Reichtum lebt.
Die Integration moderner Elemente – etwa die Erwähnung von Instagram-Follower oder zeitgenössische Medienreferenzen – erfolgt behutsam und organisch. Diese Aktualisierungen wirken nie aufgesetzt, sondern machen die Geschichte für ein heutiges Publikum zugänglicher. Besonders clever ist die Interpretation der Umpa-Lumpas: Das Team entschied sich gegen eine realistische Darstellung und für eine fantasievolle Lösung, die aus Wonkas Charakter heraus entwickelt wurde. Als Erfinder erschafft Wonka sie selbst – als Roboter. Diese Entscheidung ist nicht nur visuell überzeugend (dargestellt von Opernchor, Cantemus Chor, Malte Flierenbaum, Maria Mucha und Vincent Treftz), sondern löst auch elegant die problematischen kolonialen Untertöne des Originals.
Bei aller künstlerischen Begeisterung darf die kritische Auseinandersetzung mit Roald Dahl nicht fehlen. Der 1964 mit Charlie und die Schokoladenfabrik weltberühmt gewordene Autor (1916–1990) war ein Meister der Erzählkunst – doch sein Werk und sein Leben sind durchzogen von Antisemitismus, Rassismus und Frauenfeindlichkeit.
Seine 1983 getätigten antisemitischen Aussagen There is a trait in the Jewish character that does provoke animosity… Even a stinker like Hitler didn’t just pick on them for no reason – sind keine bedauerlichen Einzelfälle, sondern Ausdruck einer tief verwurzelten Weltanschauung. Dahl äußerte sich wiederholt abwertend über Juden, und diese Haltung findet sich unterschwellig auch in seinen Werken.
Die ursprüngliche Darstellung der Oompa-Loompas als afrikanische Pygmäen, die Wonka aus dem Dschungel “rettet” und die für Kakaobohnen arbeiten, war eine kaum verhüllte koloniale Ausbeutungsfantasie. Auch nach der Überarbeitung (sie stammen nun aus dem fiktiven Loompaland) bleibt die Struktur problematisch: eine ethnisch homogene, abhängige Gruppe ohne eigene Stimme, die einem weißen “Retter” zu Diensten steht.
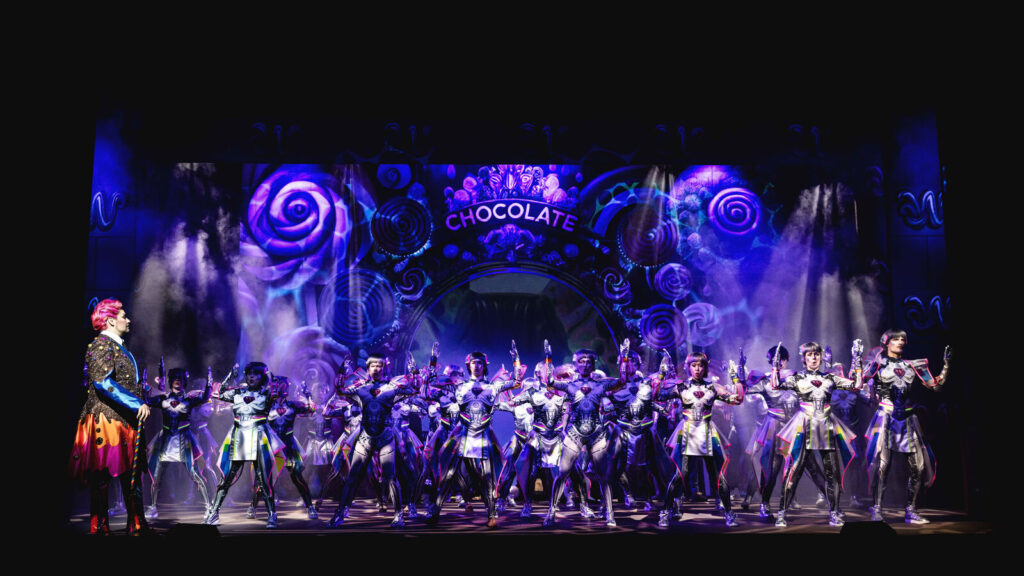
Die Regensburger Inszenierung geht mit diesem Erbe verantwortungsvoll um. Die Roboter-Lösung entschärft die kolonialen Untertöne, ohne die Geschichte zu entstellen. Dennoch bleibt die Grundstruktur der Erzählung ambivalent: Kinder werden für ihre Schwächen mit drastischen, teils traumatischen Konsequenzen bestraft, während ein exzentrischer Tyrann dies als moralisches Experiment inszeniert und beobachtet. Wonka ist kein harmloser Wohltäter, sondern ein narzisstischer Puppenspieler, dessen “Großzügigkeit” immer auch Kontrolle und Machtausübung bedeutet.
Wiggers verschweigt diese Ambivalenzen nicht, sondern arbeitet sie subtil heraus – was der Produktion zusätzliche Tiefe verleiht. Strukturell unterscheidet sich der zweite Teil des Musicals deutlich vom ersten, wie Wiggers und Birzer im Interview betonen. Während der erste Teil episodisch angelegt ist – jedes Kind scheitert in seiner eigenen Szene –, wird der zweite Teil geschlossener und filmischer, mit großen Ensemble-Nummern und musikalisch untermalten Dialogen. Hier zeigen sich Shaimans Schwächen besonders deutlich: Der dramaturgische Aufbau funktioniert, die musikalische Substanz bleibt aber dünn.
Mit Charlie und die Schokoladenfabrik legt das Theater Regensburg eine bemerkenswerte Leistung vor – insbesondere deshalb, weil die Produktion über die Schwächen von Marc Shaimans Komposition hinauswächst. Was hier gelingt, ist primär der Inszenierung, den Darstellern, der musikalischen Leitung und der Ausstattung zu verdanken: Sie schaffen aus mittelmäßigem musikalischen Material eine fantasievolle, emotional berührende und visuell überwältigende Musical-Produktion.
Dass ein Stadttheater eine solche Premiere realisiert und dabei künstlerische Risiken eingeht – von der Besetzung über die kritische Haltung zum Material bis zur bewussten Auseinandersetzung mit den kompositorischen Schwächen –, verdient höchste Anerkennung. Regensburg beweist: Musical-Theater kann mehr sein als die Summe seiner Songs. Es kann Kunst sein, die zum Träumen einlädt und gleichzeitig zum Nachdenken anregt.
Review: THE BODYGUARD
Deutsches Theater München

von Marcel Eckerlein-Konrath
Der Abend beginnt sprichwörtlich mit einem Knall – und dieser Knalleffekt setzt den Ton für diese UK Tour von The Bodyguard, die unter anderem im Deutschen Theater München gastiert.
Die Geschichte des Musicals ist untrennbar mit dem Film von 1992 verbunden. Mick Jacksons romantischer Thriller mit Kevin Costner als stoischem Personenschützer Frank Farmer und Whitney Houston in ihrer Paraderolle als Superstar Rachel Marron wurde zum weltweiten Phänomen. Der Soundtrack, maßgeblich getragen von Houstons ikonischer Interpretation von Dolly Partons I Will Always Love You, verkaufte sich über 45 Millionen Mal und avancierte zu einem der erfolgreichsten Film-Soundtracks aller Zeiten.
2012, nur wenige Monate nach Houstons tragischem Tod, feierte die Musicalbühnenadaption im Londoner Adelphi Theatre Premiere. Unter der Regie von Thea Sharrock und mit einem Buch von Alexander Dinelaris wurde der Stoff für die Bühne adaptiert: die Handlung in die Gegenwart verlegt, die Bedrohungsszenarien aktualisiert. Die Produktion entwickelte sich zum kommerziellen Erfolg im West End und tourte durch zahlreiche Länder. Nun macht die UK-Tour auch in Deutschland Station, und das Deutsche Theater München bietet den passenden Rahmen.
Mireia Mambo als Rachel Marron setzt schon mit ihrer ersten Nummer einen hohen Standard. Die Sängerin, die zuletzt u.a. bei der preisgekrönten Inszenierung von Sunset Boulevard mit Nicole Scherzinger unter der Regie von Jamie Lloyd arbeitete, verfügt über eine kraftvolle, technisch versierte Stimme, die den Vergleich mit Houstons Songs nicht scheuen muss.

Whitney Houston gilt vielen als unantastbar, ihre Songs als große Herausforderungen, doch Mambo wagt nicht nur den Vergleich, sie besteht ihn mit Bravour. Ihre Interpretation ist keine bloße Kopie, sondern eine Hommage mit eigenem Temperament. Stimmlich brillant und mit einer Bühnenpräsenz ausgestattet, die jeden Auftritt zum Event macht, ist sie in jeder Szene der unumstrittene Mittelpunkt. Schauspielerisch überzeugt sie mit starker Präsenz, auch wenn manche Szenen etwas zu sehr auf äußere Effekte setzen statt auf subtile Charakterzeichnung.
Adam Garcia als Frank Farmer hat es ungleich schwerer. Nicht etwa, weil es ihm an Können mangeln würde: der erste UK-Fiyero in Wicked und hervorragende Tänzer verfügt über ein beeindruckendes Portfolio. Das Problem liegt in der Natur der Rolle: Frank Farmer ist der starke, schweigsame Beschützer, ein Mann der Tat, nicht der Worte.
Die Rolle ist solide, aber eindimensional, denn eine wirkliche Charakterentwicklung ist kaum spürbar. Garcia spielt den Bodyguard mit professioneller Routine und der nötigen Präsenz, doch die Rolle fordert ihn weder tänzerisch noch darstellerisch wirklich heraus. Das liegt nicht an ihm, sondern an der dramaturgischen Anlage der Figur, die im Schatten von Mireia Mambos schillernder Rachel Marron notgedrungen verblasst. Man ahnt, dass Garcia weitaus mehr könnte, als diese Rolle von ihm verlangt.
Ohaana Greaves als Nicki Marron, Rachels eifersüchtige Schwester, liefert einige der bewegendsten Momente des Abends. Besonders das Duett Run to You und ihre Solonummer Saving All My Love berühren und lassen sie glänzen wie einen Diamanten. Greaves haucht dieser komplexen Figur Leben ein und changiert überzeugend zwischen Verletzlichkeit und Bitterkeit. Hier zeigt sich eine Künstlerin mit emotionaler Tiefe und stimmlicher Qualität. Ihre Performance gehört zu den echten Höhepunkten des Abends.

John Macaulay als Bill Devaney, Rachels Manager, Jonathan Alden als Tony Scibelli, James-Lee Harris als Stalker und Matt Milburn als Sy Spector erfüllen ihre Rollen unterstützend, ohne jedoch besonders in Erinnerung zu bleiben. Harris gelingt es immerhin, die Bedrohung spürbar zu machen, die von seiner Rolle ausgeht.
Die Produktion orientiert sich eng an der Londoner Original-Inszenierung, was einerseits für Kontinuität sorgt, andererseits aber auch bedeutet, dass keine neuen Impulse gesetzt werden. Für eine Tournee-Produktion ist die Ausstattung von Tim Hatley durchaus hochwertig: vom glamourösen Showbusiness-Ambiente bis zur rustikalen Berghütte: jedes Setting funktioniert. Das Lichtdesign von Mark Henderson ist stimmungsvoll, die Videoeinspielungen von Duncan McLean zeitgemäß, und Karen Bruces Choreografien verleihen der Inszenierung spürbare Energie und halten die Szenen durch präzise Bewegung in ständigem Fluss.
Dennoch bleibt die Inszenierung konventionell. Sie folgt der bewährten Formel des Jukebox-Musicals: bekannte Songs werden in eine dramatische Handlung eingebettet, ohne dass wirklich nach innovativen Lösungen gesucht würde. Das ist nicht zwingend ein Manko, denn schließlich weiß das Publikum, worauf es sich einlässt , aber es fehlt jene kreative Überraschung, die einen Abend von gut zu herausragend macht.
Natürlich ist es der Soundtrack, der den Abend trägt. Von Queen of the Night, I’m Every Woman, über So Emotional, One Moment in Time, All the Man That I Need bis zum finalen I Will Always Love You: die Hits reihen sich gut aneinander. Die Songs werden mit Engagement interpretiert, und Mireia Mambo gibt ihnen neue Energie, ohne Houstons Erbe zu verraten.
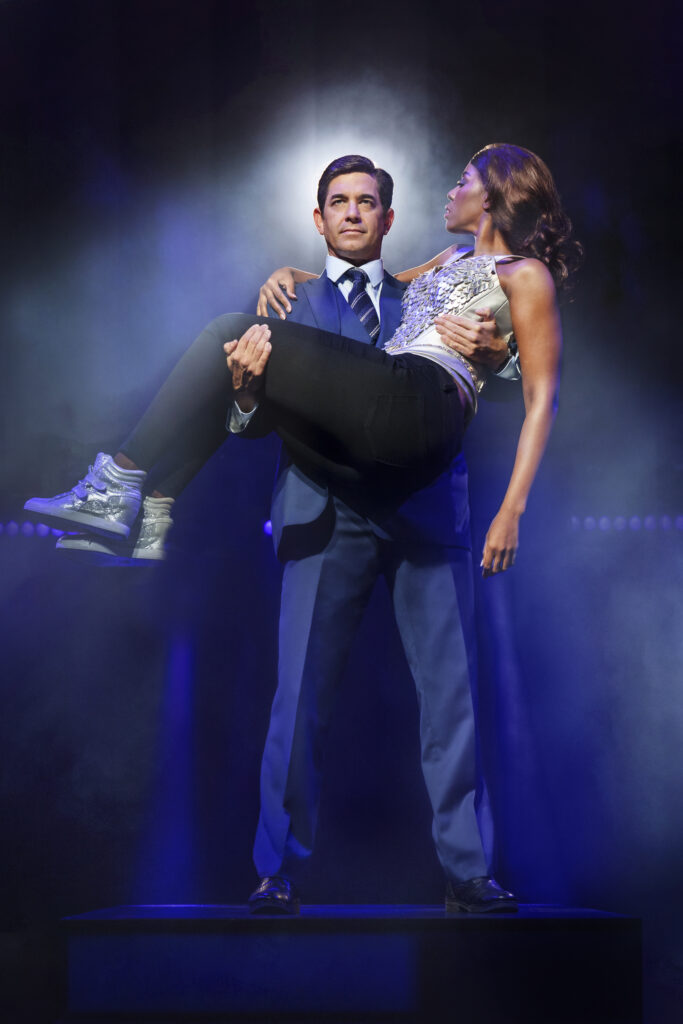
Allerdings zeigt sich hier auch das grundsätzliche Dilemma des Formats: Die Songs sind so ikonisch mit Whitney Houston verbunden, dass jede Interpretation unweigerlich am Original gemessen wird. Mambo besteht diesen Vergleich respektabel, doch die Magie des Unerwarteten stellt sich nur selten ein.
The Bodyguard im Deutschen Theater München ist solides, professionelles Musical-Entertainment. Mireia Mambo liefert eine beeindruckende Gesangsleistung ab, Ohaana Greaves bereichert den Abend mit emotionalen Momenten, und auch wenn Adam Garcia in seiner Rolle nicht vollends zur Entfaltung kommt, funktioniert die Produktion als Ganzes.
Die Inszenierung bietet keine Überraschungen, aber auch keine gravierenden Schwächen. Sie tut genau das, was sie soll: ein breites Publikum mit bekannten Songs und einer bewährten Geschichte unterhalten. Wer einen vergnüglichen Abend mit großen Stimmen und Ohrwurm-Garantie sucht, wird hier fündig. Wer jedoch auf innovative Theateransätze oder dramaturgische Tiefe hofft, könnte etwas enttäuscht werden.
Review: CABARET
Residenztheater München

von Marcel Eckerlein-Konrath
Es ist ein paradoxes Unterfangen: München soll Berlin spielen, die Schickeria den Abgrund beschwören. Wenn sich der Vorhang im Residenztheater öffnet, befinden wir uns jedoch zunächst nicht im verruchten Kit Kat Club der frühen Dreißigerjahre, sondern in einem amerikanischen Hotelzimmer : einem Raum der Erinnerung, aus dem heraus der gealterte Clifford Bradshaw (Michael Goldberg) seine Berliner Jahre Revue passieren lässt. Claus Guth, der renommierte Opernregisseur, wagt mit dieser Produktion den Sprung ins Musical und bringt dabei sowohl die Stärken als auch die Unmöglichkeiten seines künstlerischen Denkens zum Vorschein.
Guths Biografie ist der Schlüssel zum Verständnis dieser eigenwilligen Inszenierung. Jahrzehntelang hat er sich im dichten, langfristig geplanten Opernbetrieb bewegt, getrieben von einer tiefen Bindung an Musik. Seine Arbeiten, ob an der Salzburger Oper, der Mailänder Scala oder der Bayerischen Staatsoper, zeichnen sich durch psychologische Tiefe, überraschende Perspektivwechsel und eine Vorliebe für das Unberechenbare aus. Guth interessiert der entscheidende Augenblick: Warum beginnt Musik? Warum verstummt sie? Was geschieht im Bruch zwischen Realismus und musikalischer Überhöhung?
Genau diese Fragen treiben auch seine Auseinandersetzung mit Cabaret an. Das Programmheft zitiert ihn mit der Feststellung, dass dieses Musical ein Idealstoff sei, weil hier Sprache, Gesang, Tanz, Licht, Stille und theatrale Formen gleichberechtigt nebeneinander existieren und sich gegenseitig infrage stellen. Doch diese theoretische Überzeugung kollidiert in der Praxis mit der spezifischen Dramaturgie des Musicals, das anders als die Oper, nicht primär aus der Musik heraus denkt, sondern aus dem amerikanischen Showbusiness.
Das Bühnenbild von Etienne Pluss ist zweifellos eins der stärksten Elemente dieser Produktion. Zu Beginn sehen wir ein Zimmer wie aus einem Edward Hopper-Gemälde entsprungen: klare Linien, gedämpftes Licht (Gerrit Jurda), eine Atmosphäre der Melancholie und Isolation. Der alte Cliff ist ein Mann außerhalb der Zeit, gefangen in der Vergangenheit. Diese ästhetische Entscheidung ist mutig und visuell beeindruckend, doch sie erweist sich zugleich als dramaturgische Bremse.

Denn Guth bleibt diesem Erinnerungsraum treu: Zunächst spielen Szenen in diesem mondänen Hotelzimmer, auch jene, die eigentlich im schäbigen Berliner Zimmer am Nollendorfplatz stattfinden sollten. Wenn Fräulein Schneider (Cathrin Störmer, in einer der stärksten Leistungen des Abends) ihre karge Bleibe präsentiert, erscheinen das enge Bett und die rudimentären Möbel nur als Fragmente, als Requisiten einer inneren Projektion des Betrachters. Der Zuschauer muss ergänzen, was die Inszenierung andeutet.
Diese Strategie erinnert an Tennessee Williams’ Glasmenagerie, in der der Erzähler Tom ebenfalls aus der Distanz auf seine Vergangenheit zurückblickt. Auch dort verschmelzen Erinnerung und Gegenwart, auch dort wird die Bühne zum subjektiven Bewusstseinsraum. Ähnliche Verfahren finden sich in Arthur Millers Tod eines Handlungsreisenden, wo Willy Lomans Erinnerungen unvermittelt in die Gegenwart einbrechen, oder in Harold Pinters Old Times, wo vergangene und gegenwärtige Zeitebenen ineinander verschwimmen. Guth wählt also eine erprobte dramaturgische Form, doch sie funktioniert hier nur bedingt, weil Cabaret als Musical eine andere Energie, eine andere Unmittelbarkeit verlangt.
Wenn es einen uneingeschränkten Triumph dieses Abends gibt, dann ist es Vincent Glanders Conférencier. Ein sprachentalentierter Clown, ein Provokateur und Charmeur, changierend zwischen Verletzlichkeit und Zynismus: Glander gelingt es, diese Schlüsselfigur als das zu zeigen, was sie ist: ein Seismograph der Zeit, ein Spiegel gesellschaftlicher Abgründe. Er ist weniger Figur als Projektion, weniger Mensch als Prinzip. In seinem Spiel verdichtet sich alles: Lust und Ekel, Rausch und Grauen, die Gleichzeitigkeit von Lebenshunger und Todesahnung.
Hier zahlt sich Guths Opernhintergrund aus. Der Conférencier wird behandelt wie eine Tenor-Partie in einer zeitgenössischen Oper: fragmentiert, vieldeutig, nie ganz greifbar. Glander nutzt diese Freiheit virtuos und schafft Momente von verstörender Intensität: etwa wenn er zwischen Englisch und Deutsch wechselt, Charaktere des Stücks widerspiegelt oder gar imitiert, wenn er das Publikum direkt adressiert, wenn er plötzlich verstummt und die Stille wirken lässt.

Doch genau hier zeigt sich die zentrale Schwäche der Inszenierung: das auffällige Desinteresse an der musikalischen Ausarbeitung. Es irritiert, dass ein Regisseur mit Guths operatischer Erfahrung dem Gesang seiner Darsteller offenbar keine größere Priorität eingeräumt hat. Die Folgen sind unüberhörbar. Vassilissa Reznikoff überzeugt als Sally Bowles schauspielerisch mit starker Präsenz und Ausdruck, stimmlich jedoch bleibt ihre Leistung deutlich hinter dem zurück, was man in einem Musical erwarten darf.
Im 1972er Film von Bob Fosse zögerten die Macher zunächst, Liza Minnelli zu besetzen, weil sie, so die Befürchtung, zu gut sei für ein drittklassiges Cabaret. Minnellis Sally sollte eine mittelmäßige Sängerin sein, keine Ausnahmeerscheinung. Doch zwischen Mittelmaß und wirklichem Hörgenuss liegt ein weiter Abstand. Reznikoff entwickelt in ihrer Sprechstimme eine Mischung aus Betty Boop, Marilyn Monroe und Blanche DuBois – letztere besonders in den Momenten verzweifelter Selbsttäuschung, wenn Sally ihre Realitätsflucht als Lebenskunst verkauft. Man denkt unwillkürlich an Blanches berühmten Satz: I have always depended on the kindness of strangers, denn auch Sally ist eine Frau, die von der Gunst anderer lebt, die ihre Verletzlichkeit hinter Glamour verbirgt, die letztlich scheitern muss.
Guths Umgang mit den Songs ist symptomatisch: Sie werden lieblos behandelt, einige komplett gestrichen. Don’t Tell Mama – ein Lied, das Sally Bowles traditionell einführt und ihre Figur etabliert – fällt dem Rotstift zum Opfer. Andere werden als Rezitative gesprochen, was zu seltsam unentschiedenen Momenten führt. Der Wechsel zwischen Englisch und Deutsch in den Liedern wirkt unmotiviert und irritierend. Man gewinnt den Eindruck, Guth wolle den Songs ausweichen, als wären sie lästige Pflichtübungen.

Stattdessen legt er den Fokus eindeutig auf den Text. Passagen aus Christopher Isherwoods I Am a Camera – der literarischen Vorlage, lange bevor John Kander und Fred Ebb daraus ein Musical machten – finden den Weg in die Inszenierung. Das ist interessant, wirft aber die Frage auf: Wäre das Theaterstück nicht die konsequentere Wahl gewesen? Warum überhaupt Cabaret, wenn die musikalische Dimension derart vernachlässigt wird?
Die Antwort liegt vermutlich in Guths Faszination für jenen Moment, in dem Realität in Musik kippt. Doch dieser Moment will nicht recht gelingen, weil die musikalische Ausführung dem konzeptionellen Anspruch nicht standhält.
Der Beginn der Inszenierung ist zögerlich, fast langsam und elegisch erzählt. Goldbergs alter Cliff braucht viel Zeit für seine Erinnerungsarbeit: zu viel Zeit. Wenn dann Thomas Hauser als junger Cliff erscheint, bleibt er merkwürdig blass und konturlos. Es ist, als wisse die Regie nicht recht, wohin mit dieser Figur. Cliff ist bei Isherwood und in den verschiedenen Adaptionen immer eine problematische Rolle: der passive Beobachter, der Chronist ohne Handlungsmacht, der letztlich flieht, statt sich zu stellen.
Guth versucht, aus dieser Passivität eine Qualität zu machen, indem er sie als Struktur der gesamten Inszenierung etabliert: Alles ist Erinnerung, alles bereits geschehen, unabänderlich. Doch das nimmt der Geschichte ihre Dringlichkeit. Wenn wir von Anfang an wissen, dass dies die Perspektive eines alten Mannes auf seine Vergangenheit ist, fehlt die Spannung, fehlt die Möglichkeit der Veränderung, fehlt paradoxerweise die Gegenwart.
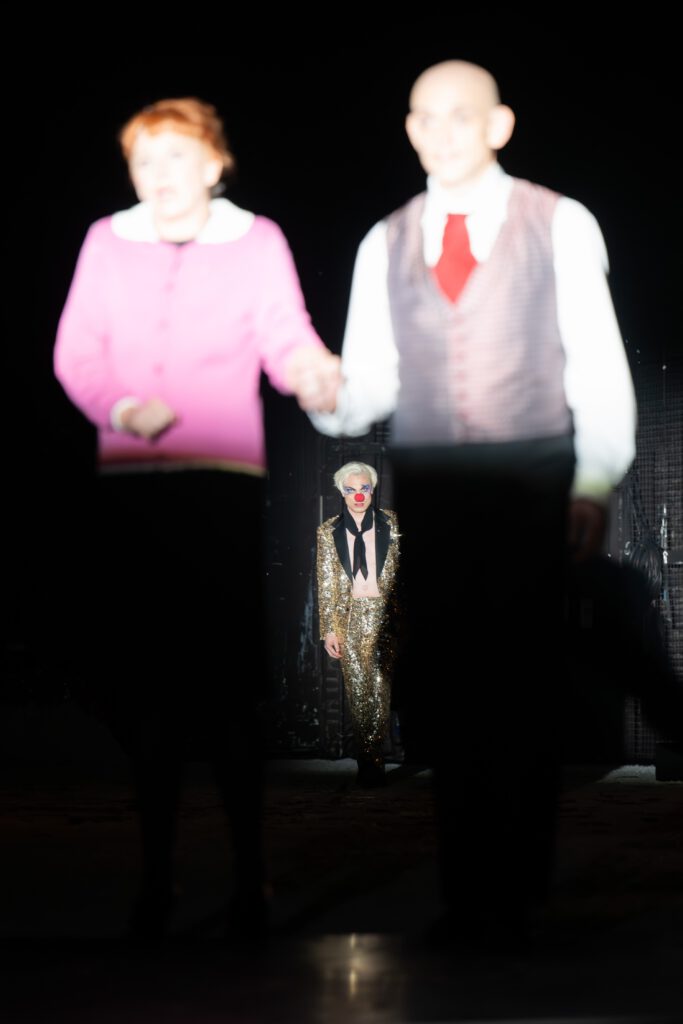
Die stärksten Momente des Abends gehören Cathrin Störmer und Robert Dölle als Fräulein Schneider und Herr Schultz. Hier gelingt Guth, was er für Sally und Cliff nicht schafft: ein echtes Kammerspiel, eine intime Begegnung zweier Menschen, die zwischen Hoffnung und Resignation oszillieren. Dölle spielt Schultz mit der Zartheit eines Magiers: etwa in den Szenen, in der er Obst hervorzaubert, eine Geste der Hoffnung in dunkler Zeit. Störmer gibt Fräulein Schneider nicht als moralisches Versagen, sondern als das, was sie ist: ein Mensch, der überleben will, der Angst hat, der sich anpasst, nicht aus Überzeugung, sondern aus existenzieller Not.
Intensiv ist jener Augenblick, in dem das Saallicht angeht während What Would You Do? und Störmer das Publikum direkt anspricht: Sie sitzen da alle so bequem! Es ist ein Moment der Konfrontation, der Unbequemlichkeit, der das Theater als moralische Anstalt im Sinne Brechts wiederaufleben lässt. Plötzlich geht es nicht mehr um historische Reflexion, sondern um uns, hier, heute. Was würden wir tun? Wann beginnt Komplizenschaft? Wo verläuft die Grenze zwischen Selbsterhaltung und Kollaboration?
Dieses Kammerspiel hätte man sich auch für Sally und Cliff gewünscht. Stattdessen scheint die Regie mit beiden nicht recht zu wissen, wohin sie gehören: im Raum der Erinnerung und auf der Bühne.
Im zweiten Akt ist das Bühnenbild komplett demontiert. Die Drehbühne kommt zum Einsatz und zeigt das Hotelzimmer nur noch in Fragmenten. Die Figuren geistern wie in einem Fiebertraum umher, die Strukturen lösen sich auf. Diese Dramaturgie der Auflösung erinnert an Strindbergs Traumspiele, an die expressionistische Stationendramatik, aber auch an zeitgenössische Arbeiten wie Katie Mitchells Fräulein Julie, wo die Bühne zum Bewusstseinsraum wird, oder an Simon Stones Adaptionen, die Realität und Erinnerung ineinander blenden lassen.
Guth versucht hier, die innere Zerrüttung der Figuren, den Zusammenbruch der Gesellschaft in eine formale Sprache zu übersetzen. Die Bilder folgen einer Traumlogik, die nicht immer nachvollziehbar ist. Manches wirkt wie der Versuch, dem Münchner Publikum zu erklären, wie brutal und vulgär die Berliner Zwanziger- und Dreißigerjahre tatsächlich waren – eine Geste, die etwas Belehrendes hat.

Vincent zur Linden als Ernst Ludwig ist diabolisch, eine Verkörperung des Bösen, das sich als Freund tarnt. Myriam Schröder als Fräulein Kost bringt eine derbe Erdung in diese zunehmend surreale Welt. Doch auch im zweiten Teil bleibt die zentrale Schwäche bestehen: die musikalische Unzulänglichkeit, die verhindert, dass die Songs ihre volle Wirkung entfalten können.
Es gibt etwas Rührendes in dem Versuch, die Münchner Schickeria in die Berliner Unterwelt zu versetzen. Die Vermessenheit dieses Unterfangens ist offensichtlich: München ist nicht Berlin, das Residenztheater nicht das Kit Kat Club, die gepflegte Theateratmosphäre nicht der Rausch und die Verrohung jener Jahre. Guth weiß das natürlich. Seine Inszenierung will die Wirklichkeit nicht nachahmen, sondern über sie nachdenken. Er zeigt nicht die Dreißigerjahre, sondern die Erinnerung an sie – aus der sicheren Distanz eines amerikanischen Hotelzimmers, aus der Perspektive eines Überlebenden.
Doch gerade diese Distanz ist problematisch. Cabaret lebt von der Verführungskraft der Gegenwart, vom Rausch, der das Denken aussetzt. Wenn alles bereits Vergangenheit ist, fehlt diese vitale Energie. Die Inszenierung bleibt daher stets kühl, ästhetisch kontrolliert: schön anzusehen, aber ohne den Schmerz, der unter der Oberfläche brennen müsste.
Claus Guths Cabaret ist eine Inszenierung voller starker Bilder, kluger Konzepte und einzelner herausragender Momente, doch sie scheitert als Ganzes. Das Bühnenbild ist grandios, Glanders Conférencier ein Triumph, das Spiel von Störmer und Dölle berührend. Doch die musikalische Dimension, die für ein Musical so elementar wichtig ist, wird sträflich vernachlässigt.
Man fragt sich, ob Guth – trotz aller Beteuerungen im Programmheft -nicht doch ein heimlicher Verächter des Musicals ist, ein Opernregisseur, der die Form nicht wirklich respektiert. Seine Stärke liegt im Psychologischen, im Subtilen, im Moment des Wendepunkts. Doch Cabaret verlangt mehr: Es verlangt Entertainment und Abgrund zugleich, Glamour und Grauen, Gesang, der trägt und berührt.
So bleibt eine noble Fehlkalkulation: eine Inszenierung, die in Teilen fasziniert und verstört, die aber letztlich nicht entscheiden kann, was sie sein will: Theater, Oper oder Musical. Oder vielleicht ist genau das Guths Absicht: das Genre selbst infrage zu stellen, seine Konventionen zu brechen. Doch der Preis dafür ist hoch. Am Ende sitzt man da – bequem, wie Fräulein Schneider sagt – und fragt sich: Was hätte sein können, wenn dieser Regisseur die Musik geliebt hätte wie den Text, die Songs wie die Bilder, die Performer wie die Konzepte?
Die Frage bleibt unbeantwortet. Wie so vieles in dieser Inszenierung.

Review:
EINE WEIHNACHTS-GESCHICHTE
Meistersingerhalle Nürnberg

von Marcel Eckerlein-Konrath
Charles Dickens veröffentlichte A Christmas Carol 1843 in einer Zeit großer sozialer Ungleichheit im viktorianischen England. Die Geschichte des geizigen Ebenezer Scrooge, der in einer einzigen Weihnachtsnacht durch die Begegnung mit drei Geistern eine radikale Wandlung durchlebt, wurde zu einem der meistadaptierten Werke der Weltliteratur. Dickens schuf nicht nur eine moralische Erzählung über Erlösung und Nächstenliebe, sondern prägte maßgeblich unser modernes Verständnis von Weihnachten als Fest der Familie und Mitmenschlichkeit. Die Geschichte lebt von der extremen Wandlung ihrer Hauptfigur; vom eiskalten Misanthropen zum warmherzigen Wohltäter. Gerade dieser Kontrast macht die Erzählung so wirkungsvoll.
Beginnen wir mit dem Positiven: Das Bühnenbild (Christoph Weyers) ist durchaus ansehnlich und liebevoll gestaltet. Die Projektionen von Michael Balgavy funktionieren sehr gut und schaffen viele schöne atmosphärische Momente, die der Geschichte visuell gerecht werden. Hier zeigt sich handwerkliches Können, das man sich auch für andere Aspekte der Produktion gewünscht hätte.
Michael Schanze und Christian Berg standen vor der Herausforderung, eine musikalische Sprache für diesen Klassiker zu finden. Ihre Lösung: Eine Mischung aus bekannten Weihnachtsmelodien mit neuen Texten, kombiniert mit Originalkompositionen. Die Idee, an Vertrautes anzuknüpfen, ist nachvollziehbar. Doch die Ausführung bleibt viel zu blass und schwammig. Die Musik plätschert ereignisarm dahin, ohne prägnante Melodien zu entwickeln, die im Gedächtnis bleiben. Es ist Musik, die weder berührt, noch mitreißt. Es stellt sich die Frage, ob die Furcht vor markanten Momenten das Werk zu harmlos gemacht hat, sodass es weder für Kinder noch für Erwachsene wirklich greifbar ist.

Uwe Kröger steht vor der schwierigen Aufgabe, eine der ikonischsten Figuren der Weltliteratur zu verkörpern. Sein Scrooge wirft Fragen auf. Regisseur Christoph Weyers hat sich offenbar für eine versöhnlichere, weniger garstige Version der Figur entschieden. Man kann darüber diskutieren, ob dies der Geschichte guttut, denn schließlich lebt Dickens’ Erzählung gerade von der dramatischen Wandlung eines wirklich abscheulichen Menschen. Ein bereits zu Beginn halbwegs sympathischer Scrooge nimmt der Geschichte ihre Wucht. Hinzu kommt, dass Krögers stimmliche Gestaltung, weder gesanglich noch mit der aufgesetzten tiefen Sprechstimme, nicht recht überzeugen mag. Sein geröcheltes Humbug will nicht bedrohlich klingen, sondern wirkt eher kraftlos. Man hätte sich gewünscht, dass hier entweder eine klarere Regieentscheidung getroffen oder dem Darsteller mehr Freiheit gelassen worden wäre, die Figur facettenreicher zu gestalten.
Besonders rätselhaft erscheint der zweite Akt. Die Grundgeschichte von Dickens wurde erkennbar familienfreundlicher aufbereitet, was eine nachvollziehbare Entscheidung ist, wenn man ein breites Publikum erreichen möchte. Doch dann führt das Buch von Christian Berg tanzende Schneemänner, eine sprechende Tür mit bayrischem Dialekt und eine Lampe in schwarzem Domina-Look ein, der eher irritiert als inspiriert (Costume Supervisor: Pia Knöll & Harald Krestel). Man möchte den Verantwortlichen zurufen: Warum? Diese Figuren wirken wie Lückenfüller, die das Stück künstlich strecken sollen, ohne dramaturgisch zu funktionieren. Sie sind weder komisch noch spannend, sondern einfach nur da. Es bleibt unklar, welche Gedanken dahinterstanden und warum in den Proben niemand kritisch nachfragte.
Hier offenbart sich ein grundsätzliches Problem der Inszenierung: Sie scheint nicht zu wissen, für wen sie eigentlich gedacht ist. Momente wie Scrooges Konfrontation mit dem eigenen Grab samt Totenkopf sind für jüngere Kinder zu gruselig und beängstigend. Gleichzeitig fehlt der Inszenierung die psychologische Tiefe und dramatische Kraft, um erwachsene Zuschauer wirklich zu fesseln. Krögers zahmes Humbug Geröchel ist dafür symptomatisch. Das Ergebnis ist eine Produktion, die zwischen allen Stühlen sitzt: zu düster für die ganz Kleinen, zu harmlos für Erwachsene, und für Kinder im mittleren Alter fehlt es an Schwung und Energie.

Es wäre unfair, die Leistungen des Ensembles nicht zu würdigen. Gerald Michel überzeugt als Jacob Marley, und Paulina Wojtowicz zeigt als erster Geist stimmgewaltig, was möglich wäre, wenn das Gesamtkonzept stimmiger wäre. Man merkt den Darstellern an, dass sie sich redlich bemühen, aus dem vorliegenden Material das Beste herauszuholen. Das verdient Respekt, auch wenn die strukturellen Probleme der Inszenierung dadurch nicht zu beheben sind.
Besonders unglücklich erscheint die Figur des Shoeshine Newsboy (George Theodosiou) als Erzähler. Er taucht zu Beginn auf, verschwindet dann vollständig aus der Handlung und erinnert erst im zweiten Akt mit seinem Solo Pfeiff drauf (Choreographie: Natalie Holtom) das Publikum daran, dass es ihn gibt. Welche Funktion soll diese Figur erfüllen? Ein Erzähler kann eine Geschichte rahmen, kommentieren, leiten: aber dafür muss er präsent und konsequent eingesetzt sein. Diese halbherzige Lösung wirkt, als hätte man sich dramaturgisch nicht entscheiden können und am Ende einen unbefriedigenden, beliebigen Kompromiss gewählt.

Die ShowSlot-Produktion von Eine Weihnachtsgeschichte ist eine Inszenierung, die sich selbst im Weg steht. Das ansprechende Bühnenbild verdeutlicht, dass die Macher über ein durchaus handwerkliches und visuelles Gespür verfügen. Doch bei den entscheidenden dramaturgischen und künstlerischen Fragen scheinen Unsicherheit und Kompromissbereitschaft die Oberhand gewonnen zu haben. Man wünscht sich eine klarere Vision: Entweder eine wirklich kindgerechte, märchenhafte Version mit Mut zur Leichtigkeit oder eine erwachsenere Interpretation, die die psychologische Tiefe des Stoffes auslotet. Stattdessen erhält man etwas Unentschlossenes dazwischen, gewürzt mit fragwürdigen Einfällen wie der sprechenden Tür.
Dickens’ Geschichte hat in über 180 Jahren bewiesen, dass sie funktioniert, wenn man ihr vertraut. Diese Produktion hätte davon profitiert, genau das zu tun: dem starken Material zu vertrauen, anstatt es mit unnötigen Elementen zu befrachten und gleichzeitig seine Kraft durch Abschwächung zu nehmen. So bleibt ein etwas ratloser Eindruck zurück und die Gewissheit, dass in dieser Inszenierung deutlich mehr Potenzial steckte, als schließlich auf der Bühne zu sehen war.
Review: PRETTY WOMAN
Deutsches Theater München

von Marcel Eckerlein-Konrath
Als Garry Marshalls Pretty Woman 1990 in die Kinos kam, war der Film ein Phänomen. Mit weltweiten Einnahmen von über 460 Millionen Dollar wurde die Geschichte der Prostituierten Vivian und des Geschäftsmannes Edward zum Überraschungshit und machte Julia Roberts über Nacht zum Superstar. Der Film funktionierte, weil er unter seiner Märchenfassade echte Gefühle transportierte, weil er zwischen Komödie und verletzlichen Momenten changierte – und weil die Chemie zwischen Roberts und Richard Gere einfach stimmte.
2018 wagte sich der Broadway an die Musicaladaption. Mit Musik und Liedtexten von Bryan Adams und Jim Vallance sowie einem Buch von Garry Marshall (der 2016 verstarb) und J. F. Lawton schien das Projekt vielversprechend. Die Broadway-Produktion lief zwei Jahre, erhielt gemischte Kritiken und tourte anschließend durch die USA. Nun gastiert die Inszenierung im deutschsprachigen Raum und offenbart dabei schmerzlich, wie schwer es ist, Filmmagie auf die Bühne zu übertragen.

München, seid ihr bereit? Ich kann euch nicht hören! Mit diesem Aufruf zur kollektiven Begeisterung beginnt der Abend und man fragt sich unwillkürlich, ob man versehentlich in einer Volksmusikshow gelandet ist. Diese Anbiederung ans Publikum setzt den Ton für eine Inszenierung, die dem Stoff und seinen Figuren nicht traut. Statt auf die Kraft der Geschichte zu setzen, wird von Beginn an auf billige Publikumswirksamkeit gesetzt.
Regisseurin Carline Brouwer hält sich textlich akribisch an die Filmvorlage, was sich schnell als fataler Fehler offenbart. Denn was auf der Leinwand funktioniert, wirkt auf der Bühne oft hölzern und konstruiert. Der Film lebte bei aller Komik auch besonders von seinen leisen Momenten, von Blicken, von Nahaufnahmen, von der Intimität zwischen zwei Menschen. All das geht auf der großen Bühne verloren.
Besonders problematisch ist die hinzuerfundene Figur des Hotelpagen Giulio (Tjesse Bleijenberg). Trottelig, treudoof und als permanentes Comic Relief konzipiert, stört er vor allem eines: die Dynamik zwischen den Hauptfiguren. Jedes Mal, wenn sich zwischen Vivian und Edward eine Spannung aufbaut, stolpert Giulio ins Geschehen und zerstört den Moment mit überzogener Tollpatschigkeit.
Es wirkt, als traue die Regie dem Publikum nicht zu, der emotionalen Geschichte zu folgen, ohne alle paar Minuten mit platten Gags abgelenkt zu werden. Die Figur lässt die Inszenierung unseriös erscheinen – als nehme man weder die Protagonisten noch deren innere Konflikte ernst.
Shanna Slaap bringt als Vivian Ward eine warme, offene Präsenz auf die Bühne, ist charmant und singt großartig. Ihre Solonummer Kein Weg zurück ist dabei wie für sie gemacht. Mathias Edenborn gibt Edward Lewis eine ruhige Stärke und punktet mit eindrucksvoller Stimme (Freiheit). Beide werfen sich mit sichtbarer Hingabe in ihre Rollen und holen aus jeder Szene viel heraus. Doch sie kämpfen gegen Windmühlen.
Die Filmszenen sind zu ikonisch, zu tief im kulturellen Gedächtnis verankert. Julia Roberts in ihrem roten Kleid auf dem Weg zur Oper. Der Moment, als Richard Gere die Schmuckschatulle zuschnappen lässt und Roberts’ spontanes, echtes Lachen die Szene zur Legende machte. Diese Momente lassen sich nicht nachspielen und verkommen zu einer blassen Kopie.
Sophie Reinicke als Kit De Luca gehört zu den Lichtblicken des Abends. Stimmstark (Rodeo Drive) und bühnenpräsent gibt sie ihrer Figur ein mächtiges Profil und echte Persönlichkeit. Sie scheint nicht im Schatten einer Filmvorlage zu stehen und kann dadurch freier agieren.

Benedikt Ivo übernimmt gleich mehrere Rollen: Happy Man, Mr. Thompson und Mr. Hollister. Das Problem: Die Figuren verschwimmen ineinander, es fehlt an klarer Differenzierung. Wo endet die eine, wo beginnt die nächste? Die Übergänge bleiben diffus.
Benjamin Plautz als Philipp Stuckey bleibt eindimensional und vorhersehbar. Sein Antagonist besitzt keine echte Bedrohlichkeit, sondern wirkt wie eine Pappfigur, die ihre Funktion im Plot erfüllen muss, ohne je wirklich lebendig zu werden.
Die Musik stammt von Bryan Adams und Jim Vallance – eigentlich eine Garantie für eingängige Melodien. Adams und Vallance haben gemeinsam mit Summer of ’69, Run To You und Heaven Welthits geschrieben, die Generationen prägten. Umso erstaunlicher ist es, dass bei Pretty Woman – Das Musical keine einzige Nummer so richtig hängen bleibt.
Die Songs sind handwerklich solide, erfüllen ihre dramaturgische Funktion, fügen sich ins Geschehen ein, aber sie berühren nicht, sie reißen nicht mit, sie setzen sich nicht fest. Man verlässt das Theater, ohne auch nur eine Melodie summen zu können. Für ein Musical ist das eine vergebene Chance. Der einzige Titel, der sich wirklich festsetzt, bleibt erwartungsgemäß der Roy-Orbison-Klassiker Pretty Woman, der schon im Film funktioniert hat und hier beim Schlussapplaus erneut seinen Effekt entfaltet. Dass dieser Song zündet, überrascht niemanden. Gleichzeitig sagt das wenig über die übrigen Nummern des Abends aus, die ohne einen solchen Hit im Rücken auskommen müssen.

Das Bühnenbild von Clara Janssen Höfelt ist typische Tournee-Ware: funktional, flexibel, schnelle Umbauten ermöglichend. Das ist professionell gelöst und ermöglicht einen flüssigen Ablauf. Doch die Projektionen, die Los Angeles, Hotelsuite und den Rodeo Drive darstellen sollen, bleiben weit hinter den Möglichkeiten zurück. Sie wirken lieblos und wenig sorgfältig gestaltet. Gerade heute, wo brillante LED Wände und durchdachte Videoideen fast schon Standard sind, fällt dieser Unterschied deutlich auf.
Eline Vroon setzt mit ihren Choreografien auf klare Linien und eine Bewegungssprache, die sich dem Stück gut anpasst. Bei In einer Nacht, wie heute Nacht wirkt die Szene etwas offener, die Bühne bekommt mehr Luft. Tanz dich einfach frei bringt einen ordentlichen Impuls und gibt der Nummer den nötigen Drive. Insgesamt bleibt die Choreografie eher zurückhaltend, doch diese beiden Momente stechen angenehm hervor.
Im Saal versammelt sich an diesem Abend eine ganze Parade von Thermomix Brigittes und Renates, die schon vor Vorstellungsbeginn mit funkelnden Selfie Filtern um die Wette strahlen, als gäbe es einen Preis für den grellsten, gschmacklosesten Glitzer. Begeisterung ist natürlich willkommen. Schwieriger wird es, wenn während der Aufführung munter weiter fotografiert wird. Mehrmals müssen Platzanweiser einschreiten und mit Taschenlampen aufleuchten, damit wieder Ruhe einkehrt. Das wirkt wie ein Sinnbild für diese Sorte Event Musical. Das eigentliche Erlebnis rückt in den Hintergrund, während das perfekte Selfie zur Girls’ Night Out und der nächste Social Media Eintrag immer weiter nach vorn drängen.

Pretty Woman – Das Musical ist dabei kein Reinfall. Es unterhält durchaus zweieinhalb Stunden lang, es bietet professionelle Darsteller und ist duchaus eine ordentliche Produktion. Aber es ist auch kein besonderes Musical mit echten Glanzmoment. Es ist Massenware, Event-Theater für Junggesellinnenabschiede und Geburtstagsgruppen.
Die Inszenierung vertraut weder ihrem Stoff noch ihrem Publikum. Sie überfrachtet eine im Grunde simple Geschichte mit überflüssigen Figuren, platten Gags und boulevardesker Überzeichnung. Sie kopiert Filmszenen, statt eigene Bühnenmomente zu schaffen. Und sie hinterlässt letztlich keine bleibende Erinnerung. Besonders der erste Akt hätte dringend Kürzungen vertragen, denn zu oft wiederholt sich die Inszenierung, zu oft tritt sie auf der Stelle.
Man verlässt das Theater nicht unzufrieden, aber auch nicht bereichert. Pretty Woman – Das Musical ist wie ein solides Fast-Food-Menü: Es macht satt, es schmeckt nicht schlecht, aber am nächsten Tag hat man vergessen, was man gegessen hat.
Wer den Film liebt, sollte ihn lieber nochmal schauen. Wer einen netten Abend mit Freundinnen verbringen möchte, ist hier sicher nicht falsch. Wer aber ein berührendes, innovatives oder künstlerisch wertvolles Musical erwartet, wird allerdings enttäuscht.
Review: KINKY BOOTS
Deutsches Theater München
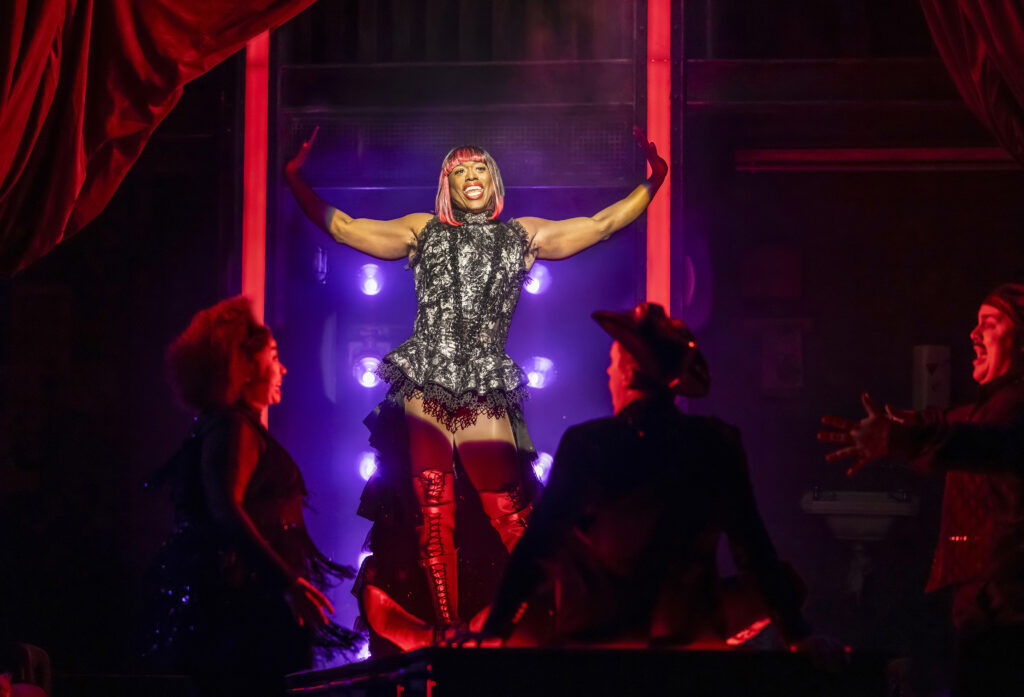
von Marcel Eckerlein-Konrath
Manchmal trifft ein Musical genau den Nerv seiner Zeit. Kinky Boots im Deutschen Theater München ist mehr als eine glänzende Musicalinszenierung. Es ist ein Aufruf zur Menschlichkeit, zur Freiheit des Andersseins und zur Freude am Leben. In einer Welt, die sich zunehmend in Schubladen verliert und in der Begriffe wie Toleranz und Wokeness oft gegeneinander ausgespielt werden, steht diese Show als leuchtendes Plädoyer für das, worauf es wirklich ankommt: Respekt.
Das Stück basiert auf einer wahren Geschichte: Eine angeschlagene Schuhfabrik, die kurz vor dem Aus steht, findet ihren Neustart – ausgerechnet mit hochhackigen Stiefeln für Dragqueens. Aus Not wird Mut, aus Unverständnis Freundschaft, aus Vorurteilen Akzeptanz. Diese Botschaft ist heute aktueller denn je. Kinky Boots zeigt mit entwaffnender Leichtigkeit, dass Vielfalt keine Bedrohung ist, sondern Bereicherung.
Nikolai Foster, Künstlerischer Leiter des gefeierten Curve Theatre in Leicester, führt die Inszenierung mit Herz, Witz und einem tiefen Verständnis für das Menschliche hinter der Show. Er hat Jerry Mitchells ohnehin brillante Original-Inszenierung genommen und stellenweise verbessert. Wo Mitchell sentimentale Momente zelebrierte, strafft Foster mit chirurgischer Präzision. Wo das Original dramaturgische Umwege nahm, findet Foster die direkte Route ins Herz. Kleine Schwächen der Originalfassung? Elegant eliminiert. Das Ergebnis ist eine Inszenierung von Klarheit, emotionaler Tiefe und unwiderstehlicher Energie. Foster versteht, dass große Geschichten Raum zum Atmen brauchen – und genau diesen Raum schafft er, mit der Sicherheit eines Meisters seines Fachs.
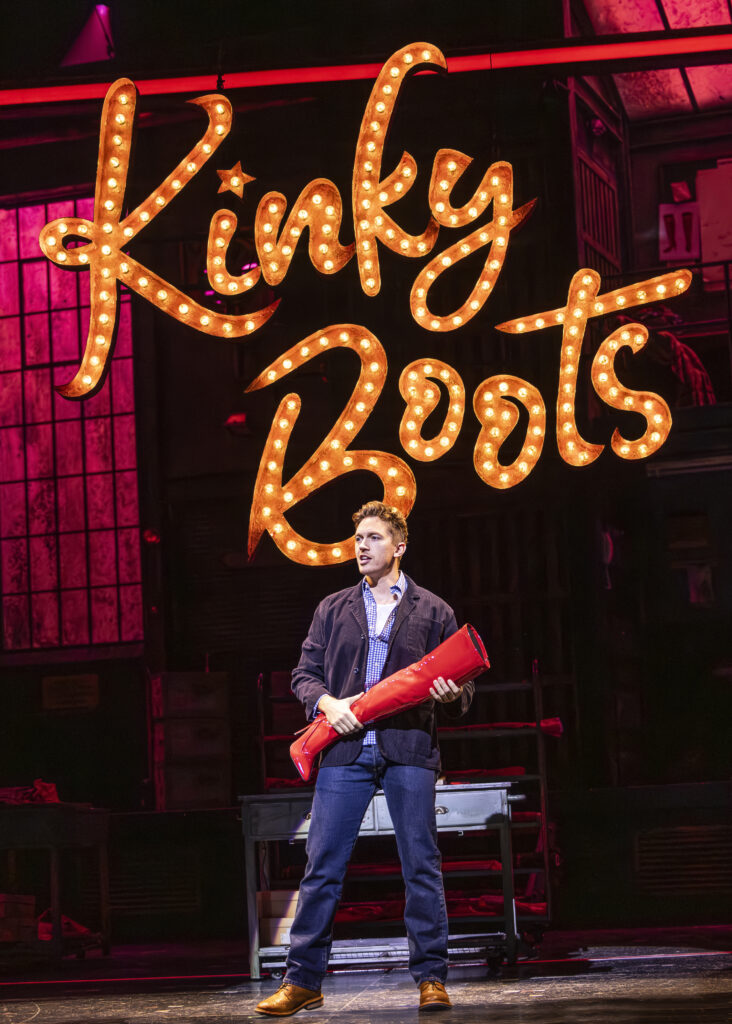
Kinky Boots steht mit der kraftvollsten und revolutionärsten Botschaft unserer Zeit: Sei, wer du bist. Und lass andere sein, wer sie sind. Diese Message ist keine hohle Phrase. Sie ist das pulsierende Herz dieser Inszenierung, eingebettet in Glitzer und Glamour, beschützt von stilettobewehrten Stiefeln, getragen von einer Erzählung, die zeigt: Akzeptanz ist keine Einbahnstraße. Respekt bedeutet gegenseitiges Verstehen. Menschlichkeit ist keine Ideologie, sondern eine tägliche Entscheidung. Die Show baut Brücken – zwischen Fabrikarbeitern und Drag Queens, zwischen Tradition und Transformation, zwischen Angst und Mut, zwischen Vater und Sohn. In einer Welt, die zunehmend in unversöhnliche Lager zerfällt, demonstriert dieses Musical mit überwältigender Kraft, dass Verbindung möglich ist, wenn wir uns trauen, authentisch zu sein und andere in ihrer Authentizität zu sehen.
Robert Jones’ Bühnen- und Kostümdesign ist schlichtweg spektakulär. Die multifunktionale Fabrik von Price & Sons ist ein Wunder an ästhetischer und technischer Raffinesse – sie verwandelt sich mit spielerischer Eleganz und atemberaubender Geschwindigkeit vom rustikalen Produktionsort zur glitzernden Mailänder Laufstegwelt. Man würde schwören, in einer stationären Long-Run-Produktion im West End oder am Broadway zu sitzen, so detailverliebt und großzügig präsentiert sich diese Tournee-Inszenierung. Jedes Element – von den industriellen Nähmaschinen über die Schuhleisten bis zu den Fabrikmauern – erzählt von Geschichte, Tradition und dem bevorstehenden Wandel.
Und dann die Kostüme: Von den erdigen, authentischen Arbeitskitteln der Fabrikarbeiter bis zu den atemberaubenden, schillernden, opulenten Kreationen der Angels – jedes einzelne Stück ist ein kleines Kunstwerk für sich. Jones versteht es meisterhaft, mit Farbe, Form, Textur und Silhouette Charaktere zu zeichnen, bevor auch nur ein Wort gesprochen wird. Seine Vision ist gleichzeitig bodenständig und fantastisch, realistisch und traumhaft – genau wie die Geschichte selbst.

Tosh Wanogho-Maud als Lola ist brillant und definiert die Rolle neu. Perfekt in Gesang und Schauspiel, atemberaubend in seiner Präsenz, herzzerreißend in seiner Verletzlichkeit. Seine Stimme trägt die gesamte Bandbreite menschlicher Emotion: Stärke und Zerbrechlichkeit, Stolz und Schmerz, Glamour und tiefe Einsamkeit. Wenn er Not My Father’s Son singt, gibt es kein Auge im Saal, das trocken bleibt. Wanogho-Maud gibt Lola eine Dreidimensionalität, die weit über die glitzernde Drag-Persona hinausgeht – er zeigt den Menschen dahinter: Simon. Einen Sohn, der die Anerkennung seines Vaters sucht. Einen Künstler, der für seine Wahrheit kämpft. Einen Menschen, der lernen muss, dass wahre Stärke im Verletzlichsein liegt.

Dan Partridge als Charlie Price liefert eine Darstellung von derart emotionaler Tiefe und Authentizität, dass man jeden Zweifel, jeden Kampf, jede Last auf seinen Schultern körperlich spürt. Sein Solo Soul of a Man ist einer jener seltenen Momente absoluter theatralischer Magie, in denen die Zeit stillsteht, der Atem stockt und nichts existiert außer dieser einen Stimme, diesem einen Menschen, diesem einen Moment purer, ungefilterter Menschlichkeit. Partridge macht aus Charlie keinen strahlenden Musical-Helden, sondern einen tastenden, zweifelnden, ringenden, wachsenden Menschen – und genau das macht seine Darstellung so berührend, so unvergesslich authentisch.

Courtney Bowman als Lauren ist ein absoluter Scene Stealer. Ihr Solo The History of Wrong Guys bringt das Publikum zum Brüllen, Johlen und frenetischen Applaudieren. Ihr komödiantisches Timing ist makellos, ihre Bühnenpräsenz magnetisch, ihre Energie ansteckend. Doch Bowman ist weit mehr als nur lustig – sie gibt Lauren eine Mischung aus Verletzlichkeit, unerschütterlichem Selbstbewusstsein und berührender Hoffnung, die hinreißend und herzerwärmend zugleich ist. Sie ist die beste Freundin, die jeder verdient hätte.

Der deutsche Duden definiert ein Ensemble nüchtern als zusammengehörende, aufeinander abgestimmte Gruppe von Schauspielern, Tänzern, Sängern oder Orchestermusikern. Doch was auf der Bühne des Deutschen Theaters geschieht, übertrifft jede Definition, sprengt jeden Rahmen, überschreitet jede Erwartung. Dies ist keine Ansammlung von einer Gruppe, sondern ein lebender, atmender, fühlender Organismus. Zahnräder, die so präzise, so perfekt ineinandergreifen, dass die Maschine zum fühlenden, denkenden, atmenden Wesen wird. Eine schier unbändige, ansteckende, überwältigende Spielfreude durchzieht jeden Moment, jeden Schritt, jeden Ton, jeden Blick, jede Geste. Man spürt, dass diese Darsteller ihre Charaktere leben, atmen und mit ganz viel Seele füllen.
Joanna O’Hare (Nicola), Billy Roberts (Don), Kathryn Barnes (Pat), Jessica Daley (Trish), Jonathan Dryden Taylor (Mr. Price/Angel), Scott Paige ( wunderbar als stimmgewaltiger George), Liam Doyle (Harry), Keith Alexander (Simon Sr/Angel) – jeder einzelne dieser Namen steht für einen Charakter mit Leidenschaft, mit Fleisch und Blut, mit einer Stimme zum Niederknien, mit einer Präsenz, die den Raum verändert. Man sieht keine Musical-Typen, keine Archetypen, keine Klischees – man sieht echte Menschen mit Ecken und Kanten, mit Ängsten und Träumen, mit Widersprüchen und Wachstum, mit Humor und Tiefe.

Die Angels – Nathan Daly, Kofi Dennis, Ru Fisher, Liam McEvoy, Ashley-Jordon Packer, Cervs Burton, Kaya Farrugia – sind keine bloße glamouröse Dekoration, keine Hintergrund-Tänzer. Sie sind Krieger der Selbstbestimmung in Absätzen, Künstler von atemberaubender Präsenz, deren pure Existenz auf der Bühne den Raum mit elektrischer, pulsierender Energie auflädt. Jede hat seine eigene unverwechselbare Persönlichkeit, seinen eigenen Groove, seine eigene faszinierende Ausstrahlung. Sie sind Individuen, die zusammen etwas Größeres erschaffen.
Leah Hill hat mit ihrer Choreografie, intelligent angelehnt an Jerry Mitchells Tony-prämiertes Original, die perfekte Balance zwischen ehrfurchtsvoller Hommage und mutiger Eigenständigkeit gefunden. Sie ehrt Mitchells ikonische, unvergessliche Moves, ohne sie sklavisch zu kopieren. Die Bewegungen sind scharf, athletisch, präzise, anspruchsvoll – doch durchdrungen von einer Lebendigkeit, Spontaneität und Freude, die nur entstehen kann, wenn Tänzer nicht nur Schritte ausführen, sondern sie mit jeder Faser ihres Körpers, mit jeder Zelle ihres Seins leben. Besonders Land of Lola und Everybody Say Yeah und der finale Catwalk (Raise You Up / Just Be) sind choreografische Feuerwerke von solcher Kraft und Brillanz, dass das Publikum jubelnd, johlend, klatschend sich im Rhythmus bewegt.

Die Live Band unter Musical Director Grant Walsh ist das pulsierende, niemals aussetzende Herz dieser Produktion. Cyndi Laupers mitreißender, emotionaler, perfekt konstruierter Score erklingt mit einer Kraft, Präzision und Leidenschaft, die vergessen lässt, dass die Musiker backstage spielen. Jeder Akkord sitzt perfekt, jeder Groove treibt unwiderstehlich voran, jede musikalische Nuance wird gefeiert. Die Band ist somit ein integraler Teil der Erzählung.
In einer Zeit, in der wir verzweifelt Geschichten über Menschlichkeit, Toleranz, gegenseitigen Respekt und die Kraft der Authentizität brauchen, ist Kinky Boots im Deutschen Theater München nicht nur eine Empfehlung, nicht nur ein Tipp – es ist eine moralische Verpflichtung. Diese Produktion ist ein Geschenk. Ein Triumph. Ein Wunder. Sie erinnert uns daran, warum Theater existiert, warum wir es brauchen, warum es unverzichtbar ist: Um zu fühlen. Um zu lachen bis die Bauchmuskeln schmerzen. Um zu weinen ohne Scham. Um gemeinsam zu applaudieren, wenn Menschen auf der Bühne einfach alles geben – und ihr Alles ist hier außergewöhnlich, überwältigend, unvergesslich.
Diese Show verdient ausverkaufte Häuser, endlose stehende Ovationen und Zuschauer, die mit glänzenden Augen, klopfenden Herzen, strahlenden Gesichtern und der festen, unerschütterlichen Überzeugung nach Hause gehen, dass die Welt ein besserer, schönerer, liebevollerer Ort sein könnte – wenn wir nur den Mut hätten, authentisch zu sein und andere in ihrer Authentizität zu feiern.
Nikolai Foster, Robert Jones, Leah Hill und dieses außergewöhnliche, brillante, unvergessliche Ensemble haben nicht nur ein Musical kreiert. Sie haben ein Manifest der Menschlichkeit erschaffen, ein Feuerwerk der Lebensfreude, ein Leuchtfeuer der Hoffnung – verpackt in Pailletten, Federn, Musik und sechzehn Zentimeter hohen Stiefeln, die die Welt bedeuten.
Dieses Musical wird Ihr Herz brechen und heilen – in derselben Sekunde.

Review: DAS PHANTOM DER OPER
Raimund Theater

von Marcel Eckerlein-Konrath
Das Raimund Theater, traditionsreiche Spielstätte im sechsten Wiener Gemeindebezirk und seit Jahrzehnten Heimstätte großer Musicalproduktionen, schreibt ein neues Kapitel in der österreichischen Geschichte eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. Als 1988 Hal Princes legendäre Originalinszenierung von Andrew Lloyd Webbers Das Phantom der Oper im Theater an der Wien ihre deutschsprachige Erstaufführung erlebte, war das der Startschuss für eine beispiellose Musical-Ära in der Donaumetropole. Nun, mehr als drei Jahrzehnte später, kehrt das Phantom zurück – in Cameron Mackintoshs vollmundig beworbener spektakulärer Neuinszenierung, die Laurence Connor international konzipierte und Seth Sklar-Heyn für Wien adaptierte.
Und tatsächlich: Spektakulär ist sie, diese Wiener Variante, die das Erbe der Originalproduktion mit Respekt bewahrt und zugleich einen eigenständigen, zeitgemäßen Zugang findet. Sklar-Heyns Inszenierung besticht durch eine bemerkenswerte Dichte, die nichts dem Zufall überlässt. Wo Princes ikonische Uraufführung auf die Kraft der theatralen Suggestion und barocke Opulenz setzte, arbeitet die neue Version mit dezidiert cineastischen Mitteln: präzise choreografierte Kamerabewegungen im Kopf, fließende Übergänge, eine Personenregie von nahezu filmischer Intimität. Jede Geste sitzt, jeder Blick erzählt eine Geschichte. In den großen Ensembleszenen – etwa im Maskenball oder in den turbulenten Opernproben – entsteht eine Detaildichte, die zum mehrmaligen Hinsehen einlädt.

Das opulente Bühnenbild von Paul Brown nutzt geschickt den Einsatz von Projektionen (Zakk Hein), ohne dabei ins Beliebige oder Überladene abzugleiten. Die Pariser Oper des 19. Jahrhunderts entsteht nicht nur durch klassische Kulissen, sondern durch atmosphärische Lichtmalerei und bewegte Bilder, die den Raum atmen lassen, ihn öffnen und wieder verengen. Die unterirdischen Katakomben des Phantoms gewinnen durch diese Technik eine fast surreale, traumartige Qualität. Und dann ist da natürlich der Moment, auf den jeder wartet: Der Kronleuchter. Er stürzt, majestätisch und verheerend wie eh und je, und das Publikum hält kollektiv den Atem an. Manche Theatermomente altern nicht – dieser gehört dazu, absolut zeitlos in seiner Wirkung.
Maria Björnsons Originalkostüme, mittlerweile selbst Ikonen der Musicalgeschichte, sind nach wie vor umwerfend. Die barocke Pracht des Maskenballes mit seinen Masken und ausladenden Roben, die düstere Eleganz des Phantoms in seinem Cape und der berühmten halben Maske, Christines wandelbare Garderobe zwischen mädchenhafter Unschuld und gereifter Primadonna – all das funktioniert heute so makellos wie bei der Londoner Premiere im Her Majesty’s Theatre 1986. Im direkten Vergleich zur Londoner Produktion wirkt die Wiener Variante allerdings kompakter und konzentrierter. Wo London auf die schiere Größe des Raumes und monumentale Tableaus setzt, findet Wien eine intimere Nähe zum Geschehen. Das ist kein Nachteil, im Gegenteil: Es verstärkt die psychologische Dringlichkeit dieser obsessiven, tragischen Dreiecksgeschichte und lässt das Publikum noch unmittelbarer teilhaben an der verzweifelten Liebe des Phantoms.
Dass Das Phantom der Oper mit praktisch allen erdenklichen Theaterpreisen überhäuft wurde – sieben Tony Awards, drei Olivier Awards, ein Grammy, dazu der Status des am längsten laufenden Broadway-Musicals der Geschichte – ist hinlänglich bekannt und dokumentiert. Diese Lorbeeren sind verdient, auch wenn man eingestehen muss: Die Geschichte selbst hat ihre Längen. Besonders im zweiten Akt zieht sich die Handlung bisweilen, die Dramaturgie stolpert über ihre eigene Redundanz. Lloyd Webber lässt – Webber sei Dank – die eine oder andere Reprise seiner unsterblichen Melodien zu viel erklingen. Doch wenn Die Musik der Nacht das Auditorium flutet, wenn Mehr will ich nicht von dir seine romantische Magie entfaltet oder die Titelmelodie in all ihrer gotischen Pracht erschallt, verzeiht man dem Komponisten jeden dramaturgischen Hänger. Diese Musik ist und bleibt zeitlos.
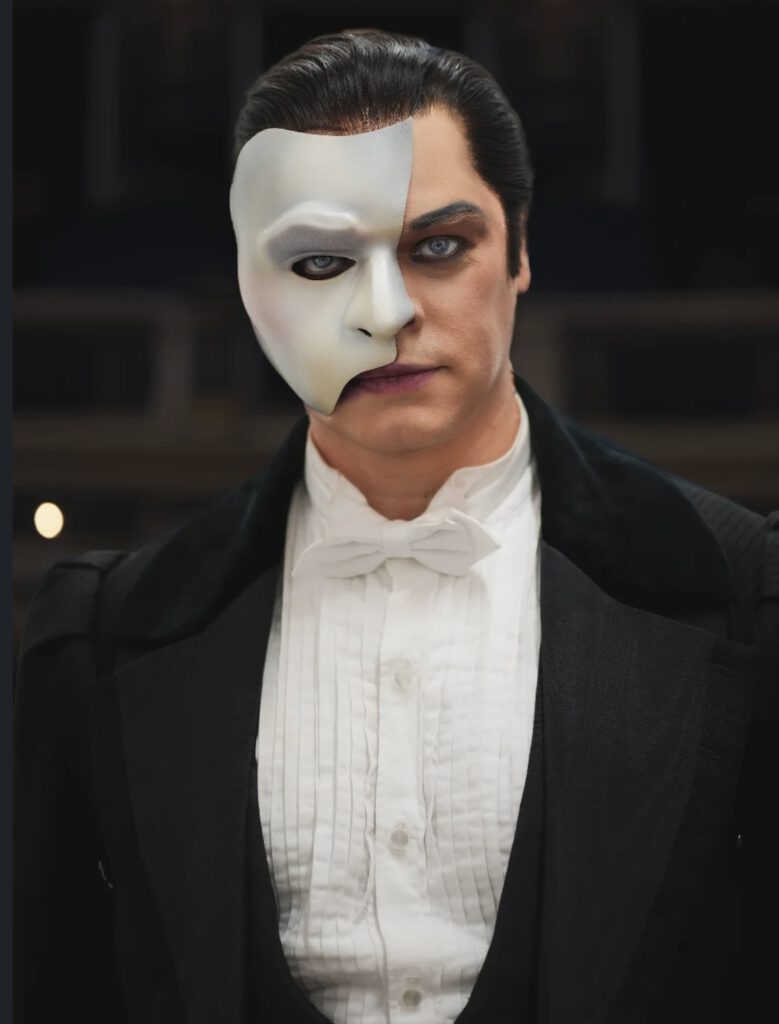
Die Wiener Besetzung überzeugt durchweg mit starken Stimmen und präzisem, nuanciertem Spiel. Robert Meyer gibt ein Phantom von erschütternder Verletzlichkeit und gefährlicher Obsession zugleich. Sein Bariton besticht sowohl in den lyrischen Passagen – seine Musik der Nacht ist von betörender Dunkelheit – als auch in den dramatischen Ausbrüchen, wenn der Wahnsinn die Oberhand gewinnt. Meyer gelingt es, das Monster und den verzweifelten Liebhaber in einer Figur zu vereinen, ohne ins Klischee abzugleiten.

Lillian Maandag als Christine Daaé ist eine Offenbarung. Ihr kristallklarer, strahlender Sopran verfügt über eine mühelose Höhe und eine Wärme, die mühelos zwischen mädchenhafter Unschuld und gereifter Künstlerin changiert. Ihre Christine ist keine passive Heldin, sondern eine Frau, die ihren eigenen Weg sucht zwischen zwei Männern und zwei Welten. Ihre Interpretation von Könntest du doch wieder bei mir sein gehört zu den emotionalen Höhepunkten des Abends – sensibel interpretiert und technisch sicher.
Roy Goldman liefert einen warmherzigen, wenn auch etwas konventionell geratenen Raoul. Das liegt weniger am Darsteller als am Libretto, das dem Vicomte de Chagny nicht eben viel Raum für Tiefenschärfe lässt. Goldman singt seinen Part mit hellem, klarem Tenor und gibt dem Charakter immerhin eine aufrichtige Redlichkeit.
Paul Kribbe und Dennis Kozeluh als Opernleiter-Duo André und Firmin sind ein Vergnügen. Sie sorgen für die dringend benötigten komödiantischen Akzente und spielen ihre Nummern mit gutem Timing. Milica Jovanovic ist eine hinreißend egomane, kapriziöse Carlotta, deren Prima Donna zu den köstlichsten Momenten der Inszenierung gehört. Patricia Nessy gibt Madame Giry jene geheimnisvolle Würde und wissende Melancholie, die die Rolle braucht – sie ist die Hüterin dunkler Geheimnisse und spielt das mit sparsamen, aber präzisen Mitteln. John Ellis’ Ubaldo Piangi überzeugt als selbstverliebter Tenor-Star, und Laura May Croucher verleiht Meg Giry mehr Profil, als die Rolle eigentlich hergibt.

Was bleibt nach diesem Abend im Raimund Theater? Ein Gefühl von theatraler Magie, von großer, zeitloser Musik und einer Geschichte, die trotz aller dramaturgischen Schwächen noch immer zu berühren vermag. Seth Sklar-Heyn hat Lloyd Webbers Werk nicht neu erfunden – das wäre auch vermessen –, aber er hat es für ein Publikum des 21. Jahrhunderts lesbar gemacht, ohne seine Seele zu verraten oder seinen Gothic-Charme zu verwässern. Die Inszenierung verbindet Respekt vor der Tradition mit cineastischer Moderne, Opulenz mit emotionaler Präzision.
Das Raimund Theater beweist einmal mehr, dass es in Wien einen Ort für große Musical-Kunst gibt, dass die Stadt nicht nur Opern- sondern auch Musical-Metropole ist. Und dass das Phantom, auch nach fast vier Jahrzehnten und zahllosen Produktionen weltweit, nichts von seiner dunklen Faszination verloren hat. Die Musik der Nacht erklingt noch immer – und Wien lauscht gebannt.

Review: BRIEFE VON RUTH
Stadttheater Fürth

von Marcel Eckerlein-Konrath
Einmal nimmt alles ein Ende und dann wird alles gut. Dieser hoffnungsvolle Satz aus der Feder der Ruth Maier durchzieht das Musical Briefe von Ruth wie ein bitterer Kontrapunkt zur historischen Wirklichkeit. Denn für die 1920 in Wien geborene jüdische Schriftstellerin nahm 1942 alles ein Ende – im Vernichtungslager Auschwitz. Ihre Briefe und Tagebucheinträge, die sie zwischen 1933 und 1942 verfasste, bilden die dokumentarische Grundlage für dieses ambitionierte Werk, das nun im Stadttheater Fürth seine deutsche Premiere erlebte.
Das norwegische Original Brev fra Ruth entstand im Rahmen des Musical Frühling in Gmunden und nähert sich dem Leben der jungen Ruth Maier auf eine Weise, die konventionelle Musical-Erwartungen bewusst unterläuft. Die Schöpfer Aksel-Otto Bull & Gisle Kverndokk und Regisseur Markus Olzinger haben sich für einen mutigen Ansatz entschieden: Die authentischen Briefzitate bleiben unangetastet, wörtlich übernommen – ein dokumentarischer Purismus, der dem Werk historische Authentizität und eindringliche Unmittelbarkeit verleiht.
Was entsteht, ist weniger konventionelles Musical als musikalisches Kammerspiel mit deutlichen Anleihen bei der zeitgenössischen Oper. Die Komposition arbeitet bewusst mit Fragmenten, mit musikalischen Momenten, die die innere Zerrissenheit einer Existenz im Exil widerspiegeln. Diese ästhetische Entscheidung mag ungewöhnlich sein – sie entspricht aber der fragmentarischen Natur eines Lebens, das gewaltsam unterbrochen wurde.

Die szenische Umsetzung auf der Bühne des Stadttheaters zeigt die Herausforderungen dieses Ansatzes deutlich: Kaum hat sich ein musikalisches Motiv etabliert, wechselt bereits die Szene. Der häufige Umbau steht manchmal in einem ungünstigen Verhältnis zur Kürze der einzelnen Momente. Man fragt sich, ob dieses Kammerstück nicht auf einer intimeren Spielstätte noch besser zur Geltung käme – vielleicht sogar reduziert auf das Wesentliche: die Stimmen, die Worte, die Erinnerung.
Dennoch: Diese formale Entscheidung ist kein Mangel, sondern Programm. Die Brüche, die Fragmentierung, das Unvollendete – all das erzählt von einem Leben, das nicht zu Ende gelebt werden durfte.
Ruth Maiers Lebensgeschichte ist von tragischer Konsequenz: 1933 beginnt die damals 13-Jährige in Wien Tagebuch zu führen, dokumentiert die zunehmende Bedrohung durch den Nationalsozialismus. 1939 gelingt ihr die Flucht nach Norwegen zu ihrer Lebensgefährtin Gunvor Hofmo, die später eine bedeutende norwegische Lyrikerin werden sollte. Doch die vermeintliche Rettung währt nur kurz: Nach der deutschen Besetzung Norwegens 1940 wird auch dort die jüdische Bevölkerung systematisch verfolgt. Im November 1942 wird Ruth Maier verhaftet, nach Deutschland deportiert und in Auschwitz ermordet – nur 22 Jahre alt.
Ihre Aufzeichnungen, über 2000 Seiten umfassend, wurden erst Jahrzehnte später von Gunvor Hofmo der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und 2007 unter dem Titel Das Leben könnte gut sein auf Deutsch veröffentlicht. Sie zeugen von einer außergewöhnlich beobachtungsgenauen, literarisch begabten jungen Frau, die sich zwischen existenzieller Angst und dem verzweifelten Versuch, am Leben, an der Kunst, an der Liebe festzuhalten, bewegt.
Diese historische Dimension macht Briefe von Ruth zu einem wichtigen Erinnerungsstück, das gerade in Zeiten wachsenden Antisemitismus und erstarkender rechter Tendenzen von bedrückender Aktualität ist.
In dieser anspruchsvollen musikalischen Landschaft ist es vor allem Jasmina Sakr als Ruth Maier, die dem Abend Momente echter Größe verleiht. Mit ihrer ausdrucksstarken, wandlungsfähigen Stimme navigiert sie souverän durch die sehr anspruchsvolle Partitur, findet Wege, der fragmentierten Musik berührende Intensität abzuringen. Ihr gelingt das scheinbar Unmögliche: Sie macht aus dokumentarischen Briefzitaten zutiefst menschliche Momente. Ihre Darstellung ist von eindringlicher Präsenz, sie verkörpert die junge Ruth Maier mit einer Mischung aus Verletzlichkeit und trotziger Lebenskraft, die nachhallt.
Tamara Pascual verkörpert Gunvor Hofmo mit beeindruckender Intensität und Einfühlsamkeit. Sie schafft es, die komplexen Gefühle der Figur glaubwürdig und berührend zu vermitteln, sodass das Publikum unmittelbar in die Geschichte hineingezogen wird.
Yngve Gasoy Romdal, Michaela Thurner, Previn Moore und das übrige Ensemble findet überzeugende Wege, die verschiedenen Zeitzeugen, Briefpartner und Wegbegleiter Ruth Maiers zum Leben zu erwecken. Sie sind mehr als bloße Kommentatoren: Sie schaffen ein atmosphärisches Geflecht, in dem Ruths Stimme sich entfalten kann.
Markus Olzingers Inszenierung zeigt Mut zur Reduktion. Die Videoprojektionen (Jürgen Erbler und Olzinger) versuchen, historische Tiefendimension zu schaffen, Ingo Kelps Lichtdesign arbeitet mit unaufdringlicher Symbolik. Die Kostüme (frei nach Angelika Pichler) bewegen sich zwischen historischer Genauigkeit und zeitloser Abstraktion.

Roland Baumanns Tondesign schafft es, den oft leisen, intimen Tönen ebenso Raum zu geben wie den dramatischen Momenten. Die musikalische Leitung von Jürgen Goriup hält das Ensemble sicher zusammen und wahrt den schwierigen Balance-Akt zwischen dokumentarischer Nüchternheit und emotionaler Dringlichkeit.
Man muss es deutlich sagen: Dies ist kein leichter Abend. Kein Musical zum Mitsummen, keine Unterhaltung im konventionellen Sinne. Die Musik verweigert sich bewusst dem Eingängigen – aber sie tut dies mit künstlerischer Integrität und im Dienste des Themas. Wer sich darauf einlässt, wer die Geduld aufbringt, den ungewöhnlichen Rhythmus dieses Stücks anzunehmen, wird mit Momenten von eindringlicher Intensität belohnt.
Briefe von Ruth stellt Fragen an die Form des Musicals, an unseren Umgang mit historischem Trauma, an die Möglichkeiten und Grenzen künstlerischer Erinnerungsarbeit. Nicht alle diese Fragen werden befriedigend beantwortet – aber allein, dass sie gestellt werden, macht diesen Abend wertvoll.
Die Produktion im Stadttheater Fürth nimmt sich dieser schwierigen Aufgabe mit Ernsthaftigkeit und handwerklichem Können an. Ja, man mag sich gelegentlich eine straffere Dramaturgie wünschen, eine klarere musikalische Linie. Aber man erkennt auch die Konsequenz, mit der hier ein eigener Weg beschritten wird – ein Weg, der dem Andenken an Ruth Maier gerecht zu werden versucht.

Einmal nimmt alles ein Ende und dann wird alles gut. Ruth Maiers hoffnungsvoller Satz hallt nach diesem Abend schmerzlich nach. Ihr Ende kam viel zu früh, und gut wurde nichts. Das Musical, das ihr gewidmet ist, ringt redlich und letztlich erfolgreich um Würde und Wahrhaftigkeit. Es ist ein ehrenhafter, künstlerisch ambitionierter Versuch, der wichtige Erinnerungsarbeit leistet und dabei bewusst einen unbequemen Weg wählt.
Nicht jeder wird diesen Abend lieben. Aber jeder, der sich darauf einlässt, wird nachdenklich das Theater verlassen – und das ist in Zeiten oberflächlicher Zerstreuung vielleicht das größte Kompliment, das man einem Stück machen kann.
Review: GHOST
Tournee 2025 – Nürnberg

von Marcel Eckerlein-Konrath
Wenn die ersten Töne von Unchained Melody erklingen, ist sie sofort wieder da – die Erinnerung an jene legendäre Töpferszene aus dem Film von 1990, die sich ins kollektive Gedächtnis einer ganzen Generation eingebrannt hat. Patrick Swayze und Demi Moore schufen damals einen der ikonischsten Momente der Filmgeschichte, und es ist diese emotionale Fallhöhe, an der sich jede Bühnenumsetzung messen lassen muss.

Die Transformation von Ghost zum Musical war ein ambitionierter Schritt, der zunächst 2011 in Manchester seine Premiere feierte, bevor die Produktion nach London ins Piccadilly Theatre zog. Der Broadway folgte 2012, und auch im deutschsprachigen Raum etablierte sich das Stück: Linz bot eine eigenständige Inszenierung, während das Theater des Westens in Berlin mit Willemijn Verkaik und Alxander Klaws eine weitere hochkarätige Produktion auf die Beine stellte. Seitdem ist Ghost durch diverse Tourneen in Europa wahrhaft herumgekommen – ein Stück, das seine Fans gefunden hat und das Publikum immer wieder aufs Neue berühren möchte.
Die aktuelle Tourneeproduktion von ShowSlot, die unter anderem in der Nürnberger Kia Arena gastiert, steht vor einer besonderen Herausforderung: Die Arena ist mit ihrer Weitläufigkeit und funktionalen Architektur nicht für die intime Atmosphäre geschaffen, die ein Musical wie Ghost eigentlich verlangt. Die sterile Umgebung eines Veranstaltungsorts, der normalerweise für Sportevents und Großkonzerte konzipiert ist, kann jene theatrale Nähe nur bedingt herstellen, die für eine Liebesgeschichte zwischen Leben und Tod so essenziell wäre. Die Dimension des Raumes schluckt bisweilen die emotionale Unmittelbarkeit – hier fehlt schlicht die behagliche Wärme eines klassischen Theatersaals.

Was die Produktion an atmosphärischer Intimität einbüßt, versucht sie durch technische Raffinesse wettzumachen und das mit beachtlichem Erfolg. Die Projektionen (Video Design: Girgory Shkylar) sind intelligent konzipiert und ermöglichen fließende Übergänge zwischen den Welten der Lebenden und der Toten. Wände werden transparent, Räume transformieren sich nahtlos, und Sams Geisterhaftigkeit wird visuell überzeugend umgesetzt. Diese technische Cleverness ist das Rückgrat der Inszenierung und beweist, dass auch unter den erschwerten Bedingungen einer Arenabespielung visuell überzeugendes Theater möglich ist.
Besonders hervorzuheben ist das Engagement des Ensembles, das mit sichtbarer Spielfreude und Energie bei der Sache ist. Sandro Wenzing gibt als Willie Lopez eine physisch präsente Performance, während Ulrich Talle als Krankenhausgeist und Sophie Alter als U-Bahngeist atmosphärische Akzente setzen. Annika Böbel (Clara), Aminata Ndaw (Louise), Simon Tofft (Beidermann) und Silja Teerling (Mrs. Santiago) bevölkern glaubwürdig die New Yorker Szenerie und wechseln routiniert zwischen verschiedenen Rollen. Luisa Meloni, Melissa Laurenzia Peters, Nolle De Kock und Philip Rakoczy komplettieren das Ensemble und schaffen so ein lebendiges Tableau der pulsierenden Metropole.

Hier offenbart sich jedoch eine der größten Schwächen der Musicalisierung: Die von Dave Stewart und Glen Ballard komponierten Songs schaffen es leider nicht, sich nachhaltig einzuprägen. Anders als bei den großen Musical-Klassikern, bei denen man summend das Theater verlässt, bleibt hier wenig haften. Die Ausnahme bildet naturgemäß Unchained Melody, jener Song von The Righteous Brothers, der bereits den Film prägte und mehrfach zitiert wird. Doch gerade hier zeigt sich ein dramaturgisches Problem: Die berühmte Töpferszene, auf die das Publikum regelrecht wartet, wirkt überraschend knapp bemessen und endet fast abrupt, bevor sie ihre volle emotionale Wirkung entfalten kann. Man wünscht sich, die Inszenierung von Manuel Schmitt hätte diesem ikonischen Moment mehr Raum gegeben.

Lina Kropf überzeugt als Molly Jensen mit einer klaren, ausdrucksvollen Stimme, die den Gefühlslagen ihrer Figur gerecht wird – stimmlich eine sichere Bank. Im schauspielerischen Bereich besteht im gesamten Cast allerdings noch Entwicklungspotenzial, insbesondere was die feine Ausarbeitung emotionaler Momente betrifft.
Robin Reitsma zeigt als Sam Wheat eine differenzierte, wenn auch eher kühle, zurückhaltende Interpretation. Die emotionale Intensität bleibt an manchen Stellen verhalten, wodurch die Verbindung zur Figur etwas schwächer ausfällt. Möglicherweise spiegelt diese Distanz jedoch bewusst Sams Zustand zwischen Leben und Tod wider: eine interessante, aber nicht immer mitreißende Lesart der Rolle.

Als Carl Bruner verkörpert Lucas Baier einen Antagonisten, der durch seine Zwiespältigkeit zwischen Loyalität und Verrat überzeugt. Er transportiert diese Spannung durch feine, nuancierte Momente und beeindruckt sowohl stimmlich als auch darstellerisch.
UZOH als Oda Mae Brown steht vor einer besonderen Herausforderung: Whoopi Goldbergs oscarprämierte, perfekt getimte Performance aus dem Film hat diese Rolle für immer definiert. UZOH ist merklich jünger als Goldberg damals und bringt entsprechend eine andere Energie mit. Das Comic-Timing, das bei dieser Rolle so entscheidend ist, sitzt nicht immer punktgenau, aber mit mehr Gelegenheit, in die Rolle hineinzuwachsen, und der Entwicklung eines eigenen Zugangs jenseits des Filmschattens, dürfte sich hier noch einiges entwickeln.

Ghost – Das Musical auf Tournee ist eine technisch versierte Produktion mit einem engagierten Ensemble, das unter den speziellen Bedingungen einer Arena-Tournee Beachtliches leistet. Die visuellen Lösungen sind clever (Licht Design: Michael Grundner), die Projektionen ermöglichen eine flüssige Erzählweise. Was der Inszenierung fehlt, ist einerseits der intime Rahmen eines echten Theaters und andererseits eine Partitur, die sich tiefer einprägt. Wer den Film liebt und die Geschichte von Sam und Molly auf der Bühne erleben möchte, wird dennoch unterhalten – sollte aber vielleicht nicht mit allzu großen Erwartungen an die musikalische Memorabilität herangehen. Es ist solides Musical-Handwerk, das seine Geschichte erzählt, ohne jedoch zu den Sternstunden des Genres zu gehören.
Review: GYPSY
Oper Halle

von Marcel Eckerlein Konrath
Es ist ein mutiger und lobenswerter Schritt der Oper Halle, Arthur Laurents und Jules Stynes Gypsy aus der – zumindest hierzulande – unverdient tiefen Versenkung zu holen. Dieses Musical über die ultimative Stage Mother Rose mit den Original Texten von Stephen Sondheim, die ihre Töchter June und Louise gnadenlos ins Rampenlicht prügelt, gehört zum Kanon des amerikanischen Musiktheaters. Dass es in Deutschland so selten zu sehen ist, mag auch daran liegen, dass die Titelrolle eine Herausforderung darstellt, die nur wenige zu meistern vermögen.
Brigitte Oelke wagt sich an diese Mammutaufgabe – und muss sich dabei am Vermächtnis von Legenden wie Ethel Merman, Angela Lansbury, Bernadette Peters und Patti LuPone messen lassen. Keine leichte Bürde. Schon in der legendären Ouvertüre setzt Regisseurin Louisa Proske ein kluges Signal: Der Vorhang öffnet sich kurz, und dort steht Oelke als Rose gefangen in bewegenden Lichtbahnen, eine Vorschau auf den finalen Nervenzusammenbruch in Rose’s Turn. Diese eine, erschütternde Nummer, in der Rose ihr ganzes verfehltes Leben in acht Minuten dekonstruiert, gehört zu den schwierigsten Partien des weiblichen Musical-Repertoires.
Rose ist keine eindimensionale Monster-Mutter. Sie ist getrieben von unerfüllten Träumen (Du wirst gebettet auf Rosen), von narzisstischer Liebe zu ihren Kindern und zugleich völliger Blindheit für deren eigene Bedürfnisse (Du kommst ja doch nicht los von mir). Sie ist manipulativ und verletzlich, rücksichtslos und verzweifelt, eine Frau, die in ihrer Obsession tragisch-grandios scheitert. Es ist diese Vielschichtigkeit, die die Rolle so außergewöhnlich macht: Rose muss Vitalität, Härte, Charme und am Ende zerreißende Verletzlichkeit verkörpern – und das fast ohne Pause, denn sie ist praktisch durchgehend auf der Bühne.
Brigitte Oelke gibt ihr Bestes und tut das mit erkennbarem Engagement und Eifer.. Sie singt gut, spielt mit Verve und schenkt der Produktion ihre ganze Energie. Und doch fehlt jener letzte Funke, der aus einer guten Leistung eine unvergessliche macht. Es sind Nuancen: ein gewisses Mehr an innerer Zerrissenheit, an dunkler Obsession, an gefährlichem Charisma hätte Oelkes Rose noch dreidimensionaler, noch beunruhigender werden lassen. Die Rolle verlangt nicht nur technisches Können, sondern eine fast selbstzerstörerische Hingabe – und genau hier bleibt man als Zuschauer ein wenig auf Distanz.

Umso erfreulicher, dass die Produktion insgesamt überzeugt. Was das Ensemble der Oper Halle unter der Regie von Louisa Proske hier auf die Bühne bringt, verdient Respekt – zumal Stadttheater heute mit knappen Mitteln wirtschaften müssen. Dies hier ist keine Sparversion, sondern eine ambitionierte, liebevoll ausgestattete Inszenierung. Darko Petrovic hat Bühne und Kostüme geschaffen, die den Glamour und die Tristesse der Vaudeville-Welt gleichermaßen einfangen. Marie-Christin Zeissets Choreografie verleiht den Show-Nummern den nötigen Schwung.
Eine echte Entdeckung ist Laura Magdalena Goblirsch als Louise, die sich zur legendären Stripperin Gypsy Rose Lee entwickelt. Goblirsch verkörpert die anfangs schüchterne, übersehene Tochter mit berührender Authentizität und wächst im zweiten Akt über sich hinaus (Lasst euch unterhalten). Charlotte Vogel gibt eine solide June, während Fabio Kopf als Tulsa tänzerisch glänzt – seine Nummer Nur das Mädchen fehlt dazu überzeugt auf ganzer Linie.

Gerd Vogel als Herbie, Roses langjähriger Verlobter und Agent, verkörpert den gutmütigen Verlierer mit sympathischer Präsenz und starkem Bariton, und auch die Nebenrollen sind durchweg gut besetzt: Tessie Tura/ Miss Cratchitt wird von Susanne Jansen gewitzt interpretiert. Das Ensemble, darunter Patric Seibert, Jonas Schütte, Robert Sellier und Julia Preußler liefert insgesamt ein starkes, lebendiges Bild des Showgeschäfts.
Ein kleiner Wermutstropfen bleibt – und das ist kein spezifisches Hallenser Phänomen: In Deutschland gibt es noch vergleichsweise wenige Kinder, die gleichzeitig singen, tanzen und schauspielern können. Isabella Mojzis und Aurelia Bucher in den Rollen von Baby June und Baby Louise zeigen jedoch viel Engagement. Der Unterschied zu den Profis auf dem Broadway ist spürbar, mindert aber keineswegs den Charme und die Energie, die sie auf die Bühne bringen.

Yonatan Cohen führt die Staatskapelle Halle mit großer Präzision und Einfühlungsvermögen durch Jules Stynes’ mitreißende Partitur. Unter seiner Leitung gelingt es dem Orchester, die rhythmischen Feinheiten, dynamischen Kontraste und die farbenreiche Instrumentation klar herauszuarbeiten, sodass die Spannung und Lebendigkeit der Musik vom ersten bis zum letzten Ton spürbar wird. Cohens Verständnis für den Charakter jeder Passage sorgt dafür, dass sowohl die melodischen Linien als auch die orchestralen Details in perfekter Balance zur Geltung kommen.
Gypsy in Halle ist vielleicht nicht makellos, aber eine wichtige und aausgesprochen sehenswerte Produktion. Sie erinnert daran, dass dieses Musical mehr ist als ein nostalgischer Blick auf die Vaudeville-Ära – es ist eine zeitlose Geschichte über Ehrgeiz, Scheitern und die Frage, wem die Träume gehören, die wir leben. Dass Brigitte Oelke sich diesem Monster von einer Rolle stellt, verdient Hochachtung. Dass die Oper Halle das Stück überhaupt zeigt, verdient Applaus.
Review: WICKED
Theater Baden bei Wien

von Marcel Eckerlein-Konrath
Es ist ein gewagtes Unterfangen: Das populärste Musical des 21. Jahrhunderts, Stephen Schwartz’ Wicked, in die Theatersprache Bertolt Brechts zu übersetzen. Regisseur Andreas Gergen, dessen enge künstlerische Verbindung zum Komponisten längst über eine bloße Werkstreue hinausgeht, hat sich am Theater Baden bei Wien dieser Herkulesaufgabe gestellt – mit einem Ergebnis, das so faszinierend wie widersprüchlich ausfällt.
Die Erfolgsgeschichte von Wicked beginnt 1995 mit Gregory Maguires Roman Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, einer radikalen Neuinterpretation von L. Frank Baums Oz-Universum. Stephen Schwartz, der Komponist von Godspell und Pippin, erkannte sofort das musikalische Potenzial dieser Geschichte zweier ungleicher Freundinnen, die zu Erzfeindinnen werden. 2003 feierte das Musical am Gershwin Theatre am Broadway Premiere und entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Bühnenwerke aller Zeiten. Die Vorgeschichte zum „Zauberer von Oz” entpuppt sich dabei als weit mehr als nur ein Prequel: Es ist eine vielschichtige politische Parabel über Machtverhältnisse, moralische Entscheidungen und die Frage, wie leicht sich Wahrheit manipulieren lässt. Im Zentrum stehen zwei junge Frauen mit entgegengesetzten gesellschaftlichen Startpunkten: die idealistische, unangepasste Elphaba mit ihrer grünen Haut, und die beliebte, ehrgeizige Glinda.
Das Theater Baden bei Wien, ehrwürdiges Stadttheater mit einer Geschichte, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, bietet eine überraschende Heimat für dieses Broadway-Spektakel. Hier, wo einst Mozart und Beethoven ein und aus gingen, schlägt Andreas Gergen eine Brücke zwischen kommerziellem Musiktheater und intellektuellem Regietheater – ein Spagat, der symptomatisch für die gesamte Inszenierung werden sollte.
Um Gergens Inszenierungsansatz zu verstehen, lohnt ein Blick auf die Grundlagen des epischen Theaters. Bertolt Brecht entwickelte in den 1920er und 1930er Jahren ein radikal neues Theaterkonzept. Statt Katharsis durch emotionale Identifikation suchte Brecht die kritische Distanz. Der berühmte Verfremdungseffekt (V-Effekt) sollte verhindern, dass das Publikum in der Illusion versinkt – durch Songs, die die Handlung unterbrechen, durch sichtbare Bühnentechnik, durch direkte Publikumsansprache, durch die Offenlegung der theatralen Mittel.
Das epische Theater ist im Kern politisches Theater: Es will nicht unterhalten, sondern aufklären; nicht berühren, sondern zum Denken anregen. Die Welt erscheint nicht als unveränderliches Schicksal, sondern als gestaltbar, veränderbar. Der Zuschauer soll nicht fragen „Was fühlt diese Figur?”, sondern „Warum handelt sie so? Könnte sie anders handeln?”

Gergen liest Wicked als deutlichen Kommentar auf politische Entwicklungen – sowohl vergangene als auch aktuelle. Der Zauberer von Oz ist in dieser Deutung kein skurriler Märchenherrscher, sondern ein Sinnbild autoritärer Führungsfiguren, wie sie im Europa der 1930er Jahre aufstiegen. Mit Propaganda, Angst und der Suche nach Sündenböcken gelingt es ihm, Kontrolle auszuüben und eine Gesellschaft gezielt zu spalten.
Mark Seibert verleiht dem Zauberer eine interessante, jüngere Note. Er spielt ihn nicht als alten Scharlatan, sondern als berechnenden Populisten – charmant genug, um seine Verführungskraft nachvollziehbar zu machen. Elphaba steht in diesem Gefüge für all jene, die nicht ins System passen: die Außenseiter, die Fremden, die Nonkonformen. Sie wird zum Opfer einer politisch wie medial gelenkten „Hexenjagd“, mit der das System seine Macht sichert. Ihr Rückzug in den Untergrund ist in Gergens Lesart kein Scheitern, sondern ein Akt von Freiheit und Integrität.
Diese Perspektive verleiht Wicked eine beklemmende Aktualität. Die Mechanismen, die das Stück offenlegt – das Schaffen von Feindbildern, die Erosion demokratischer Werte, die Sehnsucht nach einfachen Wahrheiten – sind keineswegs nur historische Phänomene. In Zeiten zunehmender Polarisierung, globaler Krisen und erstarkender populistischer Bewegungen gewinnt das Musical neue Brisanz. Glinda und Elphaba verkörpern zwei entgegengesetzte Strategien im Umgang mit einem Unrechtssystem: Anpassung oder Widerstand. Glinda arrangiert sich mit der Macht – aus Ehrgeiz, Angst oder Überforderung –, während Elphaba sich verweigert und den hohen Preis dafür zahlt.
Gergen bedient sich dabei der Mittel des epischen Theaters. Seine Inszenierung setzt auf eine offene, poetische und fragmentarische Form. Statt glitzernder Oz-Kulisse entsteht ein Raum, der zum Denken einlädt: Bewegungen erzählen, Choreografie wird zur Sprache. Musik und Tanz folgen diesem Ansatz – das große Spektakel bleibt zwar bestehen, wird aber stets durch einen reflektierten Unterbau gebrochen, der den Effekt nicht zum Selbstzweck werden lässt.
Ein nüchternes Baugerüst (Bühnenbild: Momme Hinrichs) statt Oz-Kitsch, Schauspieler, die Masken tragen, Glinda die nicht per Blase hereinschwebt, sondern auf eine Leiter klettert, Projektionen, die den konstruierten Charakter der Märchenwelt bloßlegen. Die Bühnentechnik bleibt größtenteils sichtbar, Kostümwechsel geschehen vor den Augen des Publikums. Gergen scheint entschlossen, das Musical gegen den Strich zu bürsten, seine politische Dimension schonungslos freizulegen.
Doch hier beginnt das Problem: Gergen folgt dieser Linie nicht konsequent. Immer wieder bricht er seine eigenen Regeln, lässt sich und das Publikum doch in die emotionale Sogwirkung von Schwartz’ Musik hineinfallen. „Frei und schwerelos” wird nicht verfremdet, sondern zelebriert – als die Broadway-Hymne, die sie nun einmal ist. Die Liebesgeschichten zwischen den Figuren werden nicht kritisch dekonstruiert, sondern sentimentalistisch ausgekostet. Die Inszenierung o(s)zilliert zwischen intellektuellem Anspruch und emotionalem Entertainment, ohne sich für eine Seite zu entscheiden.
Hier offenbart sich der fundamentale Unterschied zu den großen Regisseuren des politischen Theaters. Frank Castorf, der legendäre Volksbühnen-Intendant, hätte Wicked wahrscheinlich in einem vierstündigen Exzess völlig dekonstruiert, mit Live-Video, Indiesongs und einer radikalen Gesellschaftskritik, die das Musical als kapitalistisches Produkt selbst zum Thema gemacht hätte. Claus Peymann, der Brecht-Schüler und Handke-Freund, hätte vermutlich auf jegliche Inszenierung verzichtet und das Stück als konzertante Aufführung mit Leseprobe-Charakter präsentiert, um die Worte und die Musik sprechen zu lassen. Thomas Ostermeier, der gegenwärtig präsenteste Vertreter des politischen Regietheaters, hätte die Verfremdung wahrscheinlich subtiler eingesetzt – durch eine radikale Aktualisierung der politischen Bezüge, durch die Einbindung von Videomaterial oder durch eine naturalistische Spielweise, die den Pomp des Musicals ironisch und stilistisch bricht.
Gergen aber will beides: das Musical bewahren und es zugleich kritisch hinterfragen. Das Ergebnis ist eine Hybridinszenierung, die in den besten Momenten faszinierend schillert, in den schwächeren jedoch orientierungslos wirkt. Die Brecht’sche Verfremdung wird zum Stilmittel unter vielen, nicht zum durchgehenden Prinzip. Man könnte von „Verfremdung light” sprechen – genug, um sich als intellektuell zu profilieren, nicht genug, um wirklich zu stören.
Was diese Inszenierung über alle konzeptionellen Ungereimtheiten hinweg rettet, sind zwei herausragende Darstellerinnen. Laura Panzeri als Elphaba ist nichts weniger als eine Offenbarung. Mit einer Stimme, die an Kraft und Ausdrucksvermögen ihresgleichen sucht, macht sie aus der grünen Hexe eine tragische Heldin von shakespeareschem Format. Ihr Frei und schwerelos am Ende des ersten Aktes ist ein Moment reiner theatraler Magie – hier vergisst man alle Theorie und lässt sich einfach mitreißen. Panzeri gelingt das Kunststück, Elphabas Radikalisierung nachvollziehbar zu machen, ohne sie zu rechtfertigen oder zu verklären.

Vanessa Heinz als Glinda steht ihr in nichts nach. Ihre Glinda ist nicht die oberflächliche Blondine des Broadway-Klischees, sondern eine komplexe Figur, die zwischen Selbstinszenierung und Selbstzweifel changiert. Heinz verfügt über eine kristallklare Sopranstimme, die sowohl die komödiantischen als auch die dramatischen Momente der Partie mit scheinbarer Mühelosigkeit bewältigt. Ihr Heißgeliebt ist ein Kabinettstück physischer Komödie, komödiantisch timing-sicher und mit einer stimmlichen Präzision, die Respekt abnötigt.
Die Chemie zwischen den beiden Darstellerinnen ist spürbar und authentisch. Man nimmt ihnen die Freundschaft ab, und gerade deshalb schmerzt der Bruch. In einer Inszenierung, die oft auf Distanz setzt, schaffen Heinz und Panzeri Momente echter emotionaler Verbindung – und erinnern daran, warum dieses Musical Millionen Menschen berührt hat.
Anna Rosa Döller als Nessarose entwickelt eine bemerkenswerte Präsenz, die sich vor allem im zweiten Akt entfaltet. Mit einer schönen, ausdrucksstarken Stimme gibt sie der oft unterschätzten Rolle der Schwester Elphabas überraschende Tiefe und zeigt die tragische Dimension einer Figur, die zwischen Abhängigkeit und Machthunger zerrieben wird.

Beppo Binder liefert als Dr. Dillamond eine solide, einfühlsame Darstellung der Ziegen-Figur, die exemplarisch für die Unterdrückten steht. Jens Emmert als Boq fügt sich unaufdringlich ins Ensemble ein und erfüllt seine Aufgabe mit professioneller Zuverlässigkeit.
Problematisch wird es vor allem bei Timotheus Hollweg als Fiyero. Weder sängerisch noch darstellerisch gelingt es ihm, die Figur mit Leben zu füllen. Der charmante Rebell, der eigentlich Leichtigkeit, Verführungskraft und innere Zerrissenheit zugleich verkörpern sollte, bleibt erschreckend farblos. Hollweg wirkt unsicher in der Darstellung, seine Stimme fehlt es an Strahlkraft und Charakter. Wo Funken überspringen sollten, bleibt Leerlauf. Selbst seine solide tänzerische Leistung kann die Leere dieser Interpretation nicht kaschieren. Für eine so zentrale Rolle ist das schlicht zu wenig.
Maya Hakvoort als Madame Morrible, eigentlich eine Paraderolle für eine erfahrene Darstellerin, bleibt weit unter ihren Möglichkeiten. Vor allem schauspielerisch wirkt die Figur zu glatt, zu eindimensional. Der dämonische Bruch, den die Figur im zweiten Akt vollziehen sollte – von der scheinbar mütterlichen Mentorin zur skrupellosen Handlangerin der Macht –, wird nicht sichtbar. Hier fehlt die Abgründigkeit, die die Rolle dringend bräuchte.

Andreas Gergens Wicked am Theater Baden ist ein ambitioniertes Experiment, das wichtige Fragen aufwirft: Wer entscheidet, was gut und was böse ist? Welche Verantwortung trägt der Einzelne in einem kollektiven Machtgefüge? Und was bedeutet Zivilcourage in einer Welt, die lieber verurteilt als hinterfragt? Die Idee, ein kommerzielles Musical mit den Mitteln des epischen Theaters zu hinterfragen, ist reizvoll und angesichts der politischen Brisanz des Stoffes durchaus legitim. Doch Gergen scheut die letzte Konsequenz. Seine Inszenierung will das Musical nicht wirklich zerstören oder grundlegend neu denken – sie will es nur ein bisschen aufrauen, ihm einen intellektuellen Anstrich geben, dabei aber die Mittel des Musiktheaters nutzen, um zu berühren, zu unterhalten und zum Denken anzuregen. Das Ergebnis ist etwas widersprüchlich: Für Puristen des Musiktheaters zu kopflastig und sperrig, für Anhänger des Regietheaters zu zahm und kompromissbereit. Es ist eine Inszenierung, die mehr verspricht, als sie einlöst – aber gerade in diesem Spannungsfeld auch faszinierende Momente schafft. Dass der Abend dennoch auf beeindruckende Weise funktioniert, liegt am exzellenten Kern des Ensembles, allen voran Laura Panzeri und Vanessa Heinz, die beweisen, dass großes Musiktheater auch in konzeptionell gewagten Inszenierungen möglich ist. Sie sind es, die dem Publikum einen Grund geben, wiederzukommen – und sie erheben diesen Abend trotz aller Ungereimtheiten zu einem denkwürdigen Theatererlebnis.

Am Ende bleibt die Frage: Braucht Wicked eine Brecht’sche Verfremdung? Ist das Musical nicht bereits subversiv genug in seiner Infragestellung von Gut und Böse, in seiner Kritik an Propaganda und Autoritätshörigkeit? Vielleicht ist die ehrlichste Form der Inszenierung diejenige, die sich dem emotionalen Sog des Werkes hingibt, statt ihn intellektuell einzuhegen. Oder vielleicht hätte Gergen noch radikaler sein müssen – ganz Brecht oder gar nicht. So bleibt diese Produktion ein Hybrid, ein Kompromiss: interessant, diskussionswürdig, getragen von zwei außergewöhnlichen Darstellerinnen, aber nicht restlos überzeugend. Ein Theater-Experiment, das zeigt, dass gute Absichten und interessante Ideen nicht automatisch zu großem Theater führen. Aber vielleicht ist auch das eine wichtige Erkenntnis – und im Sinne Brechts durchaus produktiv. Gerade im Märchenhaften liegt die Möglichkeit, komplexe gesellschaftliche Fragen in greifbarer Form zu erzählen und diese Produktion beweist: Das Gespräch darüber hat gerade erst begonnen.
Review: COME FROM AWAY
Deutsches Theater München


von Marcel Eckerlein-Konrath
Was für ein Abend. Was für ein Ensemble. Was für ein Geschenk von einem Musical.
Mit Come From Away ist dem Theater Regensburg unter der kongenialen Regie von Sebastian Ritschel ein bewegendes, zutiefst menschliches Bühnenerlebnis gelungen, das nicht nur berührt sondern mitten ins Herz mit voller Wucht trifft: nicht durch Spektakel, sondern durch Wärme, Tiefe und eine ungewöhnlich große Menschlichkeit. Nun ist die Erfolgsproduktion zu Gast im Deutschen Theater München, und das Publikum dankt es mit stehenden Ovationen und ehrlichen Tränen. Völlig zu Recht.
Das Stück von Irene Sankoff und David Hein basiert auf wahren Ereignissen. Nach den Anschlägen des 11. September 2001 mussten 38 Flugzeuge auf dem kleinen Flughafen von Gander, Neufundland, notlanden. Über 6.500 Menschen aus aller Welt strandeten dort und wurden von den 10.000 Einwohnern mit offenen Armen aufgenommen. Innerhalb von fünf Tagen entstanden Freundschaften, tiefe Verbindungen – und Erfahrungen, die niemand je vergessen sollte.
Ritschel gelingt das Kunststück, diese große, globale Geschichte ganz leise zu erzählen. Ohne Melodramatik, ohne Pathos, dafür aber mit großer Klarheit, Struktur und einem bemerkenswerten Gespür für emotionale Wahrhaftigkeit. Es gibt keine Hauptfiguren, keine Helden im klassischen Sinn. Und doch steht am Ende eine ganze Gemeinschaft im Mittelpunkt – auf der Bühne und im Zuschauerraum.
Das Herzstück dieser Inszenierung ist das Ensemble, das mit überwältigender Geschlossenheit und Präsenz agiert. Es gibt keine schwachen Momente, kein Nebeneinander; alle arbeiten sichtbar füreinander, miteinander. Jede und jeder wechselt mehrfach die Rolle, springt zwischen Einwohnern und „Plane People“, wechselt Haltungen, Temperamente und bleibt dabei stets glaubwürdig. Diese Wandelbarkeit ist nicht nur technisch beeindruckend, sondern in ihrer Leichtigkeit schlicht berührend.

Wietske van Tongeren als Beverley Bass, die erste Kapitänin von American Airlines, verleiht ihrem großen Solo “Me and the Sky“ eine schmerzhafte Aufrichtigkeit – eine Karrierefrau, die sich plötzlich selbst neu verorten muss.
Masengu Kanyinda berührt als Hannah mit einer stillen, tief empfundenen Präsenz. Ihre Verzweiflung um den Sohn, von dem es kein Lebenszeichen gibt, trifft mitten ins Herz.
Andreas Bieber und Alejandro Nicolás Firlei Fernández geben als das schwule Paar Kevin T. und Kevin J. eine fein gezeichnete Darstellung zweier Männer, deren Beziehung in der Ausnahmesituation zu bröckeln beginnt. Ihre Szenen sind leise, voller Zwischentöne und genau deshalb so stark.
Patricia Hodell als Beulah ist eine Offenbarung an Herzenswärme, Pragmatismus und trockenem Humor. Jogi Kaiser und Maria Mucha lassen als das frisch verliebte Paar Nick und Diane spürbar werden, wie sich zwischen zwei Fremden in kürzester Zeit echte Nähe entwickeln kann.
Hinzu kommen Lionel von Lawrence, Felix Rabas, Scarlett Pulwey, Fabiana Locke und Benedikt Eder – allesamt mit mitreißender Bühnenenergie, stets präsent, ob als Busfahrer, Reporterin, Tierärztin oder jüdischer Passagier.
Jeder einzelne Moment ist fein gearbeitet und voller Wahrhaftigkeit. Gemeinsam bilden sie ein Geflecht aus Stimmen, Körpern, Persönlichkeiten – ein Ensemble, das sich wie ein einziger, vielstimmiger Atem anfühlt. Sie alle tragen das Stück gemeinsam, erzählen große Geschichten mit kleinen Gesten. In dieser Produktion gibt es keine Hauptrollen im klassischen Sinne und gerade das macht ihren Zauber aus. Ein durch und durch gleichwertiges Ensemble, das in jeder Konstellation überzeugt und mit bewegenden, ehrlichen Momenten eine Sternstunde nach der anderen schafft.
Die Bühne von Kristopher Kempf ist reduziert, fast karg – Holzstühle, Tische. Doch aus dieser Reduktion entsteht eine Dichte, die fast körperlich spürbar ist. Jede Szene geht nahtlos in die nächste über. Mit minimalem Aufwand entstehen Busfahrten, Flugzeuggänge, Warteräume und provisorische Notunterkünfte. Es ist faszinierend, wie ein kurzer Lichtwechsel (gestaltet von Maximilian Rudolph) plötzlich ganze Räume und Welten öffnet.
Die Choreografie von Gabriel Pitoni bleibt bewusst zurückgenommen – sie lebt von kleinen Gesten, beiläufigen rhythmischen Bewegungen, einem Luftholen. Nichts wirkt künstlich oder plakativ, alles ergibt sich ganz organisch aus dem Spiel.
Musikalisch führt Ben Weishaupt die exzellent aufspielende Band mit sicherer Hand durch das abwechslungsreiche Spektrum der Partitur. Von gälischen Folkmotiven über erdige Poprhythmen bis zu stillen, fast meditativen Momenten: die Musik ist hier nicht nur Begleitung, sondern treibende Kraft der Erzählung.
Was diesen Abend so besonders macht, ist die emotionale Aufrichtigkeit, mit der hier gespielt, erzählt und gesungen wird. Man lacht, man schluckt, man hat Tränen in den Augen – und am Ende steht man, überwältigt und tief bewegt. Come From Away ist kein Musical über eine Katastrophe. Es ist ein Musical über das, was danach möglich ist. Über Begegnung. Freundschaft. Hoffnung. Und über die unerschütterliche Kraft von Mitgefühl.
Dass das Theater Regensburg diese Produktion mit solch einem Niveau und solcher Liebe auf die Bühne bringt, ist ein großes Geschenk.
Gerade in einer Welt, die oft von Unsicherheit und Abgrenzung geprägt ist, zeigt Come From Away eindrucksvoll, dass Mitgefühl im Kleinen beginnt. Es braucht kein großes Heldentum: manchmal reicht es, einfach da zu sein und die Tür zu öffnen.

Review: LA CAGE AUX FOLLES
Staatstheater Nürnberg


von Marcel Eckerlein-Konrath
In einer Zeit, in der Bundestagsabgeordnete wie Julia Klöckner im Brustton der Überzeugung fordern, die Regenbogenflagge nicht mehr vor Bundesministerien wehen zu lassen, setzt das Staatstheater Nürnberg mit La Cage aux Folles ein leuchtendes Zeichen für Liebe, Freiheit und Sichtbarkeit – mit Glitzer, Humor, sehr viel Herz und allen leuchtenden Farben des Regenbogens.
Regisseurin und Choreografin Melissa King gehört längst zu den innovativsten Stimmen auf deutschen Bühnen. In ihrer Inszenierung wird schnell klar: Sie will nicht nur unterhalten, sondern Haltung zeigen, einen queeren Raum schaffen, der warm, lebendig und politisch ist. „Ich wollte diese Tatsachen nicht einfach beiseiteschieben und das Stück in den achtziger Jahren belassen, als wenn wir heute mit dieser Problematik nichts mehr zu tun hätten. Es hat mit uns zu tun, und deswegen habe ich es in die Gegenwart geholt.“ Und die Gegenwart, das zeigt King ganz bewusst, ist ambivalent. Zwar ist Drag durch Formate wie RuPaul’s Drag Race, Serien wie Pose oder Transparent im Mainstream angekommen, doch die politische Realität sieht oft anders aus. Hate Speech, Übergriffe, gesetzliche Rückschritte – nicht nur in Polen oder Italien, auch mitten in Deutschland. Der Streit um eine Prideflagge vor dem Bundesministerium, ist kein Randthema. Es ist symptomatisch für ein Klima, in dem queere Sichtbarkeit plötzlich wieder erklärungsbedürftig wird.
Gegen dieses Klima stemmt sich die Nürnberger Inszenierung mit aller Kraft, ohne zu moralisieren. King hat sorgfältig recherchiert, sich von Künstler*innen wie Billy Porter, Sasha Velour oder Taylor Mac inspirieren lassen. Für sie ist Drag ein „Mittel, dem Mainstream zu sagen: Wenn ihr uns nicht wahrnehmt, dann zwingen wir euch, hinzusehen.“ Ihre Cagelles sind nicht nur herrlich schrille Paradiesvögel, sondern individuell, genderfluid und somit ganz verschieden. Sie spielen dabei mit Klischees, ohne sich auf sie zu reduzieren. So wird aus Revue politische Performance, aus Glitzer eine Haltung. Das Bühnenbild von Stephan Prattes spiegelt diese Idee auf mehreren Ebenen wider. Herzen, Regenbogen, stilisierte Geschlechtsorgane als wiederkehrende Motive, charmant, witzig und subtil eingesetzt. Die Cagelles treten in Kostümen auf, die an die detailverliebte Verspieltheit einer Marina Hoermanseder erinnern – Prattes hat hier sichtlich mit viel Passion gearbeitet. Ebenso stark: Terry Alfaro als Zofe Jacob, der in diesen Kostümen ein komisches und visuelles Highlight nach dem anderen setzt.

Die Uniformen des stockkonservativen Ehepaars Dindon (sehr pointiert gespielt von Thorsten Tinney und Kira Primke) erinnern in Farbwahl und steifer Formensprache frappierend an das Auftreten jener politischen Kräfte, die in Talkshows gern von „Tradition“ sprechen und in Wirklichkeit ein Weltbild propagieren, das Vielfalt als Bedrohung sieht.
Im Zentrum aber stehen zwei Menschen, die sich lieben. Marin Berger als Georges und Gaines Hall als Albin: ein Paar, das getragen ist von Zärtlichkeit, Wärme, aber auch realer Reibung. Berger überzeugt mit stiller Fürsorge, man glaubt ihm jede Geste. Wenn er seinem Partner den Rücken stärkt oder für seinen Sohn kämpft, dann wirkt das wie echte gelebte Erfahrung. Hall hingegen gibt den großen Entertainer mit manchmal etwas zu sehr Boulevard, manchmal fehlt die Tiefe, aber wenn er Ich bin, was ich bin singt, dann gehört die Bühne ihm allein. Dieser Song ist kein Musicalmoment mehr , sondern eine Hymne. Eine Kampfansage. Eine Umarmung. Dieser Song, längst losgelöst von seinem Musicalkontext, entfaltet hier seine ganze Wucht. Hall macht aus dieser Nummer eine Selbstermächtigung, ein unmissverständliches „Hier bin ich“ – für Albin, für Drag-Künstler*innen, für queere Menschen, für alle, die sich erklären und rechtfertigen mussten, nur weil sie sie selbst sind. Seit über vier Jahrzehnten steht dieser Song für Stolz, Verletzlichkeit und Widerstand. Und in diesem Moment wird er zum emotionalen Höhepunkt des Abends und zum perfekten Ende des ersten Aktes.
Ein besonderer Lichtblick: Fabio Kopf als Jean-Michel. Die Rolle ist dramaturgisch oft undankbar, doch Kopf macht daraus etwas Eigenes: Mit klarer Stimme, aufrichtiger Emotion und natürlicher Präsenz wird seine Entwicklung vom fordernden zum dankbaren Sohn zu einem der berührendsten Bögen des Abends. Kopf spielt ihn mit aufrichtigem Ernst, sein Gesang ist kraftvoll, seine Präsenz unaufdringlich. Er ist ein starker junger Schauspieler, der aus einer eher unterentwickelten Nebenfigur einen Menschen macht.
Die Historie von La Cage aux Folles ist selbst ein kleines Wunder. Ursprünglich ein französisches Theaterstück, dann ein Überraschungshit im Programmkino und schließlich 1983 ein Broadway-Musical, das gegen alle Widerstände zum Erfolg wurde. In einer Zeit, als AIDS Panik und Homophobie schürte, erzählte es von einem homosexuellen Paar, das seit 20 Jahren zusammenlebt und ein Kind großgezogen hat – mit Liebe, Verantwortung, Humor.

King erinnert daran, dass die queere Community immer auch politisch war: „The personal is political – das gilt auch für Drag. Ich wollte zeigen, dass es nicht nur um Glitzer geht, sondern um Ausdruck, um Kampf, um ein Sich-Behaupten gegen das Unsichtbarmachen.“
Man kann der Inszenierung vorwerfen, sie sei stellenweise plakativ. Ja, manche Bilder sind überdeutlich, manches wirkt bewusst auf Provokation hin gebaut. Doch in der heutigen politischen Lage ist genau das vielleicht nötig. Es ist keine Zeit für Andeutungen.
Wir leben in einer Zeit, in der queeres Leben erneut in Frage gestellt, Sichtbarkeit wieder zur Provokation wird und das öffentliche Bekenntnis zur Vielfalt von bestimmten politischen Kräften systematisch diffamiert wird. In so einer Lage darf Theater nicht flüstern. Es muss laut sein dürfen und Haltung zeigen und dabei glitzern, tanzen, schreien, fordern.
Melissa Kings Inszenierung von La Cage aux Folles tut genau das. Sie ist bewusst überzeichnet, bewusst bunt, bewusst politisch. Sie macht keine Kompromisse, wenn es um Haltung geht. Und sie stellt sich ganz klar gegen ein Weltbild, das Menschen in enge Kategorien pressen und alles Abweichende unsichtbar machen will. Deshalb ist diese Produktion nicht nur ästhetisch reizvoll, sie ist auch gesellschaftlich relevant: ein notwendiges Statement in einer Zeit, in der Drag-Lesungen verboten, queere Flaggen abgehängt und Debatten über „natürliche Rollenbilder“ wieder salonfähig werden.
Diese Inszenierung ist kein nostalgischer Rückblick auf ein Musical aus den 80ern – sie ist ein Kommentar zum Jetzt. Und ein Plädoyer für eine Zukunft, in der Menschen lieben dürfen, wen sie wollen, und leben dürfen, wie sie sind. Sie fragt uns: Was bedeutet Familie wirklich? Wer hat das Recht, sichtbar zu sein? Und was tun wir, wenn die Räume enger werden?
La Cage aux Folles in Nürnberg ist nicht nur eine Hommage an ein Stück Theatergeschichte. Es ist eine Erinnerung daran, dass Bühne Widerstand leisten kann und muss. Und dass sie dabei das Wichtigste nicht aus den Augen verliert: die Liebe.
Gerade jetzt brauchen wir beides.


Review: ELISABETH – DAS MUSICAL
in der Schönbrunn-Version Theater des Westens, Berlin


von Marcel Eckerlein-Konrath
Ich gehör nur mir – Ein Abend mit Elisabeth im Theater des Westens
Es gibt Musicals, die kommen und gehen – und dann gibt es Elisabeth. Seit seiner Uraufführung 1992 in Wien hat sich das Werk von Michael Kunze (Buch und Liedtexte) und Sylvester Levay (Musik) zu einem wahren Dauerbrenner entwickelt. Trotz zunächst durchwachsener Kritiken zur Premiere, fand Elisabeth rasch ihren Weg in die Herzen eines internationalen Publikums. Karl Löbl, eine prominente Stimme der österreichischen Kulturkritik, äußerte sich unmittelbar nach der Weltpremiere: Das Publikum ist enthusiasmiert. Ich selbst bins nicht ganz. Heute gilt das Stück als das erfolgreichste deutschsprachige Musical aller Zeiten. In Berlin machte nun die Tourversion Station – in einer konzertanten Fassung im ehrwürdigen Theater des Westens, mit einem imposanten, sichtbar auf der Bühne platzierten Orchester.
Klanglich ein Fest für die Sinne: Unter der präzisen und einfühlsamen Leitung von Bernd Steixner entfaltet sich der musikalische Kosmos von Sylvester Levay in all seiner Pracht. Doch genau hier liegt auch die Kraft dieser Interpretation: Die Musik ist keine bloße Kulisse, sondern emotionales Rückgrat der Inszenierung, das Elisabeths Lebensweg nicht nur begleitet, sondern musikalisch erzählt. Trotzdem: bei aller orchestralen Wucht: gelegentlich geriet die Balance aus dem Gleichgewicht. Mehr als einmal übertönte das Orchester das Ensemble, sodass insbesondere in den Ensembleszenen Textverständlichkeit auf der Strecke blieb. Wer das Stück nicht ohnehin mitsingen kann – und das dürfte bei dieser treuen Fanbase nicht wenige betreffen – hatte mitunter Mühe, dem Geschehen zu folgen.
Im Zentrum der Inszenierung aber: Sofie De Schryver als Elisabeth – eine wahre Entdeckung. Mit frischer Energie haucht sie der ikonischen Figur neues Leben ein. Sie balanciert die emotionalen Extreme der Kaiserin von Österreich mit beeindruckender Leichtigkeit: charmant und zerbrechlich in den Jugendjahren, stolz und unnahbar als gekrönte Frau, hart und abweisend gegenüber ihrem Sohn Rudolf – und zugleich immer getrieben vom verzweifelten Wunsch nach Selbstbestimmung. Ihr „Ich gehör nur mir“ – das emotionale Zentrum des Musicals – gelingt herzzerreißend schön: gesanglich makellos, lupenrein intoniert, fein nuanciert interpretiert und mit einer Intensität, die tief berührt. Mit scheinbarer Mühelosigkeit meistert sie selbst die teilweise schwindelerregenden Höhen der Partitur – Töne, bei denen andere kämpfen, lässt sie aufblühen, mit einer Stimme, die beeindruckt. Es ist einer dieser seltenen Musicalmomente, in denen Musik, Text und Interpretation zu einer Einheit verschmelzen. Sofie De Schryver bringt nicht nur stimmliche Brillanz, sondern auch eine besondere Aura mit auf die Bühne – eine Mischung aus verletzlicher Eleganz und unbeugsamer Stärke, die sie zur idealen Elisabeth macht und ihr ein neues Gesicht verleiht.

Etwas blass bleibt Lukas Mayer in der Rolle des Tod. Zwar verfügt er über eine gute Stimme und singt technisch sauber, doch es fehlt seiner Interpretation an jener dunklen Faszination und mysteriösen Anziehungskraft, die diese schillernde Figur so besonders macht. Wo man sich ein wenig mehr Verführung, Abgründigkeit und emotionale Spannung wünschen würde, bleibt seine Darstellung eher zurückhaltend und kontrolliert. Ein Ansatz, der zwar interessant gedacht ist, in der Umsetzung jedoch nicht ganz die emotionale Tiefe und dramaturgische Präsenz entfaltet, die dem personifizierten Tod als Gegenspieler Elisabeths innewohnen sollte.
Sehr überzeugend und mit feinem Gespür für Nuancen gestaltet Dennis Henschel die Rolle des Kaiser Franz Joseph. Sein warm timbrierter Bariton trägt mühelos durch den Raum und verleiht der Figur eine eindrucksvolle stimmliche Präsenz. Technisch sicher und mit großem musikalischem Feingefühl singt er, stets auf den emotionalen Kern fokussiert. Besonders hervorzuheben ist seine differenzierte darstellerische Leistung: Henschel zeichnet ein vielschichtiges Porträt des jungen Kaisers, der zu Beginn der Handlung noch Idealismus und Hoffnung in sich trägt, später jedoch zunehmend unter der Last von Krone, Pflicht und familiären Spannungen zerbricht. Er zeigt Franz Joseph nicht als kalten Machtmenschen, sondern als tragische Figur – zerrissen zwischen Staatsräson und privatem Scheitern, zwischen tief empfundener Liebe zu Elisabeth und der Unfähigkeit, ihr die Freiheit zu schenken, nach der sie sich sehnt. Gerade in den stilleren Momenten – etwa in der Konfrontation mit Elisabeth (Boote in der Nacht) oder beim Blick auf das Schicksal seines Sohnes Rudolf – gelingt es Henschel, große emotionale Tiefe mit stiller Würde zu verbinden. So entsteht ein berührender Kontrapunkt zu Elisabeths innerem Aufbegehren – einer, der das Kaiserpaar nicht nur als Gegensätze, sondern als tragisch verbundene Seelen erfahrbar macht. Dennis Henschel liefert damit nicht nur gesanglich, sondern auch darstellerisch eine der stärksten Leistungen des Abends.
Weniger einprägsam bleibt leider Robin Reitsma als Lucheni, der Erzähler und Attentäter in Personalunion. Zwar verfügt er über eine ordentliche Gesangstechnik, doch seine Interpretation der zentralen Figur des Stücks bleibt hinter den Erwartungen zurück. Lucheni, der in Elisabeth nicht nur als Mörder, sondern auch als Kommentator der Ereignisse fungiert, verlangt nach einem Schauspieler, der die Grenze zwischen Zynismus und Faszination auf faszinierende Weise ausschöpft. Doch bei Reitsma fehlt dieser bissige, scharfsinnige Unterton, der diese Rolle so außergewöhnlich macht. Der bissige Humor und die giftige Ironie, die Lucheni zu einem der faszinierendsten Charaktere des Musicals machen, kommen in seiner Darbietung nicht zum Tragen (Kitsch). Die Rolle lebt von einem subversiven Charme, der hier leider zu wenig spürbar ist. Lucheni wird somit mehr zu einem Beobachter als zu einem wahren Antagonisten, der mit seiner zynischen Weltsicht das Publikum in den Bann zieht.
Die Nebenrollen bieten ein durchwachsenes Bild: Masha Karell punktet als Erzherzogin Sophie mit einer soliden Leistung und überzeugt vor allem in ihrem Bellaria Solo. Dennis Hupka hingegen bleibt in der Rolle Rudolfs blass – weder stimmlich noch darstellerisch kann er der tragischen Figur Elisabeths Sohnes ausreichend Tiefe verleihen. Sein Solo Wenn ich dein Spiegel wär bleibt schwach. Claus Dam, bereits bei der deutschen Uraufführung in Essen als Vater Max auf der Bühne, wirkt in dieser Tourfassung müde, fast wie auf Autopilot. Man spürt die Routine – und vermisst den Funken.
Die konzertante Fassung mit großflächigen Projektionen und reduziertem Bühnenbild setzt klugerweise den Fokus auf die Musik und das Ensemble. Visuell bleibt das Ganze eher dezent – aber das passt, denn Elisabeth war immer ein Stück, das in seinen besten Momenten von innerer Dramatik und musikalischer Kraft lebt.
Historisch betrachtet bleibt das Musical trotz dichter Atmosphäre eine freie Interpretation: Die echte Elisabeth war komplexer, politischer, kultivierter – eine Reisende, eine Dichterin, eine von ihrer Zeit entfremdete Kaiserin. Der Film Sissi mit Romy Schneider hat ein bis heute wirkmächtiges, verklärtes Bild geschaffen. Kunzes Elisabeth dagegen ist eine Frau im Widerstand gegen ein System, gegen Erwartungen, gegen ein Leben in Gefangenschaft. Ein faszinierender Gegensatz.
Heute blickt das Musical auf eine riesige Fangemeinde – von Japan bis Ungarn, von Wien bis Seoul. Die Musik ist längst Kult, die Texte in Herz und Hirn ganzer Generationen eingebrannt. Die aktuelle Tourfassung mag an manchen Stellen Schwächen offenbaren – doch im Kern bleibt Elisabeth das, was es schon lange ist: ein bewegendes, musikalisch brillantes Portrait einer Frau, die sich nicht beugen ließ. Eine, die sich selbst gehörte.


Review: Disneys DIE EISKÖNIGIN
Palladium Theater Stuttgart


von Marcel Eckerlein-Konrath
Wenn der Vorhang fällt und man für einen Moment vergisst, dass man im Theatersessel sitzt – dann hat ein Abend etwas richtig gemacht. Die Eiskönigin im Palladium Theater in Stuttgart schafft genau das: Es entführt in eine Welt aus Eis und Emotion, bleibt nah an der beliebten Filmvorlage und erzählt doch auf eigene, tiefere Weise weiter. Keine bloße Imitation, sondern ein Musical mit Haltung, Herz – und einer klaren Botschaft.
Es ist eine emotionale Reise, die ganz von der Beziehung zweier Schwestern lebt: so gegensätzlich sie auch sind, verbindet sie ein tiefes, unausgesprochenes Band. Ihre Verbindung steht unangefochten im Zentrum der Inszenierung und verleiht der Geschichte ihre emotionale Wucht. Elsa besitzt magische Kräfte, die sie nicht kontrollieren kann. Als sie versehentlich den ewigen Winter über ihr Königreich Arendelle bringt, flieht sie in die Einsamkeit. Ihre jüngere Schwester Anna macht sich auf eine abenteuerliche Reise, um Elsa zurückzuholen…
Regisseur Michael Grandage bringt die Essenz der Geschichte treffend auf den Punkt: „Das Bemerkenswerte am Genie [der Geschichte] ist, dass es zunächst wie ein klassisches Disney-Märchen daherkommt – und dann alle Erwartungen sprengt. Die Idee, dass am Ende die familiäre Liebe im Mittelpunkt steht, ist ein wunderbarer Ansatz, dem wir auf der Bühne nachgehen konnten.“
Und genau das tut er: Grandage inszeniert Die Eiskönigin nicht als glitzerndes Spektakel, sondern als modernes Märchen über Verantwortung, Angst, Selbstermächtigung – und vor allem über Liebe. Die Beziehung zwischen Anna und Elsa steht dabei klar im Zentrum und gewinnt in der Bühnenfassung noch mehr emotionale Tiefe als im Film.
Dabei fällt auf, wie viele der kleinen Logikbrüche aus dem Animationsfilm hier elegant ausgebessert wurden: Elsas innere Kämpfe sind greifbarer, Annas Motivation nachvollziehbarer. Die Handlung wirkt runder, die Figuren erhalten mehr Raum – ohne dass der märchenhafte Drive der Vorlage verloren ginge.
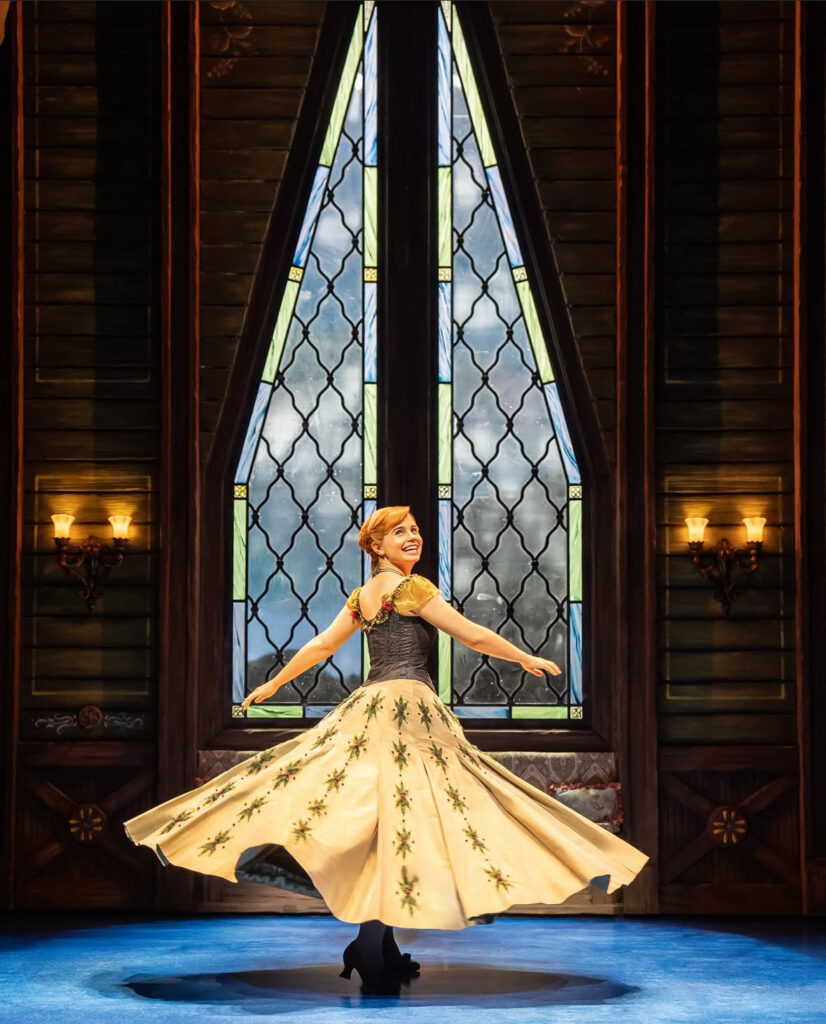
Kim Fölmli ist als Anna ein Ereignis und bringt eine ganz und gar unkonventionelle Note auf die Bühne. Sie ist alles andere als die typische Prinzessin: quirlig, impulsiv, voller Witz und dabei stets glaubwürdig. Ihre Anna denkt und handelt aus dem Bauch heraus, fällt hin, steht wieder auf – mit einem kindlichen Mut und einer Offenheit, die berührt. Förmli spielt diese Mischung aus jugendlichem Übermut und echter Verletzlichkeit mit beachtlicher Präzision. Sie findet genau den richtigen Ton zwischen komödiantischer Leichtigkeit und tiefer Emotionalität – etwa in Momenten, in denen Annas Einsamkeit durchbricht oder ihr kindlicher Glaube an das Gute wankt. Gesanglich überzeugt sie mit einer klaren, ausdrucksstarken Stimme, die selbst in den lauteren Nummern nie überzeichnet wirkt, sondern eine ehrliche Wärme behält.
Fölmli ist ein Geschenk an diese Inszenierung. Ihre Darstellung lebt von einem natürlichen, fast mühelosen Charme, der das Publikum sofort auf ihre Seite zieht. Sie spielt nicht „frech“, sie ist es – aber mit so viel Herz, Wärme und Witz, dass man ihr einfach alles abnimmt. Besonders spürbar wird ihr Talent für Timing und feine Komik im Song Zum ersten Mal seit Ewigkeiten, wenn sie mit kindlicher Aufregung durch das Schloss tanzt, bei dem jedes Stolpern, jede kleine Geste sitzt, ohne kalkuliert zu wirken. Das ist perfektes comic timing. Und wenn später das Duett Liebe, sie öffnet Tür’n mit dem zwielichtigen Hans erklingt, zeigt Fölmli eine wunderbar selbstironische Leichtigkeit. Sie spielt die überstürzte Verliebtheit mit so viel Spielfreude, dass man gleichzeitig lachen und ihr eine Umarmung anbieten möchte.
Doch sie kann auch anders. In Du bist alles, dem gefühlvollen Duett mit Elsa, offenbart sie eine tiefer liegende emotionale Seite. Hier blitzt zwischen aller Leichtigkeit plötzlich große Ernsthaftigkeit auf: die Sehnsucht nach Nähe, die Verzweiflung über die wachsende Distanz zur Schwester. Fölmli gelingt es, diese emotionale Öffnung mit genau der Aufrichtigkeit zu spielen, die der Moment braucht: berührend, ehrlich, ohne einen Hauch von Pathos.
Gerade in ihrer Vielstimmigkeit wirkt Fölmlis Anna so glaubwürdig. Sie wechselt mühelos zwischen Komik und Ernst, zwischen Übermut und echter Verletzlichkeit. Ihr Spiel ist facettenreich, aber nie ausgestellt, denn jede Reaktion, jede Pointe scheint aus dem Moment heraus zu entstehen. So entsteht eine Figur, die nicht gespielt wirkt, sondern gelebt. Man glaubt ihr jede Sekunde – weil sie gar nicht versucht, zu beeindrucken. Und genau darin liegt ihre große Stärke.
Ann-Sophie verleiht Elsa eine stille, majestätische Präsenz – eine Figur, die nicht laut werden muss, um Eindruck zu hinterlassen. Ihre Elsa ist beherrscht, zurückgenommen, von einer inneren Anspannung durchzogen, die man förmlich greifen kann. Unter der makellosen Fassade lodert ein Feuer aus Angst, Schuld und Sehnsucht – und gerade dieses kontrollierte Ringen macht sie so berührend.
Ann-Sophie spielt nicht, sie hält dagegen – mit aufrechter Haltung, klarer Mimik, jedem Zentimeter Körper Spannung. Und wenn sie singt, bricht diese Zurückhaltung wie unzählige Eisschichten. Lass jetzt los wird bei ihr nicht nur zur Befreiung, sondern zur existenziellen Selbstoffenbarung. Es ist der Moment, in dem Elsa sich zum ersten Mal erlaubt, ganz sie selbst zu sein. Ohne Rücksicht. Ohne Entschuldigung. Ein Aufschrei ins eigene Schweigen.
Stimmlich balanciert sie eindrucksvoll zwischen Zerbrechlichkeit und Kraft. Ihre Stimme erhebt sich und trägt durch ein Arrangement, das auf überflüssiges Pathos verzichtet und dem Lied die Würde und Weite gibt, die es braucht. Visuell präzise und klug inszeniert, entfaltet sich ein Gänsehautmoment, der über das bekannte Disney-Bild hinausweist.

Auch Monster, der für die Bühnenfassung neu geschriebene Song im zweiten Akt, wird bei Ann-Sophie zur dramatischen Klammer der Figur. Hier bekommt Elsas innere Zerrissenheit endlich Worte – ihre Angst, anderen zu schaden, ihre Verzweiflung, nicht dazugehören zu können. Es ist ein Moment der Selbstkonfrontation, ein Blick in den Abgrund, der weit über die Vorlage hinausgeht. Dass dieser Song nicht einfach ein Zusatz, sondern dramaturgisch klug gesetzt ist, verleiht Elsas Entwicklung eine neue Tiefe.
Gemeinsam bilden Anna und Elsa das emotionale Rückgrat des Abends – zwei Frauen, die auf völlig unterschiedliche Weise ihren Platz in der Welt suchen und erst über ihre Verbindung zueinander zu sich selbst finden. Es ist diese Schwesternliebe, die das Stück trägt – nicht als kitschige Botschaft, sondern als ehrlich erlebte Beziehung mit Höhen, Brüchen und einem zutiefst menschlichen Kern.
Auch das restliche Ensemble überzeugt. Jonathan Hamouda Kügler als Kristoff ist bodenständig charmant, Kaj-Louis Lucke als Olaf ein komödiantisches Geschenk, das mit perfektem Timing und viel Herz brilliert, ohne je ins Überdrehte abzurutschen. Und dann wäre da noch Paolo Ava, der als Rentier Sven nahezu unsichtbar sichtbar ist – eine physische Meisterleistung, die den tierischen Begleiter auf poetische Weise lebendig macht.
Einzige echte Schwachstelle: Simon Loughton als Hans. Während die Figur dramaturgisch ohnehin nie über die eindimensionale Disney-Schurkenrolle hinauswächst, bleibt hier auch darstellerisch vieles vage. Text, Haltung, Rhythmus wirken, als wäre er nicht ganz in seiner Rolle angekommen. Eine leider verschenkte Chance.
Die Eiskönigin am Palladium Theater ist weit mehr als ein effektvoll aufpolierter Disney-Export. Die Inszenierung trifft den emotionalen Kern der Geschichte und legt ihn frei. Im Mittelpunkt stehen nicht Magie oder märchenhafte Kulissen, sondern zwei Schwestern, deren Beziehung glaubhaft, vielschichtig und berührend erzählt wird. Kim Fölmli als Anna begeistert mit überschäumender Spielfreude und feinem komödiantischen Gespür, Ann-Sophie gibt Elsa Tiefe, Würde und eine Stimme, die unter die Haut geht und dem Stuttgarter Ensemble gelingt eine kraftvolle, mitreißende Umsetzung des Stoffes. Am Ende ist Die Eiskönigin ein Stück über Nähe und Distanz, über Angst und Mut – und über die Erkenntnis, dass wahre Liebe nicht gerettet werden muss, sondern rettet. Und wenn Anna Elsa mit offenem Herzen gegenübertritt, bricht nicht nur das Eis. Dann taut auch das Publikum.



Review: Disneys TARZAN
Apollo Theater Stuttgart


von Marcel Eckerlein-Konrath
Es ist eine der ältesten und emotionalsten Geschichten der Welt: Ein Kind verliert alles – und findet eine neue Familie dort, wo man sie nicht erwartet hätte. In Tarzan, aktuell auf der Bühne des Stage Apollo Theaters in Stuttgart, wird diese Geschichte zu einem bewegenden Abend über Zugehörigkeit, Liebe und die Frage, was uns zu dem macht, was wir sind. Ein Findelkind zwischen zwei Welten, aufgezogen von Gorillas, hin- und hergerissen zwischen Instinkt und Identität.
Schon der Beginn ist stark: Nach einem Schiffsunglück strandet ein junges Paar mit ihrem Baby im Dschungel – wenig später bleiben nur noch Spuren von ihnen zurück. Der kleine Tarzan wird von der Gorillamutter Kala gefunden und aufgenommen. Phil Collins hat diesem Stoff mit seinen Songs eine emotionale Tiefe verliehen, die sich seither unauslöschlich in viele Köpfe gebrannt hat. In Stuttgart versucht die aktuelle Musicalproduktion, diese Magie auf die Bühne zu bringen – mit viel Bewegung, Aufwand und durchaus gemischtem Ergebnis.
Der kleine Tarzan (in der besuchten Vorstellung von Jonas gespielt) prägt den ersten Akt mit erstaunlicher Präsenz. Wild, neugierig, verletzlich – er bringt all das mit, was diese Figur so besonders macht. Auch wenn gesanglich nicht jeder Ton sicher sitzt, trägt er die ersten Szenen mit einer bemerkenswerten Energie. Der Übergang zum erwachsenen Tarzan gelingt visuell mühelos, wirkt aber emotional etwas abrupt. Bob van de Weijdeven bringt viel Spielfreude und eine eindrucksvolle körperliche Präsenz mit, die seine Szenen glaubhaft tragen. Besonders in den Momenten der inneren Zerrissenheit zeigt er, wie nah Tarzans Herz an der Oberfläche schlägt. Seine Darstellung ist berührend, auch wenn gesanglich nicht durchgehend sicher.
Marle Martens als Kala liefert das emotionale Glanzlicht des Abends. Ihre Interpretation der Gorilla-Mutter Kala ist zart, kraftvoll und liebevoll. Wenn Martens dem verwaisten Tarzan vorsichtig gegenübertritt, ihn vorsichtig mustert und schließlich in dem Lied Dir gehört mein Herz ihre bedingungslose Liebe erklärt ist das ein einfacher, aber wunderschöner Moment, der vieles sagt: Familie ist nicht immer Blut. Familie ist das, was man füreinander empfindet.
Diese Szene ist kein Zufallstreffer, denn sie bildet den emotionalen Kern der Geschichte. Tarzan wächst in dieser Tierwelt auf, fühlt sich seiner Gorillafamilie verbunden, lebt nach ihren Regeln, lernt ihre Sprache. Die Inszenierung schafft es dabei, mit viel Bewegung, eindrucksvoller Luftakrobatik und immer wieder auch stillen Szenen diese Welt erfahrbar zu machen.
Matthias Otte verleiht Kerchak eine eindrucksvolle Gravitas. Mit ruhiger, körperlicher Präsenz und kontrollierter Strenge wirkt er wie ein Fels inmitten des aufgewühlten Dschungels. Seine Autorität ist spürbar – er ist ein Anführer, der sich Respekt nicht erkämpfen muss, sondern ihn durch Haltung allein einfordert. Gerade in den stilleren Momenten, in denen Kerchak zwischen Pflichtgefühl und unterdrückter Fürsorge schwankt, bekommt die Figur durch Otte Tiefe.
Judith Caspari als Jane ist fast eine 1:1-Übersetzung der Disney-Vorlage. Sie quirlig, klug, liebenswert. Ihr Duett Auf einmal mit van de Weijdeven im zweiten Akt gehört zu den ganz starken Momenten, in denen Musik, Spiel und Szene perfekt greifen.
Luciano Mercoli ist als Clayton der typische, eindimensionale Disney-Schurke, mit schleimiger Attitüde und klarer Agenda. Dass er als Einziger ausschließlich spricht, fällt positiv auf, denn er nutzt seine Möglichkeiten, um die Figur mit Nuancen zu füllen, wo eigentlich kaum Tiefe vorgesehen ist.
Weniger überzeugend: Elindo Avastia als Terk. Was beim Disney Original ein quirliger, frecher Sidekick ist, wirkt hier überdreht und – vor allem – kaum verständlich. Das sollte bei einer deutschsprachigen Produktion nicht passieren. Zumal es an ausgebildeten Musicaldarstellern im Land sicher nicht mangelt. Dass dann auch noch schwäbische Floskeln bemüht werden, macht es nicht besser. Humor, der aufgesetzt wirkt, zündet selten.

Ein spürbarer Verlust ist die komplett gestrichene Rolle von Janes Vater. In früheren Inszenierungen war dieser schrullige, liebenswert zerstreute Wissenschaftler weit mehr als nur Begleitfigur: Er brachte eine humorvolle Tiefe mit, sorgte für kleine, kluge Zwischentöne und war zugleich ein wichtiges Gegengewicht zur Dschungelhandlung. Seine neugierige, leicht versponnene Art verlieh der Geschichte eine menschliche Wärme und schuf auch für Jane eine greifbare Herkunft, ein Gegenüber, an dem sie sich reiben und wachsen konnte.
In der aktuellen Stuttgarter Fassung wurde diese Figur vollständig gestrichen. Statt lebendiger Vater-Tochter-Dynamik bleibt Jane nun allein auf der Bühne zurück und sinniert extrem oft über eine Vaterfigur, die das Publikum nie zu sehen bekommt. Es entsteht eine spürbare Lücke, denn einer der wenigen menschlichen Stimmen inmitten einer tierischen Welt fehlt, und damit auch ein Teil der Balance. Man merkt: Hier wurde leider an der falschen Stelle gekürzt.
Einige Dialoge wirken unnötig gestreckt, Pointen verpuffen, weil das Timing nicht immer sitzt. Gerade in ruhigeren Passagen schleichen sich Längen ein, die den Fluss der Inszenierung bremsen. Man merkt, dass das Stück nicht durchgängig die gleiche rhythmische Präzision hat wie in seinen starken Momenten.
Als in der Mitte des zweiten Aktes ein Junge in der Reihe vor mir seine Großmutter leise fragt: „Dauert es noch lange?“, war das zwar ein ehrlicher Kindermoment – aber eben auch ein Zeichen dafür, dass die Spannung in diesem Moment nicht mehr ganz trägt. Und er war mit dieser Frage vermutlich nicht allein im Saal. Solche Szenen zeigen, wie sensibel ein Musical ausbalanciert sein muss, damit der Zauber nicht verfliegt.
Ein echtes Highlight von Tarzan sind die Luftszenen: Immer wieder schwingen sich die Darsteller in atemberaubender Höhe über das Publikum hinweg – mal lautlos gleitend, mal mit vollem Körpereinsatz durch das Licht, das zwischen Lianen und Nebel fällt. Diese Momente verleihen der Show eine eigene Dynamik, die man in dieser Form selten erlebt. Wenn Tarzan in einem Bogen über die Köpfe der Zuschauer hinweg durch den Saal fliegt oder Kala in einer luftigen Szene schwebt, dann hält man kurz den Atem an. Es ist beeindruckend, was hier artistisch geleistet wird.
Gerade weil diese Szenen so eindrücklich sind, ist es umso bedauerlicher, dass nicht alle Plätze im Saal dieselben Voraussetzungen bieten, um dieses Erlebnis voll auszukosten. Wer ein sogenanntes Premium oder gar Premium+ Ticket bucht – und damit bereit ist, einen dreistelligen Betrag für einen Sitzplatz auszugeben – darf zu Recht erwarten, auch visuell das volle Programm zu bekommen. Doch genau hier liegt das Problem: Viele dieser hochpreisigen Plätze liegen seitlich am Rand des Saals. Und von dort sind nicht nur einzelne Details auf der Bühne schlecht einsehbar – es entgehen einem ganze szenische Abläufe, etwa wenn Figuren von der jeweils gegenüberliegenden Seite in die Luft starten oder zentrale Aktionen in den Seitenkulissen stattfinden.
Dass man für einen Sitzplatz mit eingeschränkter Sicht denselben Preis bezahlt wie für die besten Plätze im Zentrum, wirkt in diesem Kontext nicht nur unglücklich, sondern schlicht unangemessen. Bei einem Musical, das so stark über Bewegung, Bühne und Raumwirkung erzählt und sich definiert, wäre eine Preispolitik begrüßenswert, die diesem Umstand Rechnung trägt. Wer hier Premium zahlt, bekommt nicht automatisch auch ein Premium-Erlebnis. Und das sollte nicht der Fall sein.
Tarzan in Stuttgart ist technisch beeindruckend, voller Energie und mit einem spielfreudigen Ensemble besetzt. Die Musik von Phil Collins trägt nach wie vor, auch wenn Inszenierung und Besetzung nicht durchgängig mithalten können. Luftakrobatik und Showelemente bieten echten Schauwert, dramaturgisch bleiben zwar Lücken, dennoch ist Tarzan ein starkes Musicalerlebnis mit Gänsehautmomenten.

Review: MERRILY WE ROLL ALONG
Theater Regensburg


von Marcel Eckerlein-Konrath
Mit der deutschsprachigen Erstaufführung von Stephen Sondheims „Merrily We Roll Along“ hat sich das Theater Regensburg auf ein künstlerisches Wagnis eingelassen – und es mit beeindruckender Konsequenz und großer Hingabe umgesetzt. Regisseur und Ausstatter Sebastian Ritschel beweist mit dieser Produktion einmal mehr, dass er ein feines Gespür für ungewöhnliche Stoffe, komplexe Erzählformen und große musikalische Kunst besitzt. Sein Regiekonzept ist durchdacht bis ins Detail: visuell kraftvoll, atmosphärisch dicht und klar.
Ritschels Regiearbeit ist von einem tiefen Verständnis für Sondheims Werk geprägt. Er sieht „Merrily We Roll Along“ nicht nur als eine Coming-of-Age-Geschichte, sondern vor allem als eine schonungslose Betrachtung von Schein und Sein. Für Ritschel symbolisiert das Stück die „Oberflächlichkeiten der High Society“ und das Drama hinter dem Glamour, das oftmals verborgen bleibt. Diese Ambivalenz spiegelt sich in seiner Inszenierung wider, in der die Kostüme – elegante Abendgarderobe mit Glitzer und Glamour – als verkörperter Gegensatz zu den inneren Konflikten der Figuren fungieren, wie er im Programmheft glaubhaft darlegt.
Ritschel betont, wie besonders die Rückwärts-Erzählweise des Musicals ist. Für das heutige Publikum stellt sie zwar keine dramaturgische Herausforderung mehr dar, doch gerade sie macht das Stück inhaltlich so vielschichtig. Er sieht darin ein „theatrales Gespür“, das nur jemand wie Sondheim, mit seiner meisterhaften Verbindung von Musik und Sprache, so eindrucksvoll umsetzen konnte. Für Ritschel ist Sondheim der „anspruchsvollste und innovativste Komponist des Broadway“, dessen Werke im deutschsprachigen Raum leider noch immer nicht die Anerkennung genießen, die sie verdienen.
Sondheims Musical basiert auf einem Schauspiel von Kaufman und Hart aus den 1930er-Jahren. Es erzählt die Geschichte einer zerbrochenen Freundschaft zwischen drei Künstlern – rückwärts, vom desillusionierten Ende zurück zum hoffnungsvollen Anfang. Ritschel nutzt dieses Erzählprinzip nicht nur als formales Stilmittel, sondern baut seine gesamte Inszenierung darauf auf: Der Abend gleicht einer allmählichen Entblätterung. Was zuerst wie ein zynisches Porträt der Showbranche wirkt, verwandelt sich Schritt für Schritt in eine intime, wehmütige Reise zu verlorenen Träumen.
Die Ausstattung von Barbara B. Blaschke unterstreicht die Doppelbödigkeit der Geschichte perfekt. Die Drehbühne fungiert als Zeitmaschine, die das Publikum durch die 18 Jahre der Handlung trägt. Die Bühne ist bewusst minimalistisch, gleichzeitig aber sehr atmosphärisch in Szene gesetzt. Die vielen Glühbirnen im Bühnenhintergrund schaffen stimmungsvolle Lichtbilder, die den Szenen eine fast nostalgische Atmosphäre geben.
Die Kostüme sind stilvoll, kultiviert, mit viel Glanz und sind für Ritschel ein zentrales Element, um den Schein der High Society zu thematisieren. Die glitzernde Oberfläche steht dabei im bewussten Gegensatz zur inneren Leere und Entfremdung, die das Stück beschreibt. Die Kostüme zeigen eine Welt, die elegant und schön erscheint, in der aber viel zerbricht.
Das Orchester unter der Leitung von Andreas Kowalewitz bringt Sondheims vielschichtige Musik mit klarem Klangbild und feinem Gespür für Dynamik zur Geltung. Die musikalische Leitung findet eine gute Balance zwischen orchestraler Präsenz und Rücksicht auf die Sänger, sodass sowohl die strukturelle Komplexität als auch die emotionalen Zwischentöne der Partitur zur Wirkung kommen.
Die Übersetzung von Sabine Ruflair und Jana Mischke ist eine beachtliche Leistung. Ein absoluter, aber gelungener Kraftakt den Text ins Deutsche zu übertragen, ohne die musikalische Struktur zu zerstören. Klug gelöst ist etwa, dass die Jahreszahlen in den Songs englisch bleiben – ein kleines, aber wirksames Mittel, um das Tempo zu halten und Reimstruktur nicht zu gefährden. Gerade im Vergleich zum englischen Original, wo viele Worte kürzer und flexibler sind, war das eine immense Herausforderung. Die Lösung ist elegant und funktional.
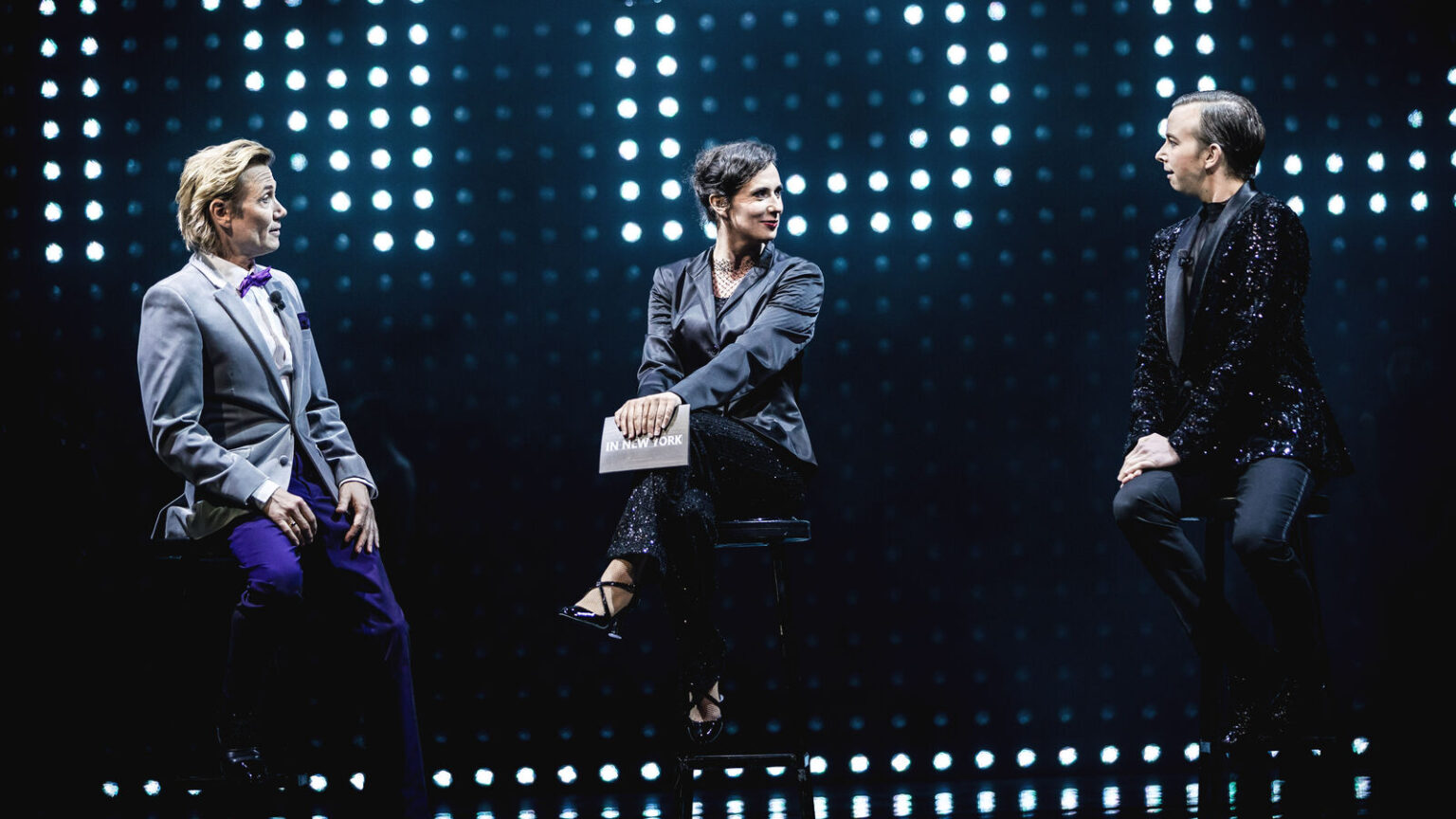
Das Ensemble der Regensburger Produktion ist durchweg engagiert und spielfreudig. Besonders in den großen Gruppenszenen entsteht eine überzeugende Dynamik, die die gesellschaftliche Welt um Franklin Shepard glaubhaft zum Leben erweckt. Die kleineren Rollen sind sorgfältig besetzt, mit vielen präzise gezeichneten Figuren, die zur Atmosphäre beitragen und in einzelnen Momenten stark hervortreten – sei es mit stimmlicher Präsenz oder mit pointierter Darstellung. Masengu Kanyinda überzeugt als Meg, während Alejandro Nicolás Firlei Fernández als Joe punkten kann.
Fabiana Locke sticht dabei besonders hervor: Ihre Gussie Carnegie ist nicht nur schlagfertig und glamourös, sondern auch mit einer überzeugenden Mischung aus Härte und Verletzlichkeit gezeichnet. Ihr Solo zu Beginn des zweiten Aktes gerät zum musikalischen Showstopper (der einzige Song, der im englischen Original gesungen wird: Gussie’s Opening Number) Locke ist stimmlich souverän und mit starker Bühnenwirkung ausgestattet.
Friederike Bauer verleiht der Figur der Mary Flynn eine glaubwürdige Mischung aus Wärme, Intelligenz und einer feinen ironischen Abgeklärtheit, die der Figur gutsteht. Sie zeigt Mary als Frau, die viel beobachtet, oft schweigt, aber innerlich mit sich ringt, besonders im späteren Leben, wenn Zynismus und Alkohol ihren Idealismus getötet haben. Bauer findet eine klare Linie für die Figur und bleibt stets präsent. In manchen emotionalen Momenten, etwa in Marys stiller Verzweiflung über ihre unerwiderte Liebe zu Frank, hätte man sich allerdings noch mehr Tiefe und Verletzlichkeit gewünscht. Diese Facette bleibt eher angedeutet als ausgespielt – doch gerade durch ihre Zurückhaltung macht Bauer Mary glaubwürdig als Figur, die sich selbst schützt, indem sie Gefühle kontrolliert.
Musikalisch bleibt die Produktion anspruchsvoll, denn Sondheims Kompositionen sind rhythmisch wie harmonisch komplex, oft sperrig, nie gefällig. Die Songs ordnen sich stets der Handlung unter und nie umgekehrt. Umso erfreulicher, wenn einzelne Stimmen besonders hervorstechen, wie etwa Nina Weiß als Beth. Ihr großer Moment ist das Solo Jeder Tag tut weh (im Original: Not a Day Goes By) – ein emotionaler Höhepunkt des Abends. Hier gelingt Weiß eine berührende Balance zwischen Kontrolle und Verletzlichkeit. Der Schmerz ihrer Figur wird spürbar, weil sie ihn nicht nur singt, sondern durchlebt.
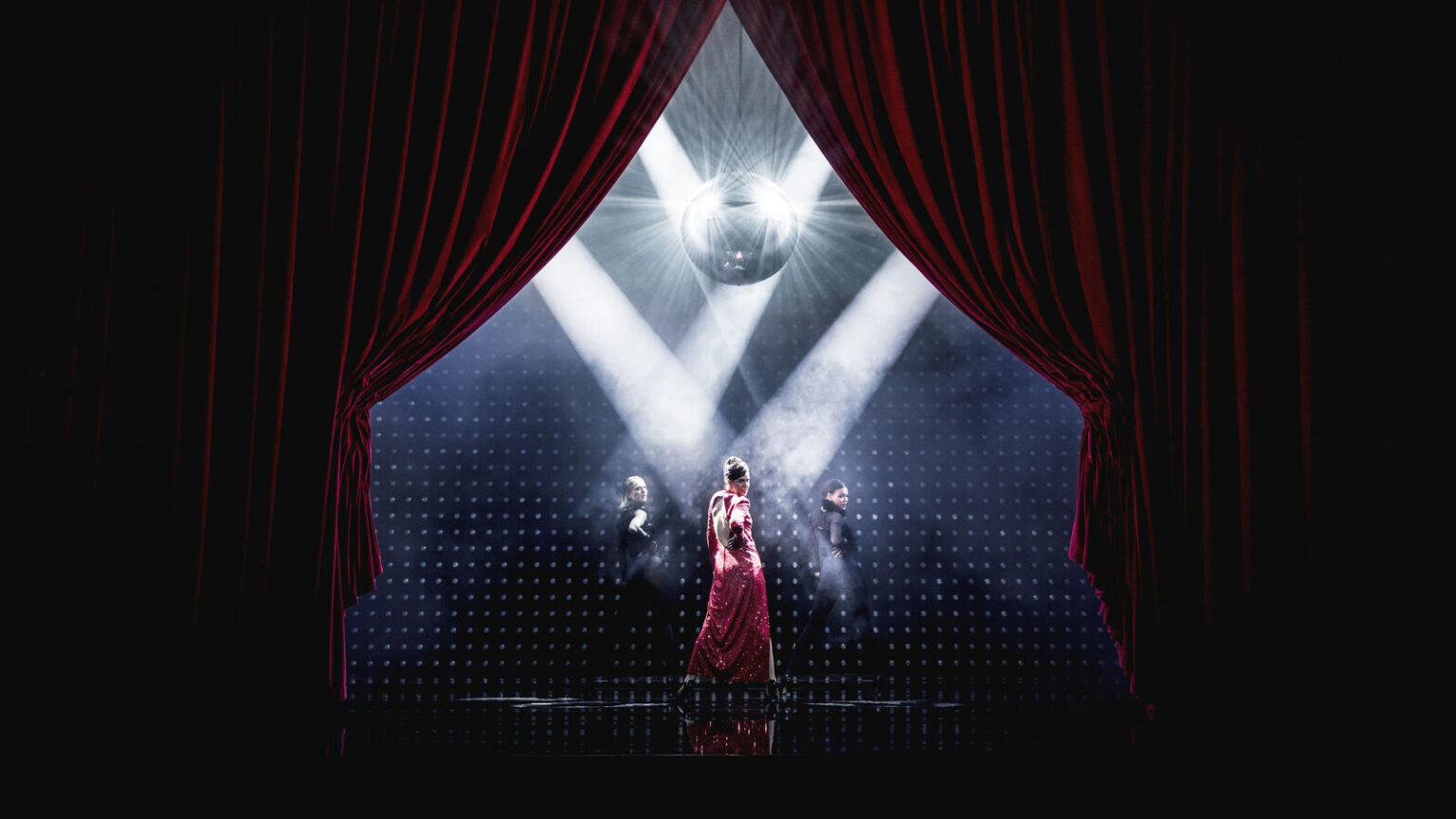
Felix Rabas als Charley Kringas braucht etwas Zeit, um in der Rolle anzukommen, findet aber vor allem in der zweiten Hälfte des Abends spürbar zu sich. Sobald die Handlung in die frühen Lebensjahre der Figuren zurückspringt – also Charley noch nicht desillusioniert, sondern voller Elan und kreativer Energie ist – wirkt Rabas präsenter, wacher und deutlich glaubhafter. Er bringt dann eine Leichtigkeit und Direktheit ins Spiel, die seiner Figur gutsteht. In diesen Momenten wird Charleys Idealismus spürbar, ebenso wie sein unterschwelliger Frust darüber, immer wieder hinter Frank zurückzustehen. Gesanglich bleibt Rabas allerdings nicht ohne Wackler. Besonders in den anspruchsvollen Passagen – etwa bei Gefunden (Good Thing Going) – kommt es zu Unsicherheiten in der Intonation, die sehr hörbar sind. Sondheims Musik stellt hohe rhythmische und melodische Anforderungen, und Rabas bewegt sich dabei mitunter am Rand der Stimmkontrolle.
Andreas Bieber bringt als Franklin Shepard viel Bühnenerfahrung und Souveränität in die Rolle ein. Er zeigt Frank als charismatischen, kontrollierten Macher, der zwischen Kreativität und Karriere hin- und hergerissen ist. Schauspielerisch agiert Bieber präzise, mit feinem Gespür für die Zerrissenheit der Figur. Beim Zusammenspiel mit Friederike Bauer (Mary) und Felix Rabas (Charley) geht in manchen Momenten die Chemie zwischen den dreien verloren und das schwächt ausgerechnet das Herzstück der Inszenierung: das freundschaftliche Dreieck, das die Geschichte trägt.
Ein zusätzlicher Faktor, der sich hier bemerkbar macht, ist der altersmäßige Unterschied zwischen Bieber und seinen beiden Bühnenpartnern. Während Bauer und Rabas spürbar jünger wirken (und sind), fällt Bieber vor allem in den späteren Szenen im zweiten Akt als deutlich älter auf. Das schmälert stellenweise die Glaubwürdigkeit, gerade in den Szenen, in denen die drei als Anfang-Zwanzigjährige ins Leben starten. Die emotionale Fallhöhe bleibt vorhanden, aber die Illusion der gemeinsamen Jugend und Entwicklung leidet ein wenig, zumal das Musical davon lebt, dass man die enge Verbindung dieser drei Figuren über Jahre hinweg nachvollziehen kann.
Insgesamt trägt das Ensemble den Abend mit spürbarem Einsatz und sichtlich großer Achtung vor Sondheims Werk. Auch wenn nicht jeder Ton sitzt und nicht jede Szene vollends überzeugt, wird doch klar: Hier steht ein Team auf der Bühne, das sich dieser herausfordernden Partitur und der vielschichtigen Geschichte mit Ernsthaftigkeit und Respekt stellt.
Merrily We Roll Along ist kein Musical, das sich einfach konsumieren lässt und gerade das macht seinen Reiz aus. Stephen Sondheims komplexe Partitur und George Furths Buch fordern das Publikum heraus, mitzudenken und mitzuleiden. Am Ende (also chronologisch am Anfang) steht nicht das Scheitern, sondern eine beinahe schmerzhafte Unschuld durch die hoffnungsvolle Jugend der drei Freunde. (Wir sind dran / Our Time)
Ritschels Inszenierung ist ein durchdachtes, vielschichtiges Theatererlebnis, das den Glanz und die Schattenseiten von Freundschaft, Erfolg und Selbstverlust eindrucksvoll beleuchtet. Das Konzept, das Schein und Sein in Kostümen, Bühnenbild und Spiel verbindet, macht das Stück für das Publikum nachvollziehbar und emotional zugänglich.
Trotz kleinerer Schwächen in der schauspielerischen Umsetzung gelingt dem Ensemble eine respektable Leistung, getragen von einem starken Orchester und einer sorgfältigen Übersetzung. Für alle, die sich für Sondheim und Musical abseits des Mainstreams interessieren, ist diese deutschsprachige Premiere ein echtes Highlight und ein überzeugender Beleg dafür, dass Merrily We Roll Along auch im deutschsprachigen Raum ein Publikum findet.
Ein Besuch in Regensburg lohnt sich definitiv – nicht nur wegen des außergewöhnlichen musikalischen Werks, sondern auch wegen der klugen, visionären Regiearbeit Sebastian Ritschels, die das Stück mit viel Herz und Verstand auf die Bühne bringt.

Review: CABARET
at the Kit Kat Club London


von Marcel Eckerlein-Konrath
Schon beim Betreten des Playhouse Theatres, das in den funkelnden, zwielichtigen KitKat Klub verwandelt wurde, spürt man: hier ist man augenblicklich in einer neuen Welt. Hier wird etwas erzählt, das tief ins Heute hineinreicht. Die Zuschauer*innen betreten den Raum nicht durch den gewohnten Eingang, sondern durch die Stage Door – sie treten ein in eine Welt zwischen Rausch und Abgrund.
Die Vorstellung beginnt mit einer elektrisierenden Pre-Show: Musik, Tanz, Verführung. Alles scheint möglich in dieser glitzernden Parallelwelt. Und doch schwingt von Anfang an eine dunkle Ahnung mit – eine Ahnung von etwas, das näher kommt, leiser, bedrohlicher.

Billy Porter als Emcee ist das pulsierende Herz dieser Inszenierung – charismatisch, unheimlich, verführerisch. Doch hinter dem Glanz, dem Spiel mit Gender und Identität, offenbart er auch eine tiefe Verletzlichkeit. Porter gelingt es, zwischen Zynismus und Zartheit zu changieren, zwischen flamboyanter Showfigur und stillem Beobachter des drohenden Zusammenbruchs. Seine Präsenz ist elektrisierend – nicht nur, weil er die Bühne beherrscht, sondern weil er immer wieder Momente der nackten, fast schmerzhaften Menschlichkeit zulässt.
Dabei erinnert seine Darstellung stellenweise an seine preisgekrönte Rolle als Pray Tell in der Serie Pose – auch dort spielte er eine queere Figur, die zwischen Glamour und persönlicher Tragödie existiert. Doch während Pray Tell im Kontext der AIDS-Krise kämpft, ist Porters Emcee der Chronist eines historischen Abgrunds – und zugleich dessen warnende Stimme für die Gegenwart. Besonders eindrucksvoll: sein „I Don’t Care Much“. Es ist kein beiläufiges Nummernrevue-Lied – es ist ein Schrei der Verzweiflung, bitter, leise, erschütternd. Dieser Moment trifft ins Mark.
Seine Figur des Emcee nimmt in Cabaret eine besondere Rolle ein. Er ist nicht Teil der eigentlichen Handlung, sondern bewegt sich zwischen den Ebenen – Kommentator, Erzähler, Verführer, Spiegel der Gesellschaft. Er beobachtet, kommentiert, warnt – und verführt das Publikum zugleich. Mal ist er Clown, mal Zyniker, mal Schattenwesen. In Frecknalls Inszenierung wird dieser Aspekt besonders klar herausgearbeitet: Der Emcee weiß, was kommt. Und er weiß, dass niemand hinhört – zumindest nicht rechtzeitig.
Porter spielt diese Ambivalenz mit großer schauspielerischer Tiefe. Jeder Blick, jede Pause, jedes ironisch gehauchte „Willkommen“ trägt Bedeutung.
Er ist das Gewissen der Show – und das Echo all jener Stimmen, die in Zeiten des Wandels zu leise waren.
Wenn Marisha Wallace als Sally Bowles die Bühne betritt, gehört der Raum sofort ihr – nicht nur wegen ihrer beeindruckenden Präsenz, sondern weil sie etwas mitbringt, das man auf einer Theaterbühne nur selten in solcher Reinheit erlebt: Echtheit. Ihre Sally ist keine glamouröse Diva, keine oberflächliche Revuepuppe, sondern eine Frau aus Fleisch und Blut. Eine, die kämpft, lacht, trinkt, liebt – und die immer wieder aufsteht, auch wenn es eigentlich fast nicht mehr möglich ist.
Sie ist eine Heldin des Alltags, ein Kumpel, den man beschützen möchte, obwohl man weiß, dass sie sich selbst retten muss. In Wallace‘ Spiel liegen Mut, Trotz, Witz – aber auch eine tiefe, ungeschönte Verletzlichkeit. Ihre Sally glaubt noch an das Gute, selbst wenn ihr die Welt längst das Gegenteil bewiesen hat. Und genau das macht ihre Figur so menschlich, so tragisch – und so stark.
Ihre Stimme ist schlicht atemberaubend. Kraftvoll, klar, emotional aufgeladen – jede Note sitzt, jede Silbe hat Gewicht. Und wenn sie „Maybe This Time“ singt, wird aus einem bekannten Showtune ein Akt des Überlebens. Noch nie – wirklich noch nie – war dieser Song auf einer Bühne so intensiv, so dringlich, so verletzlich. Kein Showstopper, sondern ein offenes Herz. Ein letzter Versuch, das Leben noch einmal zu spüren, bevor es entgleitet.

Dass Wallace als Amerikanerin mit einem British English aufwartet, das bis ins letzte Detail glaubhaft klingt, ist ein weiteres kleines Wunder. Ihr Akzent ist „spot on“, ihre Sprachführung makellos – sie spielt Sally nicht wie eine Britin, sie ist es. Dieses Maß an stimmlicher, sprachlicher und emotionaler Präzision ist schlicht außergewöhnlich.
Was Wallace leistet, ist nicht weniger als eine Neuerfindung der Rolle. Sie zeigt Sally als Frau, die sich weder romantisieren noch brechen lässt. Eine, die Fehler macht, ja – aber die nie aufhört zu hoffen. Sie ist der lebendige Beweis, dass selbst im Angesicht des Zusammenbruchs Würde, Mut und Menschlichkeit weiterbestehen können.
Die große Stärke der Inszenierung von Rebecca Frecknall: Sie verweigert sich dem sicheren Rückblick. Sie erzählt nicht nur vom Berlin der 1930er-Jahre – sie spricht direkt ins Hier und Jetzt. Und die Parallelen sind erschreckend deutlich.
Wenn wir heute auf das Erstarken rechtspopulistischer Parteien blicken – auf Ausgrenzung, Rassismus, Hass auf Minderheiten, Hetze gegen queere Menschen, auf das Gift der Fremdenfeindlichkeit, das sich in den Diskurs mischt – dann spüren wir, wie aktuell Cabaret ist. Das Musical zeigt eine Gesellschaft, die lieber wegsieht, lieber feiert, statt zu handeln. Und genau das erleben wir heute wieder: politische Normalisierung des Undenkbaren, die schleichende Verschiebung der Grenzen, die gefährliche Sehnsucht nach „einfachen Antworten“.
Rebecca Frecknalls Inszenierung macht klar: Das ist nicht Vergangenheit – das ist Gegenwart. Wenn Sally sagt, sie wolle sich nicht mit Politik befassen, weil das Leben zu schön ist – dann klingt das wie viele Stimmen heute, die meinen, es gehe sie nichts an. Und wenn am Ende die Musik verstummt und der Emcee sein Lächeln verliert, dann bleibt ein bitteres Gefühl: Es hätte nicht so weit kommen müssen.
Auch das intime Setting des Theaters verstärkt diese Botschaft. Man sitzt dicht an den Darsteller*innen, kann den Atem, den Schweiß, das Flackern in den Augen sehen. Es gibt kein Entkommen – und genau das braucht es: ein unmittelbares, schonungsloses Erleben.


Cabaret basiert auf den Berlin-Erzählungen von Christopher Isherwood, die das Lebensgefühl der späten Weimarer Republik einfangen – eine Zeit des künstlerischen Aufbruchs, aber auch der politischen Blindheit. Das Musical von Kander, Ebb und Prince wurde 1966 uraufgeführt, hat seitdem viele Gesichter gehabt – doch selten war es so dringlich wie heute.
Diese Produktion ist nicht nur künstlerisch herausragend, sie ist ein Weckruf. Sie erinnert uns daran, was auf dem Spiel steht, wenn wir Toleranz zur Meinungssache erklären und Menschenrechte verhandelbar machen.
Cabaret im Playhouse Theatre ist ein Erlebnis, das einen nicht loslässt. Brillant gespielt, atemberaubend gesungen, erschreckend aktuell. Es ist ein Appell an unsere Menschlichkeit – und eine Warnung davor, was geschieht, wenn wir sie verlieren.
Ein Musical? Ja. Aber vor allem: eine Mahnung.

Review: THE DEVIL WEARS PRADA
Dominon Theatre London


von Marcel Eckerlein-Konrath
Mit dem Einzug von The Devil Wears Prada (Regie: Jerry Mitchell) ins Londoner Dominion Theatre feiert eine der ikonischsten Modegeschichten der letzten Jahrzehnte ihre große Musical-Premiere im West End. Die Erwartungen sind entsprechend hoch – schließlich basiert das Stück nicht nur auf Lauren Weisbergers Bestseller, sondern vor allem auf dem überaus erfolgreichen Film mit Meryl Streep und Anne Hathaway, der weltweit Kultstatus genießt.
Der Weg dahin war allerdings nicht ganz reibungslos. Das Tryout der Show 2022 in Boston verlief verhalten. Elton John, verantwortlich für die Musik, zeigte sich selbstkritisch und kündigte an, das Material noch einmal „grundlegend zu überdenken“. Nun ist das Musical in London angekommen – überarbeitet, aufpoliert, neu gestylt. Aber reicht das für den großen Auftritt auf dem Laufsteg des West End? Was auf die Bühne gebracht wurde, ist eine weitgehend werkgetreue Umsetzung des Films, die viele bekannte Szenen und Dialoge übernimmt. Diese Nähe zur Vorlage funktioniert auf der einen Seite als emotionaler Anker für Fans des Originals, macht es der neuen Produktion auf der anderen Seite aber schwer, ein eigenes Profil zu entwickeln. Man hat streckenweise das Gefühl, einem gut gemachten Re-Enactment beizuwohnen, das sich eng an eine bekannte Ikone anlehnt, ohne diese ganz erreichen zu können. Die Songs von Elton John wirken, als hätte man ihm den Auftrag gegeben: „Mach’s ein bisschen wie Cyndi Lauper in ‚Kinky Boots‘ – aber bitte nicht zu offensichtlich.“ Das Ergebnis sind routiniert produzierte Musicalnummern, die eher standardmäßig geschneidert und selten mitreißend sind (House of Miranda). Die große Hymne fehlt, der musikalische Glamour bleibt hinter der Marke Elton John überraschend blass. Es klingt gefällig, aber nicht erinnerungswürdig – solide Konfektionsware, keine Haute Couture.

Vanessa Williams bringt als Miranda Priestly zweifellos Stil und Bühnenpräsenz mit – sie betritt die Szenerie mit geschmeidiger Eleganz, ordentlicher Stimme und jener Aura, die man von einer erfolgreichen Mode-Ikone erwartet. Ihre Interpretation ist kontrolliert und präzise, was ihrer Darstellung eine gewisse Noblesse verleiht. Doch genau in dieser Zurückhaltung liegt zugleich das Problem: Miranda bleibt unterkühlt – aber nicht im Sinne einer einschüchternden Grande Dame, sondern eher als distanzierte, fast abstrahierte Figur.
Was bei Meryl Streep im Film als eiskaltes Charisma mit minimalistischem Ausdruck wirkte – ein gehauchtes „That’s all“ konnte ganze Welten zum Einsturz bringen – verliert bei Williams spürbar an dramaturgischer Wirkung. Ihre Miranda scheint sich nie ganz von früheren Rollen zu lösen, insbesondere nicht von Wilhelmina Slater aus Ugly Betty. Die Verbindung ist unverkennbar: die scharfe Zunge, das überlegene Augenrollen, die leicht ironische Distanziertheit. Doch wo Wilhelmina eine überzeichnete Satirefigur war, verlangt Miranda Priestly eine differenzierte Mischung aus Macht, Intelligenz und Furcht einflößender Ruhe.
Es fehlt jene leise, souveräne Autorität, mit der Miranda allein durch Anwesenheit dominiert. Stattdessen wirkt Williams’ Spiel oft wie eine Hommage (Imitation?). Sie ist stets präsent, aber selten bedrohlich. Man beobachtet sie mit Interesse, doch das Gefühl ehrlicher Einschüchterung – so zentral für die Dynamik zwischen Miranda und Andy – stellt sich kaum ein. In den entscheidenden Momenten, etwa bei der berühmten „Cerulean-Blau“ Monolog bleibt ihre Wirkung eher mau und oberflächlich.
Ihre Miranda ist keine Tyrannin, eher eine versierte Strategin – und das kann durchaus als ein neuer Zugang zur Rolle verstanden werden. Doch im direkten Vergleich mit der ikonischen Vorlage fehlt es an Schärfe, an emotionalem Gewicht und jener feinen Mischung aus Faszination und Furcht, die die Figur zur Legende machte.
Georgie Buckland als Andy Sachs macht ihren Job respektabel – stimmlich und schauspielerisch erstklassig. Sie trägt die Show mit Energie, bleibt aber letztlich in einer Rolle gefangen, die zu eng an der Filmvorlage klebt, ohne ihr etwas Eigenständiges abzugewinnen.
Matt Henry als Nigel hat ein feines Gespür für Timing, vefügt über natürlichen Charme und einem warmen, humorvollen Charakter, der jene Leichtigkeit in die Inszenierung bringt, die an vielen Stellen schmerzlich vermisst wird. Er füllt die Rolle mit Leben, ohne sie zu überzeichnen, und balanciert gekonnt zwischen pointiertem Witz und echter Emotionalität.

Sein Nigel ist Mentor, Freund und Mode-Flüsterer in einem – stets auf den Punkt gespielt, mit klug dosierter Energie und einer großen Offenheit, die ihn sofort ins Herz des Publikums rückt. Gerade in den Szenen, in denen er Andy stützt und formt, zeigt sich Henrys Fähigkeit, aus scheinbar beiläufigen Momenten glaubhafte Tiefe zu schöpfen. Auch gesanglich überzeugt er mit starker Stimme und viel Ausdruck – seine Songs gehören zu den mitunter einprägsamsten der Show (Dress Your Way Up).
Bemerkenswert ist zudem, wie sehr Henry mit seiner bloßen Präsenz Szenen dominieren kann. Seine Ausstrahlung ist leuchtend und ehrfurchtgebietend – und im direkten Vergleich wirkt seine Bühnenkraft mitunter sogar eindrucksvoller als die der eigentlichen Hauptfigur Miranda. Während Vanessa Williams‘ Interpretation bisweilen an emotionaler Schärfe vermissen lässt, gelingt es Henry, mit Wärme und Authentizität zu berühren.

Doch der Star der Produktion ist zweifellos Amy Di Bartolomeo als Emily. Ihre Performance, zurecht Olivier-nominiert, ist eine explosive Mischung aus Präzision, Komik und vokaler Brillanz. Jedes Mal, wenn sie die Bühne betritt, richtet sich der Blick ganz automatisch auf sie – sie ist das dramaturgische Gegenstück zu Miranda, sprühend vor Energie, mit einem Timing, das messerscharf sitzt. Ihre Momente sind die stärksten des Abends.
Was wirklich überzeugt, sind die Kostüme und das aufwendig gestaltete Bühnenbild. Hier wird mit Stilgefühl, Detailverliebtheit und handwerklicher Klasse gearbeitet. Die Modeschau-Szenen funkeln, das Redaktionsbüro wirkt lebendig und bis ins kleinste Accessoire durchdacht. In diesen Momenten glaubt man kurz, in die Welt von Runway einzutauchen.
Doch am Ende bleibt das Gefühl, einem luxuriös verpackten Präsent beizuwohnen, dessen Inhalt man leider schon kennt – und den man womöglich nicht dringend gebraucht hätte. Insgesamt ist The Devil Wears Prada im Dominion Theatre ein unterhaltsames, handwerklich gut gemachtes Musical, das seine Geschichte mit Nähe zur Vorlage erzählt. Es wird seine Fans finden – auch wenn es der Inszenierung stellenweise noch an eigener Handschrift fehlt. Wer den Film liebt, wird viel Wiedererkennbares finden; wer nach einem neuen musikalischen Statement sucht, bleibt womöglich etwas unberührt und enttäuscht zurück. Es ist ein solides West-End-Musical – professionell, kurzweilig, doch mit Luft nach oben.
„That’s all.“


