Review: GHOST
DAS MUSICAL
Tournee 2025 – Nürnberg

von Marcel Eckerlein-Konrath
Wenn die ersten Töne von Unchained Melody erklingen, ist sie sofort wieder da – die Erinnerung an jene legendäre Töpferszene aus dem Film von 1990, die sich ins kollektive Gedächtnis einer ganzen Generation eingebrannt hat. Patrick Swayze und Demi Moore schufen damals einen der ikonischsten Momente der Filmgeschichte, und es ist diese emotionale Fallhöhe, an der sich jede Bühnenumsetzung messen lassen muss.

Die Transformation von Ghost zum Musical war ein ambitionierter Schritt, der zunächst 2011 in Manchester seine Premiere feierte, bevor die Produktion nach London ins Piccadilly Theatre zog. Der Broadway folgte 2012, und auch im deutschsprachigen Raum etablierte sich das Stück: Linz bot eine eigenständige Inszenierung, während das Theater des Westens in Berlin mit Willemijn Verkaik und Alxander Klaws eine weitere hochkarätige Produktion auf die Beine stellte. Seitdem ist Ghost durch diverse Tourneen in Europa wahrhaft herumgekommen – ein Stück, das seine Fans gefunden hat und das Publikum immer wieder aufs Neue berühren möchte.
Die aktuelle Tourneeproduktion von ShowSlot, die unter anderem in der Nürnberger Kia Arena gastiert, steht vor einer besonderen Herausforderung: Die Arena ist mit ihrer Weitläufigkeit und funktionalen Architektur nicht für die intime Atmosphäre geschaffen, die ein Musical wie Ghost eigentlich verlangt. Die sterile Umgebung eines Veranstaltungsorts, der normalerweise für Sportevents und Großkonzerte konzipiert ist, kann jene theatrale Nähe nur bedingt herstellen, die für eine Liebesgeschichte zwischen Leben und Tod so essenziell wäre. Die Dimension des Raumes schluckt bisweilen die emotionale Unmittelbarkeit – hier fehlt schlicht die behagliche Wärme eines klassischen Theatersaals.

Was die Produktion an atmosphärischer Intimität einbüßt, versucht sie durch technische Raffinesse wettzumachen und das mit beachtlichem Erfolg. Die Projektionen (Video Design: Girgory Shkylar) sind intelligent konzipiert und ermöglichen fließende Übergänge zwischen den Welten der Lebenden und der Toten. Wände werden transparent, Räume transformieren sich nahtlos, und Sams Geisterhaftigkeit wird visuell überzeugend umgesetzt. Diese technische Cleverness ist das Rückgrat der Inszenierung und beweist, dass auch unter den erschwerten Bedingungen einer Arenabespielung visuell überzeugendes Theater möglich ist.
Besonders hervorzuheben ist das Engagement des Ensembles, das mit sichtbarer Spielfreude und Energie bei der Sache ist. Sandro Wenzing gibt als Willie Lopez eine physisch präsente Performance, während Ulrich Talle als Krankenhausgeist und Sophie Alter als U-Bahngeist atmosphärische Akzente setzen. Annika Böbel (Clara), Aminata Ndaw (Louise), Simon Tofft (Beidermann) und Silja Teerling (Mrs. Santiago) bevölkern glaubwürdig die New Yorker Szenerie und wechseln routiniert zwischen verschiedenen Rollen. Luisa Meloni, Melissa Laurenzia Peters, Nolle De Kock und Philip Rakoczy komplettieren das Ensemble und schaffen so ein lebendiges Tableau der pulsierenden Metropole.

Hier offenbart sich jedoch eine der größten Schwächen der Musicalisierung: Die von Dave Stewart und Glen Ballard komponierten Songs schaffen es leider nicht, sich nachhaltig einzuprägen. Anders als bei den großen Musical-Klassikern, bei denen man summend das Theater verlässt, bleibt hier wenig haften. Die Ausnahme bildet naturgemäß Unchained Melody, jener Song von The Righteous Brothers, der bereits den Film prägte und mehrfach zitiert wird. Doch gerade hier zeigt sich ein dramaturgisches Problem: Die berühmte Töpferszene, auf die das Publikum regelrecht wartet, wirkt überraschend knapp bemessen und endet fast abrupt, bevor sie ihre volle emotionale Wirkung entfalten kann. Man wünscht sich, die Inszenierung von Manuel Schmitt hätte diesem ikonischen Moment mehr Raum gegeben.

Lina Kropf überzeugt als Molly Jensen mit einer klaren, ausdrucksvollen Stimme, die den Gefühlslagen ihrer Figur gerecht wird – stimmlich eine sichere Bank. Im schauspielerischen Bereich besteht im gesamten Cast allerdings noch Entwicklungspotenzial, insbesondere was die feine Ausarbeitung emotionaler Momente betrifft.
Robin Reitsma zeigt als Sam Wheat eine differenzierte, wenn auch eher kühle, zurückhaltende Interpretation. Die emotionale Intensität bleibt an manchen Stellen verhalten, wodurch die Verbindung zur Figur etwas schwächer ausfällt. Möglicherweise spiegelt diese Distanz jedoch bewusst Sams Zustand zwischen Leben und Tod wider: eine interessante, aber nicht immer mitreißende Lesart der Rolle.

Als Carl Bruner verkörpert Lucas Baier einen Antagonisten, der durch seine Zwiespältigkeit zwischen Loyalität und Verrat überzeugt. Er transportiert diese Spannung durch feine, nuancierte Momente und beeindruckt sowohl stimmlich als auch darstellerisch.
UZOH als Oda Mae Brown steht vor einer besonderen Herausforderung: Whoopi Goldbergs oscarprämierte, perfekt getimte Performance aus dem Film hat diese Rolle für immer definiert. UZOH ist merklich jünger als Goldberg damals und bringt entsprechend eine andere Energie mit. Das Comic-Timing, das bei dieser Rolle so entscheidend ist, sitzt nicht immer punktgenau, aber mit mehr Gelegenheit, in die Rolle hineinzuwachsen, und der Entwicklung eines eigenen Zugangs jenseits des Filmschattens, dürfte sich hier noch einiges entwickeln.

Ghost – Das Musical auf Tournee ist eine technisch versierte Produktion mit einem engagierten Ensemble, das unter den speziellen Bedingungen einer Arena-Tournee Beachtliches leistet. Die visuellen Lösungen sind clever (Licht Design: Michael Grundner), die Projektionen ermöglichen eine flüssige Erzählweise. Was der Inszenierung fehlt, ist einerseits der intime Rahmen eines echten Theaters und andererseits eine Partitur, die sich tiefer einprägt. Wer den Film liebt und die Geschichte von Sam und Molly auf der Bühne erleben möchte, wird dennoch unterhalten – sollte aber vielleicht nicht mit allzu großen Erwartungen an die musikalische Memorabilität herangehen. Es ist solides Musical-Handwerk, das seine Geschichte erzählt, ohne jedoch zu den Sternstunden des Genres zu gehören.
Review: GYPSY
Oper Halle

von Marcel Eckerlein Konrath
Es ist ein mutiger und lobenswerter Schritt der Oper Halle, Arthur Laurents und Jules Stynes Gypsy aus der – zumindest hierzulande – unverdient tiefen Versenkung zu holen. Dieses Musical über die ultimative Stage Mother Rose mit den Original Texten von Stephen Sondheim, die ihre Töchter June und Louise gnadenlos ins Rampenlicht prügelt, gehört zum Kanon des amerikanischen Musiktheaters. Dass es in Deutschland so selten zu sehen ist, mag auch daran liegen, dass die Titelrolle eine Herausforderung darstellt, die nur wenige zu meistern vermögen.
Brigitte Oelke wagt sich an diese Mammutaufgabe – und muss sich dabei am Vermächtnis von Legenden wie Ethel Merman, Angela Lansbury, Bernadette Peters und Patti LuPone messen lassen. Keine leichte Bürde. Schon in der legendären Ouvertüre setzt Regisseurin Louisa Proske ein kluges Signal: Der Vorhang öffnet sich kurz, und dort steht Oelke als Rose gefangen in bewegenden Lichtbahnen, eine Vorschau auf den finalen Nervenzusammenbruch in Rose’s Turn. Diese eine, erschütternde Nummer, in der Rose ihr ganzes verfehltes Leben in acht Minuten dekonstruiert, gehört zu den schwierigsten Partien des weiblichen Musical-Repertoires.
Rose ist keine eindimensionale Monster-Mutter. Sie ist getrieben von unerfüllten Träumen (Du wirst gebettet auf Rosen), von narzisstischer Liebe zu ihren Kindern und zugleich völliger Blindheit für deren eigene Bedürfnisse (Du kommst ja doch nicht los von mir). Sie ist manipulativ und verletzlich, rücksichtslos und verzweifelt, eine Frau, die in ihrer Obsession tragisch-grandios scheitert. Es ist diese Vielschichtigkeit, die die Rolle so außergewöhnlich macht: Rose muss Vitalität, Härte, Charme und am Ende zerreißende Verletzlichkeit verkörpern – und das fast ohne Pause, denn sie ist praktisch durchgehend auf der Bühne.
Brigitte Oelke gibt ihr Bestes und tut das mit erkennbarem Engagement und Eifer.. Sie singt gut, spielt mit Verve und schenkt der Produktion ihre ganze Energie. Und doch fehlt jener letzte Funke, der aus einer guten Leistung eine unvergessliche macht. Es sind Nuancen: ein gewisses Mehr an innerer Zerrissenheit, an dunkler Obsession, an gefährlichem Charisma hätte Oelkes Rose noch dreidimensionaler, noch beunruhigender werden lassen. Die Rolle verlangt nicht nur technisches Können, sondern eine fast selbstzerstörerische Hingabe – und genau hier bleibt man als Zuschauer ein wenig auf Distanz.

Umso erfreulicher, dass die Produktion insgesamt überzeugt. Was das Ensemble der Oper Halle unter der Regie von Louisa Proske hier auf die Bühne bringt, verdient Respekt – zumal Stadttheater heute mit knappen Mitteln wirtschaften müssen. Dies hier ist keine Sparversion, sondern eine ambitionierte, liebevoll ausgestattete Inszenierung. Darko Petrovic hat Bühne und Kostüme geschaffen, die den Glamour und die Tristesse der Vaudeville-Welt gleichermaßen einfangen. Marie-Christin Zeissets Choreografie verleiht den Show-Nummern den nötigen Schwung.
Eine echte Entdeckung ist Laura Magdalena Goblirsch als Louise, die sich zur legendären Stripperin Gypsy Rose Lee entwickelt. Goblirsch verkörpert die anfangs schüchterne, übersehene Tochter mit berührender Authentizität und wächst im zweiten Akt über sich hinaus (Lasst euch unterhalten). Charlotte Vogel gibt eine solide June, während Fabio Kopf als Tulsa tänzerisch glänzt – seine Nummer Nur das Mädchen fehlt dazu überzeugt auf ganzer Linie.

Gerd Vogel als Herbie, Roses langjähriger Verlobter und Agent, verkörpert den gutmütigen Verlierer mit sympathischer Präsenz und starkem Bariton, und auch die Nebenrollen sind durchweg gut besetzt: Tessie Tura/ Miss Cratchitt wird von Susanne Jansen gewitzt interpretiert. Das Ensemble, darunter Patric Seibert, Jonas Schütte, Robert Sellier und Julia Preußler liefert insgesamt ein starkes, lebendiges Bild des Showgeschäfts.
Ein kleiner Wermutstropfen bleibt – und das ist kein spezifisches Hallenser Phänomen: In Deutschland gibt es noch vergleichsweise wenige Kinder, die gleichzeitig singen, tanzen und schauspielern können. Isabella Mojzis und Aurelia Bucher in den Rollen von Baby June und Baby Louise zeigen jedoch viel Engagement. Der Unterschied zu den Profis auf dem Broadway ist spürbar, mindert aber keineswegs den Charme und die Energie, die sie auf die Bühne bringen.

Yonatan Cohen führt die Staatskapelle Halle mit großer Präzision und Einfühlungsvermögen durch Jules Stynes’ mitreißende Partitur. Unter seiner Leitung gelingt es dem Orchester, die rhythmischen Feinheiten, dynamischen Kontraste und die farbenreiche Instrumentation klar herauszuarbeiten, sodass die Spannung und Lebendigkeit der Musik vom ersten bis zum letzten Ton spürbar wird. Cohens Verständnis für den Charakter jeder Passage sorgt dafür, dass sowohl die melodischen Linien als auch die orchestralen Details in perfekter Balance zur Geltung kommen.
Gypsy in Halle ist vielleicht nicht makellos, aber eine wichtige und aausgesprochen sehenswerte Produktion. Sie erinnert daran, dass dieses Musical mehr ist als ein nostalgischer Blick auf die Vaudeville-Ära – es ist eine zeitlose Geschichte über Ehrgeiz, Scheitern und die Frage, wem die Träume gehören, die wir leben. Dass Brigitte Oelke sich diesem Monster von einer Rolle stellt, verdient Hochachtung. Dass die Oper Halle das Stück überhaupt zeigt, verdient Applaus.
Review: WICKED
Theater Baden bei Wien

von Marcel Eckerlein-Konrath
Es ist ein gewagtes Unterfangen: Das populärste Musical des 21. Jahrhunderts, Stephen Schwartz’ Wicked, in die Theatersprache Bertolt Brechts zu übersetzen. Regisseur Andreas Gergen, dessen enge künstlerische Verbindung zum Komponisten längst über eine bloße Werkstreue hinausgeht, hat sich am Theater Baden bei Wien dieser Herkulesaufgabe gestellt – mit einem Ergebnis, das so faszinierend wie widersprüchlich ausfällt.
Die Erfolgsgeschichte von Wicked beginnt 1995 mit Gregory Maguires Roman Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, einer radikalen Neuinterpretation von L. Frank Baums Oz-Universum. Stephen Schwartz, der Komponist von Godspell und Pippin, erkannte sofort das musikalische Potenzial dieser Geschichte zweier ungleicher Freundinnen, die zu Erzfeindinnen werden. 2003 feierte das Musical am Gershwin Theatre am Broadway Premiere und entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Bühnenwerke aller Zeiten. Die Vorgeschichte zum „Zauberer von Oz” entpuppt sich dabei als weit mehr als nur ein Prequel: Es ist eine vielschichtige politische Parabel über Machtverhältnisse, moralische Entscheidungen und die Frage, wie leicht sich Wahrheit manipulieren lässt. Im Zentrum stehen zwei junge Frauen mit entgegengesetzten gesellschaftlichen Startpunkten: die idealistische, unangepasste Elphaba mit ihrer grünen Haut, und die beliebte, ehrgeizige Glinda.
Das Theater Baden bei Wien, ehrwürdiges Stadttheater mit einer Geschichte, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, bietet eine überraschende Heimat für dieses Broadway-Spektakel. Hier, wo einst Mozart und Beethoven ein und aus gingen, schlägt Andreas Gergen eine Brücke zwischen kommerziellem Musiktheater und intellektuellem Regietheater – ein Spagat, der symptomatisch für die gesamte Inszenierung werden sollte.
Um Gergens Inszenierungsansatz zu verstehen, lohnt ein Blick auf die Grundlagen des epischen Theaters. Bertolt Brecht entwickelte in den 1920er und 1930er Jahren ein radikal neues Theaterkonzept. Statt Katharsis durch emotionale Identifikation suchte Brecht die kritische Distanz. Der berühmte Verfremdungseffekt (V-Effekt) sollte verhindern, dass das Publikum in der Illusion versinkt – durch Songs, die die Handlung unterbrechen, durch sichtbare Bühnentechnik, durch direkte Publikumsansprache, durch die Offenlegung der theatralen Mittel.
Das epische Theater ist im Kern politisches Theater: Es will nicht unterhalten, sondern aufklären; nicht berühren, sondern zum Denken anregen. Die Welt erscheint nicht als unveränderliches Schicksal, sondern als gestaltbar, veränderbar. Der Zuschauer soll nicht fragen „Was fühlt diese Figur?”, sondern „Warum handelt sie so? Könnte sie anders handeln?”

Gergen liest Wicked als deutlichen Kommentar auf politische Entwicklungen – sowohl vergangene als auch aktuelle. Der Zauberer von Oz ist in dieser Deutung kein skurriler Märchenherrscher, sondern ein Sinnbild autoritärer Führungsfiguren, wie sie im Europa der 1930er Jahre aufstiegen. Mit Propaganda, Angst und der Suche nach Sündenböcken gelingt es ihm, Kontrolle auszuüben und eine Gesellschaft gezielt zu spalten.
Mark Seibert verleiht dem Zauberer eine interessante, jüngere Note. Er spielt ihn nicht als alten Scharlatan, sondern als berechnenden Populisten – charmant genug, um seine Verführungskraft nachvollziehbar zu machen. Elphaba steht in diesem Gefüge für all jene, die nicht ins System passen: die Außenseiter, die Fremden, die Nonkonformen. Sie wird zum Opfer einer politisch wie medial gelenkten „Hexenjagd“, mit der das System seine Macht sichert. Ihr Rückzug in den Untergrund ist in Gergens Lesart kein Scheitern, sondern ein Akt von Freiheit und Integrität.
Diese Perspektive verleiht Wicked eine beklemmende Aktualität. Die Mechanismen, die das Stück offenlegt – das Schaffen von Feindbildern, die Erosion demokratischer Werte, die Sehnsucht nach einfachen Wahrheiten – sind keineswegs nur historische Phänomene. In Zeiten zunehmender Polarisierung, globaler Krisen und erstarkender populistischer Bewegungen gewinnt das Musical neue Brisanz. Glinda und Elphaba verkörpern zwei entgegengesetzte Strategien im Umgang mit einem Unrechtssystem: Anpassung oder Widerstand. Glinda arrangiert sich mit der Macht – aus Ehrgeiz, Angst oder Überforderung –, während Elphaba sich verweigert und den hohen Preis dafür zahlt.
Gergen bedient sich dabei der Mittel des epischen Theaters. Seine Inszenierung setzt auf eine offene, poetische und fragmentarische Form. Statt glitzernder Oz-Kulisse entsteht ein Raum, der zum Denken einlädt: Bewegungen erzählen, Choreografie wird zur Sprache. Musik und Tanz folgen diesem Ansatz – das große Spektakel bleibt zwar bestehen, wird aber stets durch einen reflektierten Unterbau gebrochen, der den Effekt nicht zum Selbstzweck werden lässt.
Ein nüchternes Baugerüst (Bühnenbild: Momme Hinrichs) statt Oz-Kitsch, Schauspieler, die Masken tragen, Glinda die nicht per Blase hereinschwebt, sondern auf eine Leiter klettert, Projektionen, die den konstruierten Charakter der Märchenwelt bloßlegen. Die Bühnentechnik bleibt größtenteils sichtbar, Kostümwechsel geschehen vor den Augen des Publikums. Gergen scheint entschlossen, das Musical gegen den Strich zu bürsten, seine politische Dimension schonungslos freizulegen.
Doch hier beginnt das Problem: Gergen folgt dieser Linie nicht konsequent. Immer wieder bricht er seine eigenen Regeln, lässt sich und das Publikum doch in die emotionale Sogwirkung von Schwartz’ Musik hineinfallen. „Frei und schwerelos” wird nicht verfremdet, sondern zelebriert – als die Broadway-Hymne, die sie nun einmal ist. Die Liebesgeschichten zwischen den Figuren werden nicht kritisch dekonstruiert, sondern sentimentalistisch ausgekostet. Die Inszenierung o(s)zilliert zwischen intellektuellem Anspruch und emotionalem Entertainment, ohne sich für eine Seite zu entscheiden.
Hier offenbart sich der fundamentale Unterschied zu den großen Regisseuren des politischen Theaters. Frank Castorf, der legendäre Volksbühnen-Intendant, hätte Wicked wahrscheinlich in einem vierstündigen Exzess völlig dekonstruiert, mit Live-Video, Indiesongs und einer radikalen Gesellschaftskritik, die das Musical als kapitalistisches Produkt selbst zum Thema gemacht hätte. Claus Peymann, der Brecht-Schüler und Handke-Freund, hätte vermutlich auf jegliche Inszenierung verzichtet und das Stück als konzertante Aufführung mit Leseprobe-Charakter präsentiert, um die Worte und die Musik sprechen zu lassen. Thomas Ostermeier, der gegenwärtig präsenteste Vertreter des politischen Regietheaters, hätte die Verfremdung wahrscheinlich subtiler eingesetzt – durch eine radikale Aktualisierung der politischen Bezüge, durch die Einbindung von Videomaterial oder durch eine naturalistische Spielweise, die den Pomp des Musicals ironisch und stilistisch bricht.
Gergen aber will beides: das Musical bewahren und es zugleich kritisch hinterfragen. Das Ergebnis ist eine Hybridinszenierung, die in den besten Momenten faszinierend schillert, in den schwächeren jedoch orientierungslos wirkt. Die Brecht’sche Verfremdung wird zum Stilmittel unter vielen, nicht zum durchgehenden Prinzip. Man könnte von „Verfremdung light” sprechen – genug, um sich als intellektuell zu profilieren, nicht genug, um wirklich zu stören.
Was diese Inszenierung über alle konzeptionellen Ungereimtheiten hinweg rettet, sind zwei herausragende Darstellerinnen. Laura Panzeri als Elphaba ist nichts weniger als eine Offenbarung. Mit einer Stimme, die an Kraft und Ausdrucksvermögen ihresgleichen sucht, macht sie aus der grünen Hexe eine tragische Heldin von shakespeareschem Format. Ihr Frei und schwerelos am Ende des ersten Aktes ist ein Moment reiner theatraler Magie – hier vergisst man alle Theorie und lässt sich einfach mitreißen. Panzeri gelingt das Kunststück, Elphabas Radikalisierung nachvollziehbar zu machen, ohne sie zu rechtfertigen oder zu verklären.

Vanessa Heinz als Glinda steht ihr in nichts nach. Ihre Glinda ist nicht die oberflächliche Blondine des Broadway-Klischees, sondern eine komplexe Figur, die zwischen Selbstinszenierung und Selbstzweifel changiert. Heinz verfügt über eine kristallklare Sopranstimme, die sowohl die komödiantischen als auch die dramatischen Momente der Partie mit scheinbarer Mühelosigkeit bewältigt. Ihr Heißgeliebt ist ein Kabinettstück physischer Komödie, komödiantisch timing-sicher und mit einer stimmlichen Präzision, die Respekt abnötigt.
Die Chemie zwischen den beiden Darstellerinnen ist spürbar und authentisch. Man nimmt ihnen die Freundschaft ab, und gerade deshalb schmerzt der Bruch. In einer Inszenierung, die oft auf Distanz setzt, schaffen Heinz und Panzeri Momente echter emotionaler Verbindung – und erinnern daran, warum dieses Musical Millionen Menschen berührt hat.
Anna Rosa Döller als Nessarose entwickelt eine bemerkenswerte Präsenz, die sich vor allem im zweiten Akt entfaltet. Mit einer schönen, ausdrucksstarken Stimme gibt sie der oft unterschätzten Rolle der Schwester Elphabas überraschende Tiefe und zeigt die tragische Dimension einer Figur, die zwischen Abhängigkeit und Machthunger zerrieben wird.

Beppo Binder liefert als Dr. Dillamond eine solide, einfühlsame Darstellung der Ziegen-Figur, die exemplarisch für die Unterdrückten steht. Jens Emmert als Boq fügt sich unaufdringlich ins Ensemble ein und erfüllt seine Aufgabe mit professioneller Zuverlässigkeit.
Problematisch wird es vor allem bei Timotheus Hollweg als Fiyero. Weder sängerisch noch darstellerisch gelingt es ihm, die Figur mit Leben zu füllen. Der charmante Rebell, der eigentlich Leichtigkeit, Verführungskraft und innere Zerrissenheit zugleich verkörpern sollte, bleibt erschreckend farblos. Hollweg wirkt unsicher in der Darstellung, seine Stimme fehlt es an Strahlkraft und Charakter. Wo Funken überspringen sollten, bleibt Leerlauf. Selbst seine solide tänzerische Leistung kann die Leere dieser Interpretation nicht kaschieren. Für eine so zentrale Rolle ist das schlicht zu wenig.
Maya Hakvoort als Madame Morrible, eigentlich eine Paraderolle für eine erfahrene Darstellerin, bleibt weit unter ihren Möglichkeiten. Vor allem schauspielerisch wirkt die Figur zu glatt, zu eindimensional. Der dämonische Bruch, den die Figur im zweiten Akt vollziehen sollte – von der scheinbar mütterlichen Mentorin zur skrupellosen Handlangerin der Macht –, wird nicht sichtbar. Hier fehlt die Abgründigkeit, die die Rolle dringend bräuchte.

Andreas Gergens Wicked am Theater Baden ist ein ambitioniertes Experiment, das wichtige Fragen aufwirft: Wer entscheidet, was gut und was böse ist? Welche Verantwortung trägt der Einzelne in einem kollektiven Machtgefüge? Und was bedeutet Zivilcourage in einer Welt, die lieber verurteilt als hinterfragt? Die Idee, ein kommerzielles Musical mit den Mitteln des epischen Theaters zu hinterfragen, ist reizvoll und angesichts der politischen Brisanz des Stoffes durchaus legitim. Doch Gergen scheut die letzte Konsequenz. Seine Inszenierung will das Musical nicht wirklich zerstören oder grundlegend neu denken – sie will es nur ein bisschen aufrauen, ihm einen intellektuellen Anstrich geben, dabei aber die Mittel des Musiktheaters nutzen, um zu berühren, zu unterhalten und zum Denken anzuregen. Das Ergebnis ist etwas widersprüchlich: Für Puristen des Musiktheaters zu kopflastig und sperrig, für Anhänger des Regietheaters zu zahm und kompromissbereit. Es ist eine Inszenierung, die mehr verspricht, als sie einlöst – aber gerade in diesem Spannungsfeld auch faszinierende Momente schafft. Dass der Abend dennoch auf beeindruckende Weise funktioniert, liegt am exzellenten Kern des Ensembles, allen voran Laura Panzeri und Vanessa Heinz, die beweisen, dass großes Musiktheater auch in konzeptionell gewagten Inszenierungen möglich ist. Sie sind es, die dem Publikum einen Grund geben, wiederzukommen – und sie erheben diesen Abend trotz aller Ungereimtheiten zu einem denkwürdigen Theatererlebnis.

Am Ende bleibt die Frage: Braucht Wicked eine Brecht’sche Verfremdung? Ist das Musical nicht bereits subversiv genug in seiner Infragestellung von Gut und Böse, in seiner Kritik an Propaganda und Autoritätshörigkeit? Vielleicht ist die ehrlichste Form der Inszenierung diejenige, die sich dem emotionalen Sog des Werkes hingibt, statt ihn intellektuell einzuhegen. Oder vielleicht hätte Gergen noch radikaler sein müssen – ganz Brecht oder gar nicht. So bleibt diese Produktion ein Hybrid, ein Kompromiss: interessant, diskussionswürdig, getragen von zwei außergewöhnlichen Darstellerinnen, aber nicht restlos überzeugend. Ein Theater-Experiment, das zeigt, dass gute Absichten und interessante Ideen nicht automatisch zu großem Theater führen. Aber vielleicht ist auch das eine wichtige Erkenntnis – und im Sinne Brechts durchaus produktiv. Gerade im Märchenhaften liegt die Möglichkeit, komplexe gesellschaftliche Fragen in greifbarer Form zu erzählen und diese Produktion beweist: Das Gespräch darüber hat gerade erst begonnen.
Review: COME FROM AWAY
Deutsches Theater München


von Marcel Eckerlein-Konrath
Was für ein Abend. Was für ein Ensemble. Was für ein Geschenk von einem Musical.
Mit Come From Away ist dem Theater Regensburg unter der kongenialen Regie von Sebastian Ritschel ein bewegendes, zutiefst menschliches Bühnenerlebnis gelungen, das nicht nur berührt sondern mitten ins Herz mit voller Wucht trifft: nicht durch Spektakel, sondern durch Wärme, Tiefe und eine ungewöhnlich große Menschlichkeit. Nun ist die Erfolgsproduktion zu Gast im Deutschen Theater München, und das Publikum dankt es mit stehenden Ovationen und ehrlichen Tränen. Völlig zu Recht.
Das Stück von Irene Sankoff und David Hein basiert auf wahren Ereignissen. Nach den Anschlägen des 11. September 2001 mussten 38 Flugzeuge auf dem kleinen Flughafen von Gander, Neufundland, notlanden. Über 6.500 Menschen aus aller Welt strandeten dort und wurden von den 10.000 Einwohnern mit offenen Armen aufgenommen. Innerhalb von fünf Tagen entstanden Freundschaften, tiefe Verbindungen – und Erfahrungen, die niemand je vergessen sollte.
Ritschel gelingt das Kunststück, diese große, globale Geschichte ganz leise zu erzählen. Ohne Melodramatik, ohne Pathos, dafür aber mit großer Klarheit, Struktur und einem bemerkenswerten Gespür für emotionale Wahrhaftigkeit. Es gibt keine Hauptfiguren, keine Helden im klassischen Sinn. Und doch steht am Ende eine ganze Gemeinschaft im Mittelpunkt – auf der Bühne und im Zuschauerraum.
Das Herzstück dieser Inszenierung ist das Ensemble, das mit überwältigender Geschlossenheit und Präsenz agiert. Es gibt keine schwachen Momente, kein Nebeneinander; alle arbeiten sichtbar füreinander, miteinander. Jede und jeder wechselt mehrfach die Rolle, springt zwischen Einwohnern und „Plane People“, wechselt Haltungen, Temperamente und bleibt dabei stets glaubwürdig. Diese Wandelbarkeit ist nicht nur technisch beeindruckend, sondern in ihrer Leichtigkeit schlicht berührend.

Wietske van Tongeren als Beverley Bass, die erste Kapitänin von American Airlines, verleiht ihrem großen Solo “Me and the Sky“ eine schmerzhafte Aufrichtigkeit – eine Karrierefrau, die sich plötzlich selbst neu verorten muss.
Masengu Kanyinda berührt als Hannah mit einer stillen, tief empfundenen Präsenz. Ihre Verzweiflung um den Sohn, von dem es kein Lebenszeichen gibt, trifft mitten ins Herz.
Andreas Bieber und Alejandro Nicolás Firlei Fernández geben als das schwule Paar Kevin T. und Kevin J. eine fein gezeichnete Darstellung zweier Männer, deren Beziehung in der Ausnahmesituation zu bröckeln beginnt. Ihre Szenen sind leise, voller Zwischentöne und genau deshalb so stark.
Patricia Hodell als Beulah ist eine Offenbarung an Herzenswärme, Pragmatismus und trockenem Humor. Jogi Kaiser und Maria Mucha lassen als das frisch verliebte Paar Nick und Diane spürbar werden, wie sich zwischen zwei Fremden in kürzester Zeit echte Nähe entwickeln kann.
Hinzu kommen Lionel von Lawrence, Felix Rabas, Scarlett Pulwey, Fabiana Locke und Benedikt Eder – allesamt mit mitreißender Bühnenenergie, stets präsent, ob als Busfahrer, Reporterin, Tierärztin oder jüdischer Passagier.
Jeder einzelne Moment ist fein gearbeitet und voller Wahrhaftigkeit. Gemeinsam bilden sie ein Geflecht aus Stimmen, Körpern, Persönlichkeiten – ein Ensemble, das sich wie ein einziger, vielstimmiger Atem anfühlt. Sie alle tragen das Stück gemeinsam, erzählen große Geschichten mit kleinen Gesten. In dieser Produktion gibt es keine Hauptrollen im klassischen Sinne und gerade das macht ihren Zauber aus. Ein durch und durch gleichwertiges Ensemble, das in jeder Konstellation überzeugt und mit bewegenden, ehrlichen Momenten eine Sternstunde nach der anderen schafft.
Die Bühne von Kristopher Kempf ist reduziert, fast karg – Holzstühle, Tische. Doch aus dieser Reduktion entsteht eine Dichte, die fast körperlich spürbar ist. Jede Szene geht nahtlos in die nächste über. Mit minimalem Aufwand entstehen Busfahrten, Flugzeuggänge, Warteräume und provisorische Notunterkünfte. Es ist faszinierend, wie ein kurzer Lichtwechsel (gestaltet von Maximilian Rudolph) plötzlich ganze Räume und Welten öffnet.
Die Choreografie von Gabriel Pitoni bleibt bewusst zurückgenommen – sie lebt von kleinen Gesten, beiläufigen rhythmischen Bewegungen, einem Luftholen. Nichts wirkt künstlich oder plakativ, alles ergibt sich ganz organisch aus dem Spiel.
Musikalisch führt Ben Weishaupt die exzellent aufspielende Band mit sicherer Hand durch das abwechslungsreiche Spektrum der Partitur. Von gälischen Folkmotiven über erdige Poprhythmen bis zu stillen, fast meditativen Momenten: die Musik ist hier nicht nur Begleitung, sondern treibende Kraft der Erzählung.
Was diesen Abend so besonders macht, ist die emotionale Aufrichtigkeit, mit der hier gespielt, erzählt und gesungen wird. Man lacht, man schluckt, man hat Tränen in den Augen – und am Ende steht man, überwältigt und tief bewegt. Come From Away ist kein Musical über eine Katastrophe. Es ist ein Musical über das, was danach möglich ist. Über Begegnung. Freundschaft. Hoffnung. Und über die unerschütterliche Kraft von Mitgefühl.
Dass das Theater Regensburg diese Produktion mit solch einem Niveau und solcher Liebe auf die Bühne bringt, ist ein großes Geschenk.
Gerade in einer Welt, die oft von Unsicherheit und Abgrenzung geprägt ist, zeigt Come From Away eindrucksvoll, dass Mitgefühl im Kleinen beginnt. Es braucht kein großes Heldentum: manchmal reicht es, einfach da zu sein und die Tür zu öffnen.

Review: LA CAGE AUX FOLLES
Staatstheater Nürnberg


von Marcel Eckerlein-Konrath
In einer Zeit, in der Bundestagsabgeordnete wie Julia Klöckner im Brustton der Überzeugung fordern, die Regenbogenflagge nicht mehr vor Bundesministerien wehen zu lassen, setzt das Staatstheater Nürnberg mit La Cage aux Folles ein leuchtendes Zeichen für Liebe, Freiheit und Sichtbarkeit – mit Glitzer, Humor, sehr viel Herz und allen leuchtenden Farben des Regenbogens.
Regisseurin und Choreografin Melissa King gehört längst zu den innovativsten Stimmen auf deutschen Bühnen. In ihrer Inszenierung wird schnell klar: Sie will nicht nur unterhalten, sondern Haltung zeigen, einen queeren Raum schaffen, der warm, lebendig und politisch ist. „Ich wollte diese Tatsachen nicht einfach beiseiteschieben und das Stück in den achtziger Jahren belassen, als wenn wir heute mit dieser Problematik nichts mehr zu tun hätten. Es hat mit uns zu tun, und deswegen habe ich es in die Gegenwart geholt.“ Und die Gegenwart, das zeigt King ganz bewusst, ist ambivalent. Zwar ist Drag durch Formate wie RuPaul’s Drag Race, Serien wie Pose oder Transparent im Mainstream angekommen, doch die politische Realität sieht oft anders aus. Hate Speech, Übergriffe, gesetzliche Rückschritte – nicht nur in Polen oder Italien, auch mitten in Deutschland. Der Streit um eine Prideflagge vor dem Bundesministerium, ist kein Randthema. Es ist symptomatisch für ein Klima, in dem queere Sichtbarkeit plötzlich wieder erklärungsbedürftig wird.
Gegen dieses Klima stemmt sich die Nürnberger Inszenierung mit aller Kraft, ohne zu moralisieren. King hat sorgfältig recherchiert, sich von Künstler*innen wie Billy Porter, Sasha Velour oder Taylor Mac inspirieren lassen. Für sie ist Drag ein „Mittel, dem Mainstream zu sagen: Wenn ihr uns nicht wahrnehmt, dann zwingen wir euch, hinzusehen.“ Ihre Cagelles sind nicht nur herrlich schrille Paradiesvögel, sondern individuell, genderfluid und somit ganz verschieden. Sie spielen dabei mit Klischees, ohne sich auf sie zu reduzieren. So wird aus Revue politische Performance, aus Glitzer eine Haltung. Das Bühnenbild von Stephan Prattes spiegelt diese Idee auf mehreren Ebenen wider. Herzen, Regenbogen, stilisierte Geschlechtsorgane als wiederkehrende Motive, charmant, witzig und subtil eingesetzt. Die Cagelles treten in Kostümen auf, die an die detailverliebte Verspieltheit einer Marina Hoermanseder erinnern – Prattes hat hier sichtlich mit viel Passion gearbeitet. Ebenso stark: Terry Alfaro als Zofe Jacob, der in diesen Kostümen ein komisches und visuelles Highlight nach dem anderen setzt.

Die Uniformen des stockkonservativen Ehepaars Dindon (sehr pointiert gespielt von Thorsten Tinney und Kira Primke) erinnern in Farbwahl und steifer Formensprache frappierend an das Auftreten jener politischen Kräfte, die in Talkshows gern von „Tradition“ sprechen und in Wirklichkeit ein Weltbild propagieren, das Vielfalt als Bedrohung sieht.
Im Zentrum aber stehen zwei Menschen, die sich lieben. Marin Berger als Georges und Gaines Hall als Albin: ein Paar, das getragen ist von Zärtlichkeit, Wärme, aber auch realer Reibung. Berger überzeugt mit stiller Fürsorge, man glaubt ihm jede Geste. Wenn er seinem Partner den Rücken stärkt oder für seinen Sohn kämpft, dann wirkt das wie echte gelebte Erfahrung. Hall hingegen gibt den großen Entertainer mit manchmal etwas zu sehr Boulevard, manchmal fehlt die Tiefe, aber wenn er Ich bin, was ich bin singt, dann gehört die Bühne ihm allein. Dieser Song ist kein Musicalmoment mehr , sondern eine Hymne. Eine Kampfansage. Eine Umarmung. Dieser Song, längst losgelöst von seinem Musicalkontext, entfaltet hier seine ganze Wucht. Hall macht aus dieser Nummer eine Selbstermächtigung, ein unmissverständliches „Hier bin ich“ – für Albin, für Drag-Künstler*innen, für queere Menschen, für alle, die sich erklären und rechtfertigen mussten, nur weil sie sie selbst sind. Seit über vier Jahrzehnten steht dieser Song für Stolz, Verletzlichkeit und Widerstand. Und in diesem Moment wird er zum emotionalen Höhepunkt des Abends und zum perfekten Ende des ersten Aktes.
Ein besonderer Lichtblick: Fabio Kopf als Jean-Michel. Die Rolle ist dramaturgisch oft undankbar, doch Kopf macht daraus etwas Eigenes: Mit klarer Stimme, aufrichtiger Emotion und natürlicher Präsenz wird seine Entwicklung vom fordernden zum dankbaren Sohn zu einem der berührendsten Bögen des Abends. Kopf spielt ihn mit aufrichtigem Ernst, sein Gesang ist kraftvoll, seine Präsenz unaufdringlich. Er ist ein starker junger Schauspieler, der aus einer eher unterentwickelten Nebenfigur einen Menschen macht.
Die Historie von La Cage aux Folles ist selbst ein kleines Wunder. Ursprünglich ein französisches Theaterstück, dann ein Überraschungshit im Programmkino und schließlich 1983 ein Broadway-Musical, das gegen alle Widerstände zum Erfolg wurde. In einer Zeit, als AIDS Panik und Homophobie schürte, erzählte es von einem homosexuellen Paar, das seit 20 Jahren zusammenlebt und ein Kind großgezogen hat – mit Liebe, Verantwortung, Humor.
King erinnert daran, dass die queere Community immer auch politisch war: „The personal is political – das gilt auch für Drag. Ich wollte zeigen, dass es nicht nur um Glitzer geht, sondern um Ausdruck, um Kampf, um ein Sich-Behaupten gegen das Unsichtbarmachen.“
Man kann der Inszenierung vorwerfen, sie sei stellenweise plakativ. Ja, manche Bilder sind überdeutlich, manches wirkt bewusst auf Provokation hin gebaut. Doch in der heutigen politischen Lage ist genau das vielleicht nötig. Es ist keine Zeit für Andeutungen.
Wir leben in einer Zeit, in der queeres Leben erneut in Frage gestellt, Sichtbarkeit wieder zur Provokation wird und das öffentliche Bekenntnis zur Vielfalt von bestimmten politischen Kräften systematisch diffamiert wird. In so einer Lage darf Theater nicht flüstern. Es muss laut sein dürfen und Haltung zeigen und dabei glitzern, tanzen, schreien, fordern.
Melissa Kings Inszenierung von La Cage aux Folles tut genau das. Sie ist bewusst überzeichnet, bewusst bunt, bewusst politisch. Sie macht keine Kompromisse, wenn es um Haltung geht. Und sie stellt sich ganz klar gegen ein Weltbild, das Menschen in enge Kategorien pressen und alles Abweichende unsichtbar machen will. Deshalb ist diese Produktion nicht nur ästhetisch reizvoll, sie ist auch gesellschaftlich relevant: ein notwendiges Statement in einer Zeit, in der Drag-Lesungen verboten, queere Flaggen abgehängt und Debatten über „natürliche Rollenbilder“ wieder salonfähig werden.
Diese Inszenierung ist kein nostalgischer Rückblick auf ein Musical aus den 80ern – sie ist ein Kommentar zum Jetzt. Und ein Plädoyer für eine Zukunft, in der Menschen lieben dürfen, wen sie wollen, und leben dürfen, wie sie sind. Sie fragt uns: Was bedeutet Familie wirklich? Wer hat das Recht, sichtbar zu sein? Und was tun wir, wenn die Räume enger werden?
La Cage aux Folles in Nürnberg ist nicht nur eine Hommage an ein Stück Theatergeschichte. Es ist eine Erinnerung daran, dass Bühne Widerstand leisten kann und muss. Und dass sie dabei das Wichtigste nicht aus den Augen verliert: die Liebe.
Gerade jetzt brauchen wir beides.



Review: Disneys DIE EISKÖNIGIN
Palladium Theater Stuttgart


von Marcel Eckerlein-Konrath
Wenn der Vorhang fällt und man für einen Moment vergisst, dass man im Theatersessel sitzt – dann hat ein Abend etwas richtig gemacht. Die Eiskönigin im Palladium Theater in Stuttgart schafft genau das: Es entführt in eine Welt aus Eis und Emotion, bleibt nah an der beliebten Filmvorlage und erzählt doch auf eigene, tiefere Weise weiter. Keine bloße Imitation, sondern ein Musical mit Haltung, Herz – und einer klaren Botschaft.
Es ist eine emotionale Reise, die ganz von der Beziehung zweier Schwestern lebt: so gegensätzlich sie auch sind, verbindet sie ein tiefes, unausgesprochenes Band. Ihre Verbindung steht unangefochten im Zentrum der Inszenierung und verleiht der Geschichte ihre emotionale Wucht. Elsa besitzt magische Kräfte, die sie nicht kontrollieren kann. Als sie versehentlich den ewigen Winter über ihr Königreich Arendelle bringt, flieht sie in die Einsamkeit. Ihre jüngere Schwester Anna macht sich auf eine abenteuerliche Reise, um Elsa zurückzuholen…
Regisseur Michael Grandage bringt die Essenz der Geschichte treffend auf den Punkt: „Das Bemerkenswerte am Genie [der Geschichte] ist, dass es zunächst wie ein klassisches Disney-Märchen daherkommt – und dann alle Erwartungen sprengt. Die Idee, dass am Ende die familiäre Liebe im Mittelpunkt steht, ist ein wunderbarer Ansatz, dem wir auf der Bühne nachgehen konnten.“
Und genau das tut er: Grandage inszeniert Die Eiskönigin nicht als glitzerndes Spektakel, sondern als modernes Märchen über Verantwortung, Angst, Selbstermächtigung – und vor allem über Liebe. Die Beziehung zwischen Anna und Elsa steht dabei klar im Zentrum und gewinnt in der Bühnenfassung noch mehr emotionale Tiefe als im Film.
Dabei fällt auf, wie viele der kleinen Logikbrüche aus dem Animationsfilm hier elegant ausgebessert wurden: Elsas innere Kämpfe sind greifbarer, Annas Motivation nachvollziehbarer. Die Handlung wirkt runder, die Figuren erhalten mehr Raum – ohne dass der märchenhafte Drive der Vorlage verloren ginge.
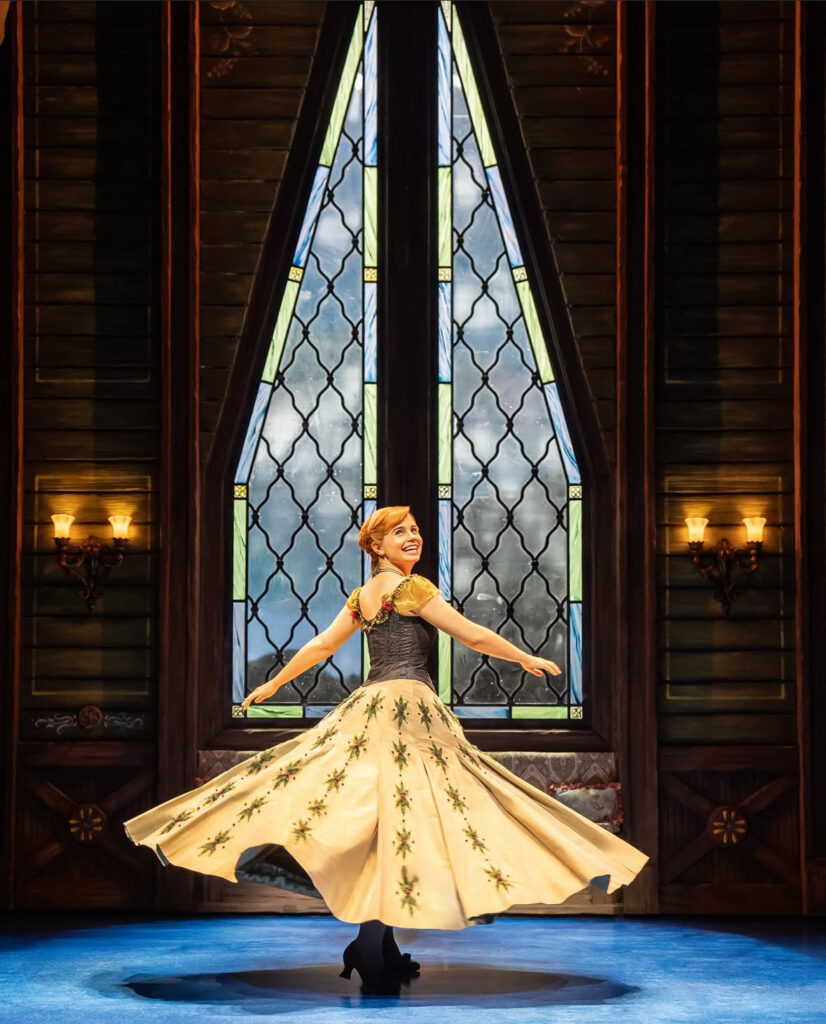
Kim Fölmli ist als Anna ein Ereignis und bringt eine ganz und gar unkonventionelle Note auf die Bühne. Sie ist alles andere als die typische Prinzessin: quirlig, impulsiv, voller Witz und dabei stets glaubwürdig. Ihre Anna denkt und handelt aus dem Bauch heraus, fällt hin, steht wieder auf – mit einem kindlichen Mut und einer Offenheit, die berührt. Förmli spielt diese Mischung aus jugendlichem Übermut und echter Verletzlichkeit mit beachtlicher Präzision. Sie findet genau den richtigen Ton zwischen komödiantischer Leichtigkeit und tiefer Emotionalität – etwa in Momenten, in denen Annas Einsamkeit durchbricht oder ihr kindlicher Glaube an das Gute wankt. Gesanglich überzeugt sie mit einer klaren, ausdrucksstarken Stimme, die selbst in den lauteren Nummern nie überzeichnet wirkt, sondern eine ehrliche Wärme behält.
Fölmli ist ein Geschenk an diese Inszenierung. Ihre Darstellung lebt von einem natürlichen, fast mühelosen Charme, der das Publikum sofort auf ihre Seite zieht. Sie spielt nicht „frech“, sie ist es – aber mit so viel Herz, Wärme und Witz, dass man ihr einfach alles abnimmt. Besonders spürbar wird ihr Talent für Timing und feine Komik im Song Zum ersten Mal seit Ewigkeiten, wenn sie mit kindlicher Aufregung durch das Schloss tanzt, bei dem jedes Stolpern, jede kleine Geste sitzt, ohne kalkuliert zu wirken. Das ist perfektes comic timing. Und wenn später das Duett Liebe, sie öffnet Tür’n mit dem zwielichtigen Hans erklingt, zeigt Fölmli eine wunderbar selbstironische Leichtigkeit. Sie spielt die überstürzte Verliebtheit mit so viel Spielfreude, dass man gleichzeitig lachen und ihr eine Umarmung anbieten möchte.
Doch sie kann auch anders. In Du bist alles, dem gefühlvollen Duett mit Elsa, offenbart sie eine tiefer liegende emotionale Seite. Hier blitzt zwischen aller Leichtigkeit plötzlich große Ernsthaftigkeit auf: die Sehnsucht nach Nähe, die Verzweiflung über die wachsende Distanz zur Schwester. Fölmli gelingt es, diese emotionale Öffnung mit genau der Aufrichtigkeit zu spielen, die der Moment braucht: berührend, ehrlich, ohne einen Hauch von Pathos.
Gerade in ihrer Vielstimmigkeit wirkt Fölmlis Anna so glaubwürdig. Sie wechselt mühelos zwischen Komik und Ernst, zwischen Übermut und echter Verletzlichkeit. Ihr Spiel ist facettenreich, aber nie ausgestellt, denn jede Reaktion, jede Pointe scheint aus dem Moment heraus zu entstehen. So entsteht eine Figur, die nicht gespielt wirkt, sondern gelebt. Man glaubt ihr jede Sekunde – weil sie gar nicht versucht, zu beeindrucken. Und genau darin liegt ihre große Stärke.
Ann-Sophie verleiht Elsa eine stille, majestätische Präsenz – eine Figur, die nicht laut werden muss, um Eindruck zu hinterlassen. Ihre Elsa ist beherrscht, zurückgenommen, von einer inneren Anspannung durchzogen, die man förmlich greifen kann. Unter der makellosen Fassade lodert ein Feuer aus Angst, Schuld und Sehnsucht – und gerade dieses kontrollierte Ringen macht sie so berührend.
Ann-Sophie spielt nicht, sie hält dagegen – mit aufrechter Haltung, klarer Mimik, jedem Zentimeter Körper Spannung. Und wenn sie singt, bricht diese Zurückhaltung wie unzählige Eisschichten. Lass jetzt los wird bei ihr nicht nur zur Befreiung, sondern zur existenziellen Selbstoffenbarung. Es ist der Moment, in dem Elsa sich zum ersten Mal erlaubt, ganz sie selbst zu sein. Ohne Rücksicht. Ohne Entschuldigung. Ein Aufschrei ins eigene Schweigen.
Stimmlich balanciert sie eindrucksvoll zwischen Zerbrechlichkeit und Kraft. Ihre Stimme erhebt sich und trägt durch ein Arrangement, das auf überflüssiges Pathos verzichtet und dem Lied die Würde und Weite gibt, die es braucht. Visuell präzise und klug inszeniert, entfaltet sich ein Gänsehautmoment, der über das bekannte Disney-Bild hinausweist.

Auch Monster, der für die Bühnenfassung neu geschriebene Song im zweiten Akt, wird bei Ann-Sophie zur dramatischen Klammer der Figur. Hier bekommt Elsas innere Zerrissenheit endlich Worte – ihre Angst, anderen zu schaden, ihre Verzweiflung, nicht dazugehören zu können. Es ist ein Moment der Selbstkonfrontation, ein Blick in den Abgrund, der weit über die Vorlage hinausgeht. Dass dieser Song nicht einfach ein Zusatz, sondern dramaturgisch klug gesetzt ist, verleiht Elsas Entwicklung eine neue Tiefe.
Gemeinsam bilden Anna und Elsa das emotionale Rückgrat des Abends – zwei Frauen, die auf völlig unterschiedliche Weise ihren Platz in der Welt suchen und erst über ihre Verbindung zueinander zu sich selbst finden. Es ist diese Schwesternliebe, die das Stück trägt – nicht als kitschige Botschaft, sondern als ehrlich erlebte Beziehung mit Höhen, Brüchen und einem zutiefst menschlichen Kern.
Auch das restliche Ensemble überzeugt. Jonathan Hamouda Kügler als Kristoff ist bodenständig charmant, Kaj-Louis Lucke als Olaf ein komödiantisches Geschenk, das mit perfektem Timing und viel Herz brilliert, ohne je ins Überdrehte abzurutschen. Und dann wäre da noch Paolo Ava, der als Rentier Sven nahezu unsichtbar sichtbar ist – eine physische Meisterleistung, die den tierischen Begleiter auf poetische Weise lebendig macht.
Einzige echte Schwachstelle: Simon Loughton als Hans. Während die Figur dramaturgisch ohnehin nie über die eindimensionale Disney-Schurkenrolle hinauswächst, bleibt hier auch darstellerisch vieles vage. Text, Haltung, Rhythmus wirken, als wäre er nicht ganz in seiner Rolle angekommen. Eine leider verschenkte Chance.
Die Eiskönigin am Palladium Theater ist weit mehr als ein effektvoll aufpolierter Disney-Export. Die Inszenierung trifft den emotionalen Kern der Geschichte und legt ihn frei. Im Mittelpunkt stehen nicht Magie oder märchenhafte Kulissen, sondern zwei Schwestern, deren Beziehung glaubhaft, vielschichtig und berührend erzählt wird. Kim Fölmli als Anna begeistert mit überschäumender Spielfreude und feinem komödiantischen Gespür, Ann-Sophie gibt Elsa Tiefe, Würde und eine Stimme, die unter die Haut geht und dem Stuttgarter Ensemble gelingt eine kraftvolle, mitreißende Umsetzung des Stoffes. Am Ende ist Die Eiskönigin ein Stück über Nähe und Distanz, über Angst und Mut – und über die Erkenntnis, dass wahre Liebe nicht gerettet werden muss, sondern rettet. Und wenn Anna Elsa mit offenem Herzen gegenübertritt, bricht nicht nur das Eis. Dann taut auch das Publikum.



alle Fotos von Johan Persson
Review: Disneys TARZAN
Apollo Theater Stuttgart


von Marcel Eckerlein-Konrath
Es ist eine der ältesten und emotionalsten Geschichten der Welt: Ein Kind verliert alles – und findet eine neue Familie dort, wo man sie nicht erwartet hätte. In Tarzan, aktuell auf der Bühne des Stage Apollo Theaters in Stuttgart, wird diese Geschichte zu einem bewegenden Abend über Zugehörigkeit, Liebe und die Frage, was uns zu dem macht, was wir sind. Ein Findelkind zwischen zwei Welten, aufgezogen von Gorillas, hin- und hergerissen zwischen Instinkt und Identität.
Schon der Beginn ist stark: Nach einem Schiffsunglück strandet ein junges Paar mit ihrem Baby im Dschungel – wenig später bleiben nur noch Spuren von ihnen zurück. Der kleine Tarzan wird von der Gorillamutter Kala gefunden und aufgenommen. Phil Collins hat diesem Stoff mit seinen Songs eine emotionale Tiefe verliehen, die sich seither unauslöschlich in viele Köpfe gebrannt hat. In Stuttgart versucht die aktuelle Musicalproduktion, diese Magie auf die Bühne zu bringen – mit viel Bewegung, Aufwand und durchaus gemischtem Ergebnis.
Der kleine Tarzan (in der besuchten Vorstellung von Jonas gespielt) prägt den ersten Akt mit erstaunlicher Präsenz. Wild, neugierig, verletzlich – er bringt all das mit, was diese Figur so besonders macht. Auch wenn gesanglich nicht jeder Ton sicher sitzt, trägt er die ersten Szenen mit einer bemerkenswerten Energie. Der Übergang zum erwachsenen Tarzan gelingt visuell mühelos, wirkt aber emotional etwas abrupt. Bob van de Weijdeven bringt viel Spielfreude und eine eindrucksvolle körperliche Präsenz mit, die seine Szenen glaubhaft tragen. Besonders in den Momenten der inneren Zerrissenheit zeigt er, wie nah Tarzans Herz an der Oberfläche schlägt. Seine Darstellung ist berührend, auch wenn gesanglich nicht durchgehend sicher.
Marle Martens als Kala liefert das emotionale Glanzlicht des Abends. Ihre Interpretation der Gorilla-Mutter Kala ist zart, kraftvoll und liebevoll. Wenn Martens dem verwaisten Tarzan vorsichtig gegenübertritt, ihn vorsichtig mustert und schließlich in dem Lied Dir gehört mein Herz ihre bedingungslose Liebe erklärt ist das ein einfacher, aber wunderschöner Moment, der vieles sagt: Familie ist nicht immer Blut. Familie ist das, was man füreinander empfindet.
Diese Szene ist kein Zufallstreffer, denn sie bildet den emotionalen Kern der Geschichte. Tarzan wächst in dieser Tierwelt auf, fühlt sich seiner Gorillafamilie verbunden, lebt nach ihren Regeln, lernt ihre Sprache. Die Inszenierung schafft es dabei, mit viel Bewegung, eindrucksvoller Luftakrobatik und immer wieder auch stillen Szenen diese Welt erfahrbar zu machen.
Matthias Otte verleiht Kerchak eine eindrucksvolle Gravitas. Mit ruhiger, körperlicher Präsenz und kontrollierter Strenge wirkt er wie ein Fels inmitten des aufgewühlten Dschungels. Seine Autorität ist spürbar – er ist ein Anführer, der sich Respekt nicht erkämpfen muss, sondern ihn durch Haltung allein einfordert. Gerade in den stilleren Momenten, in denen Kerchak zwischen Pflichtgefühl und unterdrückter Fürsorge schwankt, bekommt die Figur durch Otte Tiefe.
Judith Caspari als Jane ist fast eine 1:1-Übersetzung der Disney-Vorlage. Sie quirlig, klug, liebenswert. Ihr Duett Auf einmal mit van de Weijdeven im zweiten Akt gehört zu den ganz starken Momenten, in denen Musik, Spiel und Szene perfekt greifen.
Luciano Mercoli ist als Clayton der typische, eindimensionale Disney-Schurke, mit schleimiger Attitüde und klarer Agenda. Dass er als Einziger ausschließlich spricht, fällt positiv auf, denn er nutzt seine Möglichkeiten, um die Figur mit Nuancen zu füllen, wo eigentlich kaum Tiefe vorgesehen ist.
Weniger überzeugend: Elindo Avastia als Terk. Was beim Disney Original ein quirliger, frecher Sidekick ist, wirkt hier überdreht und – vor allem – kaum verständlich. Das sollte bei einer deutschsprachigen Produktion nicht passieren. Zumal es an ausgebildeten Musicaldarstellern im Land sicher nicht mangelt. Dass dann auch noch schwäbische Floskeln bemüht werden, macht es nicht besser. Humor, der aufgesetzt wirkt, zündet selten.

Ein spürbarer Verlust ist die komplett gestrichene Rolle von Janes Vater. In früheren Inszenierungen war dieser schrullige, liebenswert zerstreute Wissenschaftler weit mehr als nur Begleitfigur: Er brachte eine humorvolle Tiefe mit, sorgte für kleine, kluge Zwischentöne und war zugleich ein wichtiges Gegengewicht zur Dschungelhandlung. Seine neugierige, leicht versponnene Art verlieh der Geschichte eine menschliche Wärme und schuf auch für Jane eine greifbare Herkunft, ein Gegenüber, an dem sie sich reiben und wachsen konnte.
In der aktuellen Stuttgarter Fassung wurde diese Figur vollständig gestrichen. Statt lebendiger Vater-Tochter-Dynamik bleibt Jane nun allein auf der Bühne zurück und sinniert extrem oft über eine Vaterfigur, die das Publikum nie zu sehen bekommt. Es entsteht eine spürbare Lücke, denn einer der wenigen menschlichen Stimmen inmitten einer tierischen Welt fehlt, und damit auch ein Teil der Balance. Man merkt: Hier wurde leider an der falschen Stelle gekürzt.
Einige Dialoge wirken unnötig gestreckt, Pointen verpuffen, weil das Timing nicht immer sitzt. Gerade in ruhigeren Passagen schleichen sich Längen ein, die den Fluss der Inszenierung bremsen. Man merkt, dass das Stück nicht durchgängig die gleiche rhythmische Präzision hat wie in seinen starken Momenten.
Als in der Mitte des zweiten Aktes ein Junge in der Reihe vor mir seine Großmutter leise fragt: „Dauert es noch lange?“, war das zwar ein ehrlicher Kindermoment – aber eben auch ein Zeichen dafür, dass die Spannung in diesem Moment nicht mehr ganz trägt. Und er war mit dieser Frage vermutlich nicht allein im Saal. Solche Szenen zeigen, wie sensibel ein Musical ausbalanciert sein muss, damit der Zauber nicht verfliegt.
Ein echtes Highlight von Tarzan sind die Luftszenen: Immer wieder schwingen sich die Darsteller in atemberaubender Höhe über das Publikum hinweg – mal lautlos gleitend, mal mit vollem Körpereinsatz durch das Licht, das zwischen Lianen und Nebel fällt. Diese Momente verleihen der Show eine eigene Dynamik, die man in dieser Form selten erlebt. Wenn Tarzan in einem Bogen über die Köpfe der Zuschauer hinweg durch den Saal fliegt oder Kala in einer luftigen Szene schwebt, dann hält man kurz den Atem an. Es ist beeindruckend, was hier artistisch geleistet wird.
Gerade weil diese Szenen so eindrücklich sind, ist es umso bedauerlicher, dass nicht alle Plätze im Saal dieselben Voraussetzungen bieten, um dieses Erlebnis voll auszukosten. Wer ein sogenanntes Premium oder gar Premium+ Ticket bucht – und damit bereit ist, einen dreistelligen Betrag für einen Sitzplatz auszugeben – darf zu Recht erwarten, auch visuell das volle Programm zu bekommen. Doch genau hier liegt das Problem: Viele dieser hochpreisigen Plätze liegen seitlich am Rand des Saals. Und von dort sind nicht nur einzelne Details auf der Bühne schlecht einsehbar – es entgehen einem ganze szenische Abläufe, etwa wenn Figuren von der jeweils gegenüberliegenden Seite in die Luft starten oder zentrale Aktionen in den Seitenkulissen stattfinden.
Dass man für einen Sitzplatz mit eingeschränkter Sicht denselben Preis bezahlt wie für die besten Plätze im Zentrum, wirkt in diesem Kontext nicht nur unglücklich, sondern schlicht unangemessen. Bei einem Musical, das so stark über Bewegung, Bühne und Raumwirkung erzählt und sich definiert, wäre eine Preispolitik begrüßenswert, die diesem Umstand Rechnung trägt. Wer hier Premium zahlt, bekommt nicht automatisch auch ein Premium-Erlebnis. Und das sollte nicht der Fall sein.
Tarzan in Stuttgart ist technisch beeindruckend, voller Energie und mit einem spielfreudigen Ensemble besetzt. Die Musik von Phil Collins trägt nach wie vor, auch wenn Inszenierung und Besetzung nicht durchgängig mithalten können. Luftakrobatik und Showelemente bieten echten Schauwert, dramaturgisch bleiben zwar Lücken, dennoch ist Tarzan ein starkes Musicalerlebnis mit Gänsehautmomenten.

alle Fotos von Johan Persson
Review: MERRILY WE ROLL ALONG
Theater Regensburg


von Marcel Eckerlein-Konrath
Mit der deutschsprachigen Erstaufführung von Stephen Sondheims „Merrily We Roll Along“ hat sich das Theater Regensburg auf ein künstlerisches Wagnis eingelassen – und es mit beeindruckender Konsequenz und großer Hingabe umgesetzt. Regisseur und Ausstatter Sebastian Ritschel beweist mit dieser Produktion einmal mehr, dass er ein feines Gespür für ungewöhnliche Stoffe, komplexe Erzählformen und große musikalische Kunst besitzt. Sein Regiekonzept ist durchdacht bis ins Detail: visuell kraftvoll, atmosphärisch dicht und klar.
Ritschels Regiearbeit ist von einem tiefen Verständnis für Sondheims Werk geprägt. Er sieht „Merrily We Roll Along“ nicht nur als eine Coming-of-Age-Geschichte, sondern vor allem als eine schonungslose Betrachtung von Schein und Sein. Für Ritschel symbolisiert das Stück die „Oberflächlichkeiten der High Society“ und das Drama hinter dem Glamour, das oftmals verborgen bleibt. Diese Ambivalenz spiegelt sich in seiner Inszenierung wider, in der die Kostüme – elegante Abendgarderobe mit Glitzer und Glamour – als verkörperter Gegensatz zu den inneren Konflikten der Figuren fungieren, wie er im Programmheft glaubhaft darlegt.
Ritschel betont, wie besonders die Rückwärts-Erzählweise des Musicals ist. Für das heutige Publikum stellt sie zwar keine dramaturgische Herausforderung mehr dar, doch gerade sie macht das Stück inhaltlich so vielschichtig. Er sieht darin ein „theatrales Gespür“, das nur jemand wie Sondheim, mit seiner meisterhaften Verbindung von Musik und Sprache, so eindrucksvoll umsetzen konnte. Für Ritschel ist Sondheim der „anspruchsvollste und innovativste Komponist des Broadway“, dessen Werke im deutschsprachigen Raum leider noch immer nicht die Anerkennung genießen, die sie verdienen.
Sondheims Musical basiert auf einem Schauspiel von Kaufman und Hart aus den 1930er-Jahren. Es erzählt die Geschichte einer zerbrochenen Freundschaft zwischen drei Künstlern – rückwärts, vom desillusionierten Ende zurück zum hoffnungsvollen Anfang. Ritschel nutzt dieses Erzählprinzip nicht nur als formales Stilmittel, sondern baut seine gesamte Inszenierung darauf auf: Der Abend gleicht einer allmählichen Entblätterung. Was zuerst wie ein zynisches Porträt der Showbranche wirkt, verwandelt sich Schritt für Schritt in eine intime, wehmütige Reise zu verlorenen Träumen.
Die Ausstattung von Barbara B. Blaschke unterstreicht die Doppelbödigkeit der Geschichte perfekt. Die Drehbühne fungiert als Zeitmaschine, die das Publikum durch die 18 Jahre der Handlung trägt. Die Bühne ist bewusst minimalistisch, gleichzeitig aber sehr atmosphärisch in Szene gesetzt. Die vielen Glühbirnen im Bühnenhintergrund schaffen stimmungsvolle Lichtbilder, die den Szenen eine fast nostalgische Atmosphäre geben.
Die Kostüme sind stilvoll, kultiviert, mit viel Glanz und sind für Ritschel ein zentrales Element, um den Schein der High Society zu thematisieren. Die glitzernde Oberfläche steht dabei im bewussten Gegensatz zur inneren Leere und Entfremdung, die das Stück beschreibt. Die Kostüme zeigen eine Welt, die elegant und schön erscheint, in der aber viel zerbricht.
Das Orchester unter der Leitung von Andreas Kowalewitz bringt Sondheims vielschichtige Musik mit klarem Klangbild und feinem Gespür für Dynamik zur Geltung. Die musikalische Leitung findet eine gute Balance zwischen orchestraler Präsenz und Rücksicht auf die Sänger, sodass sowohl die strukturelle Komplexität als auch die emotionalen Zwischentöne der Partitur zur Wirkung kommen.
Die Übersetzung von Sabine Ruflair und Jana Mischke ist eine beachtliche Leistung. Ein absoluter, aber gelungener Kraftakt den Text ins Deutsche zu übertragen, ohne die musikalische Struktur zu zerstören. Klug gelöst ist etwa, dass die Jahreszahlen in den Songs englisch bleiben – ein kleines, aber wirksames Mittel, um das Tempo zu halten und Reimstruktur nicht zu gefährden. Gerade im Vergleich zum englischen Original, wo viele Worte kürzer und flexibler sind, war das eine immense Herausforderung. Die Lösung ist elegant und funktional.
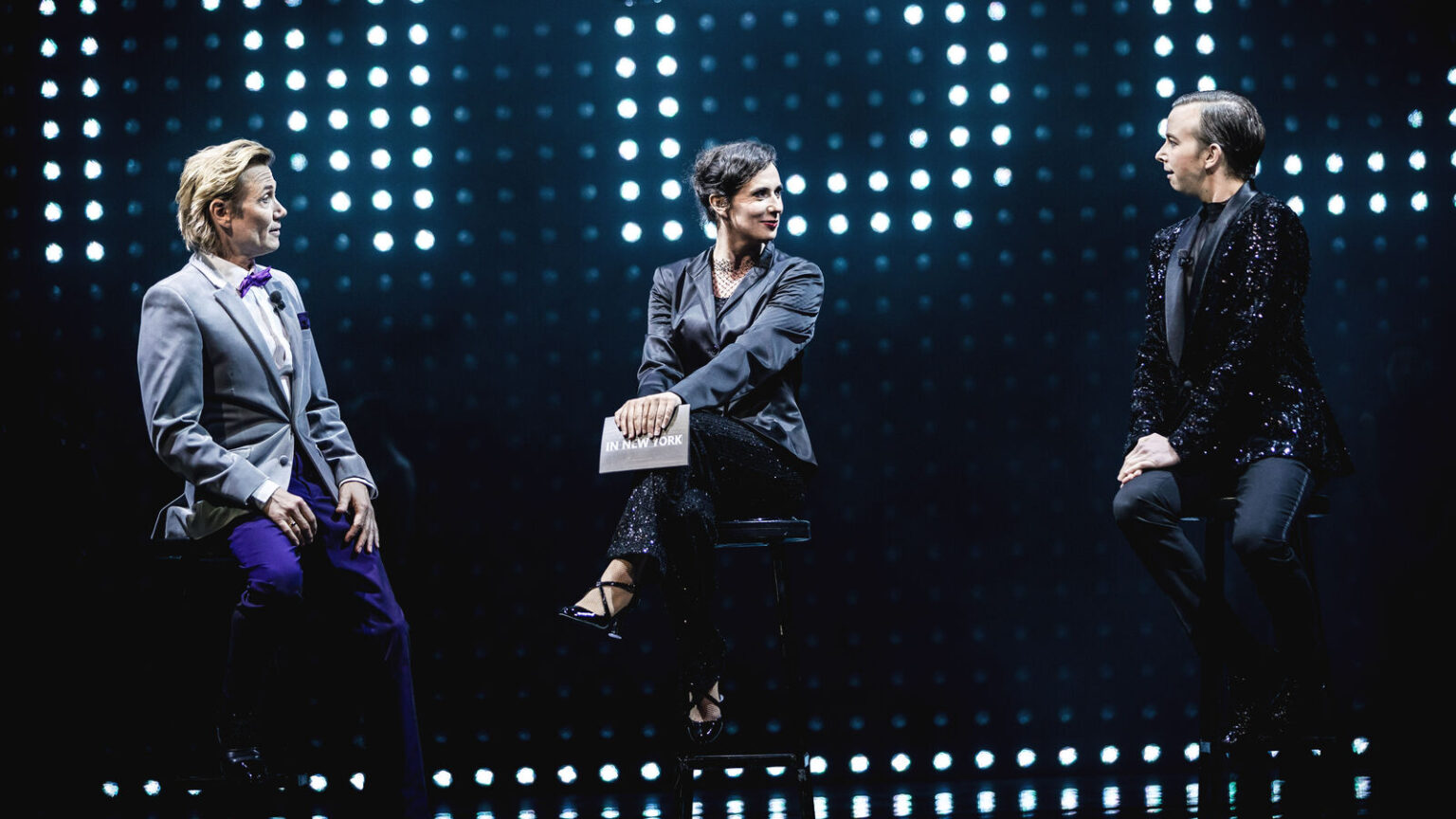
Das Ensemble der Regensburger Produktion ist durchweg engagiert und spielfreudig. Besonders in den großen Gruppenszenen entsteht eine überzeugende Dynamik, die die gesellschaftliche Welt um Franklin Shepard glaubhaft zum Leben erweckt. Die kleineren Rollen sind sorgfältig besetzt, mit vielen präzise gezeichneten Figuren, die zur Atmosphäre beitragen und in einzelnen Momenten stark hervortreten – sei es mit stimmlicher Präsenz oder mit pointierter Darstellung. Masengu Kanyinda überzeugt als Meg, während Alejandro Nicolás Firlei Fernández als Joe punkten kann.
Fabiana Locke sticht dabei besonders hervor: Ihre Gussie Carnegie ist nicht nur schlagfertig und glamourös, sondern auch mit einer überzeugenden Mischung aus Härte und Verletzlichkeit gezeichnet. Ihr Solo zu Beginn des zweiten Aktes gerät zum musikalischen Showstopper (der einzige Song, der im englischen Original gesungen wird: Gussie’s Opening Number) Locke ist stimmlich souverän und mit starker Bühnenwirkung ausgestattet.
Friederike Bauer verleiht der Figur der Mary Flynn eine glaubwürdige Mischung aus Wärme, Intelligenz und einer feinen ironischen Abgeklärtheit, die der Figur gutsteht. Sie zeigt Mary als Frau, die viel beobachtet, oft schweigt, aber innerlich mit sich ringt, besonders im späteren Leben, wenn Zynismus und Alkohol ihren Idealismus getötet haben. Bauer findet eine klare Linie für die Figur und bleibt stets präsent. In manchen emotionalen Momenten, etwa in Marys stiller Verzweiflung über ihre unerwiderte Liebe zu Frank, hätte man sich allerdings noch mehr Tiefe und Verletzlichkeit gewünscht. Diese Facette bleibt eher angedeutet als ausgespielt – doch gerade durch ihre Zurückhaltung macht Bauer Mary glaubwürdig als Figur, die sich selbst schützt, indem sie Gefühle kontrolliert.
Musikalisch bleibt die Produktion anspruchsvoll, denn Sondheims Kompositionen sind rhythmisch wie harmonisch komplex, oft sperrig, nie gefällig. Die Songs ordnen sich stets der Handlung unter und nie umgekehrt. Umso erfreulicher, wenn einzelne Stimmen besonders hervorstechen, wie etwa Nina Weiß als Beth. Ihr großer Moment ist das Solo Jeder Tag tut weh (im Original: Not a Day Goes By) – ein emotionaler Höhepunkt des Abends. Hier gelingt Weiß eine berührende Balance zwischen Kontrolle und Verletzlichkeit. Der Schmerz ihrer Figur wird spürbar, weil sie ihn nicht nur singt, sondern durchlebt.
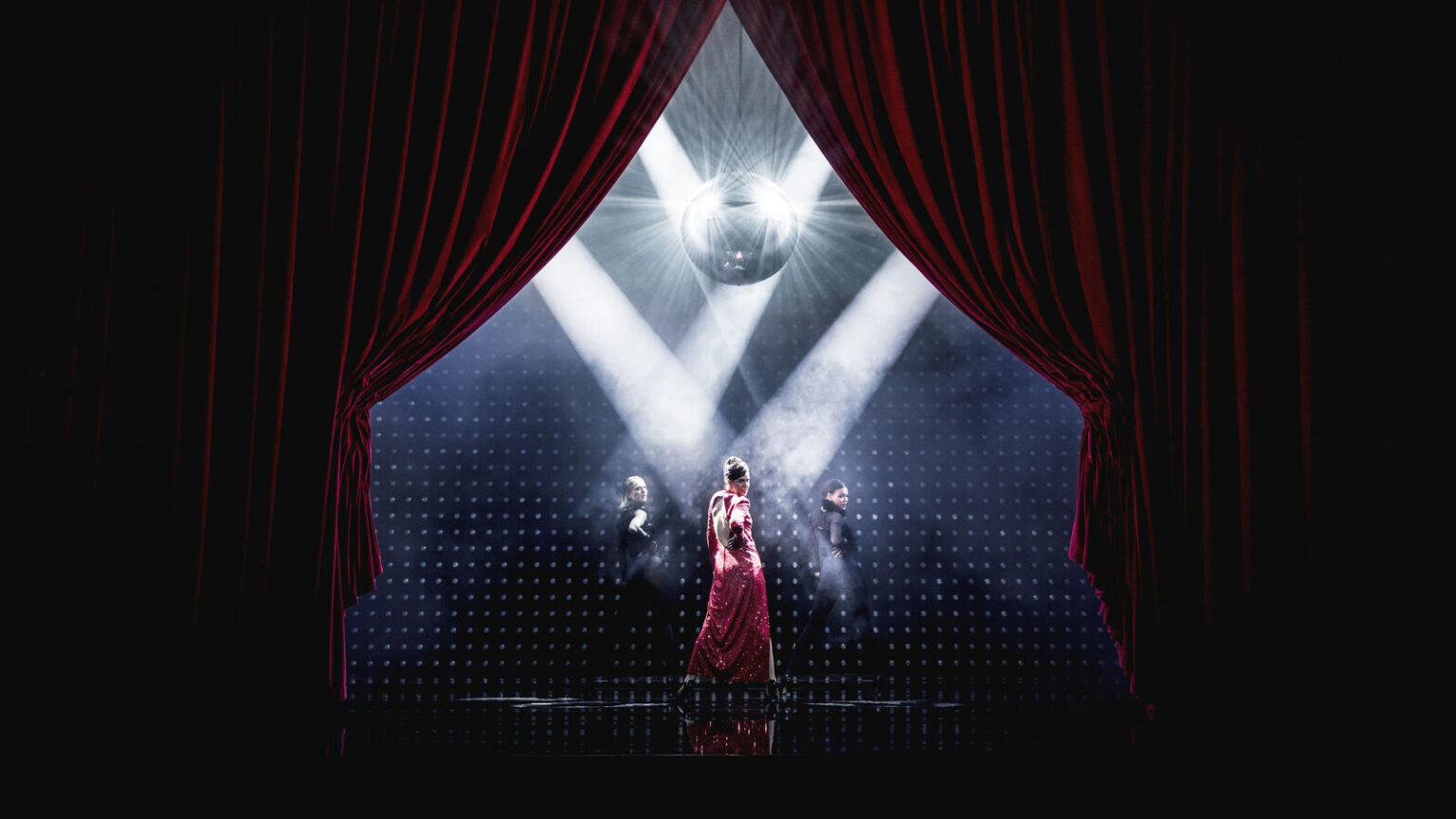
Felix Rabas als Charley Kringas braucht etwas Zeit, um in der Rolle anzukommen, findet aber vor allem in der zweiten Hälfte des Abends spürbar zu sich. Sobald die Handlung in die frühen Lebensjahre der Figuren zurückspringt – also Charley noch nicht desillusioniert, sondern voller Elan und kreativer Energie ist – wirkt Rabas präsenter, wacher und deutlich glaubhafter. Er bringt dann eine Leichtigkeit und Direktheit ins Spiel, die seiner Figur gutsteht. In diesen Momenten wird Charleys Idealismus spürbar, ebenso wie sein unterschwelliger Frust darüber, immer wieder hinter Frank zurückzustehen. Gesanglich bleibt Rabas allerdings nicht ohne Wackler. Besonders in den anspruchsvollen Passagen – etwa bei Gefunden (Good Thing Going) – kommt es zu Unsicherheiten in der Intonation, die sehr hörbar sind. Sondheims Musik stellt hohe rhythmische und melodische Anforderungen, und Rabas bewegt sich dabei mitunter am Rand der Stimmkontrolle.
Andreas Bieber bringt als Franklin Shepard viel Bühnenerfahrung und Souveränität in die Rolle ein. Er zeigt Frank als charismatischen, kontrollierten Macher, der zwischen Kreativität und Karriere hin- und hergerissen ist. Schauspielerisch agiert Bieber präzise, mit feinem Gespür für die Zerrissenheit der Figur. Beim Zusammenspiel mit Friederike Bauer (Mary) und Felix Rabas (Charley) geht in manchen Momenten die Chemie zwischen den dreien verloren und das schwächt ausgerechnet das Herzstück der Inszenierung: das freundschaftliche Dreieck, das die Geschichte trägt.
Ein zusätzlicher Faktor, der sich hier bemerkbar macht, ist der altersmäßige Unterschied zwischen Bieber und seinen beiden Bühnenpartnern. Während Bauer und Rabas spürbar jünger wirken (und sind), fällt Bieber vor allem in den späteren Szenen im zweiten Akt als deutlich älter auf. Das schmälert stellenweise die Glaubwürdigkeit, gerade in den Szenen, in denen die drei als Anfang-Zwanzigjährige ins Leben starten. Die emotionale Fallhöhe bleibt vorhanden, aber die Illusion der gemeinsamen Jugend und Entwicklung leidet ein wenig, zumal das Musical davon lebt, dass man die enge Verbindung dieser drei Figuren über Jahre hinweg nachvollziehen kann.
Insgesamt trägt das Ensemble den Abend mit spürbarem Einsatz und sichtlich großer Achtung vor Sondheims Werk. Auch wenn nicht jeder Ton sitzt und nicht jede Szene vollends überzeugt, wird doch klar: Hier steht ein Team auf der Bühne, das sich dieser herausfordernden Partitur und der vielschichtigen Geschichte mit Ernsthaftigkeit und Respekt stellt.
Merrily We Roll Along ist kein Musical, das sich einfach konsumieren lässt und gerade das macht seinen Reiz aus. Stephen Sondheims komplexe Partitur und George Furths Buch fordern das Publikum heraus, mitzudenken und mitzuleiden. Am Ende (also chronologisch am Anfang) steht nicht das Scheitern, sondern eine beinahe schmerzhafte Unschuld durch die hoffnungsvolle Jugend der drei Freunde. (Wir sind dran / Our Time)
Ritschels Inszenierung ist ein durchdachtes, vielschichtiges Theatererlebnis, das den Glanz und die Schattenseiten von Freundschaft, Erfolg und Selbstverlust eindrucksvoll beleuchtet. Das Konzept, das Schein und Sein in Kostümen, Bühnenbild und Spiel verbindet, macht das Stück für das Publikum nachvollziehbar und emotional zugänglich.
Trotz kleinerer Schwächen in der schauspielerischen Umsetzung gelingt dem Ensemble eine respektable Leistung, getragen von einem starken Orchester und einer sorgfältigen Übersetzung. Für alle, die sich für Sondheim und Musical abseits des Mainstreams interessieren, ist diese deutschsprachige Premiere ein echtes Highlight und ein überzeugender Beleg dafür, dass Merrily We Roll Along auch im deutschsprachigen Raum ein Publikum findet.
Ein Besuch in Regensburg lohnt sich definitiv – nicht nur wegen des außergewöhnlichen musikalischen Werks, sondern auch wegen der klugen, visionären Regiearbeit Sebastian Ritschels, die das Stück mit viel Herz und Verstand auf die Bühne bringt.

Review: CABARET
at the Kit Kat Club London


von Marcel Eckerlein-Konrath
Schon beim Betreten des Playhouse Theatres, das in den funkelnden, zwielichtigen KitKat Klub verwandelt wurde, spürt man: hier ist man augenblicklich in einer neuen Welt. Hier wird etwas erzählt, das tief ins Heute hineinreicht. Die Zuschauer*innen betreten den Raum nicht durch den gewohnten Eingang, sondern durch die Stage Door – sie treten ein in eine Welt zwischen Rausch und Abgrund.
Die Vorstellung beginnt mit einer elektrisierenden Pre-Show: Musik, Tanz, Verführung. Alles scheint möglich in dieser glitzernden Parallelwelt. Und doch schwingt von Anfang an eine dunkle Ahnung mit – eine Ahnung von etwas, das näher kommt, leiser, bedrohlicher.

Billy Porter als Emcee ist das pulsierende Herz dieser Inszenierung – charismatisch, unheimlich, verführerisch. Doch hinter dem Glanz, dem Spiel mit Gender und Identität, offenbart er auch eine tiefe Verletzlichkeit. Porter gelingt es, zwischen Zynismus und Zartheit zu changieren, zwischen flamboyanter Showfigur und stillem Beobachter des drohenden Zusammenbruchs. Seine Präsenz ist elektrisierend – nicht nur, weil er die Bühne beherrscht, sondern weil er immer wieder Momente der nackten, fast schmerzhaften Menschlichkeit zulässt.
Dabei erinnert seine Darstellung stellenweise an seine preisgekrönte Rolle als Pray Tell in der Serie Pose – auch dort spielte er eine queere Figur, die zwischen Glamour und persönlicher Tragödie existiert. Doch während Pray Tell im Kontext der AIDS-Krise kämpft, ist Porters Emcee der Chronist eines historischen Abgrunds – und zugleich dessen warnende Stimme für die Gegenwart. Besonders eindrucksvoll: sein „I Don’t Care Much“. Es ist kein beiläufiges Nummernrevue-Lied – es ist ein Schrei der Verzweiflung, bitter, leise, erschütternd. Dieser Moment trifft ins Mark.
Seine Figur des Emcee nimmt in Cabaret eine besondere Rolle ein. Er ist nicht Teil der eigentlichen Handlung, sondern bewegt sich zwischen den Ebenen – Kommentator, Erzähler, Verführer, Spiegel der Gesellschaft. Er beobachtet, kommentiert, warnt – und verführt das Publikum zugleich. Mal ist er Clown, mal Zyniker, mal Schattenwesen. In Frecknalls Inszenierung wird dieser Aspekt besonders klar herausgearbeitet: Der Emcee weiß, was kommt. Und er weiß, dass niemand hinhört – zumindest nicht rechtzeitig.
Porter spielt diese Ambivalenz mit großer schauspielerischer Tiefe. Jeder Blick, jede Pause, jedes ironisch gehauchte „Willkommen“ trägt Bedeutung.
Er ist das Gewissen der Show – und das Echo all jener Stimmen, die in Zeiten des Wandels zu leise waren.
Wenn Marisha Wallace als Sally Bowles die Bühne betritt, gehört der Raum sofort ihr – nicht nur wegen ihrer beeindruckenden Präsenz, sondern weil sie etwas mitbringt, das man auf einer Theaterbühne nur selten in solcher Reinheit erlebt: Echtheit. Ihre Sally ist keine glamouröse Diva, keine oberflächliche Revuepuppe, sondern eine Frau aus Fleisch und Blut. Eine, die kämpft, lacht, trinkt, liebt – und die immer wieder aufsteht, auch wenn es eigentlich fast nicht mehr möglich ist.
Sie ist eine Heldin des Alltags, ein Kumpel, den man beschützen möchte, obwohl man weiß, dass sie sich selbst retten muss. In Wallace‘ Spiel liegen Mut, Trotz, Witz – aber auch eine tiefe, ungeschönte Verletzlichkeit. Ihre Sally glaubt noch an das Gute, selbst wenn ihr die Welt längst das Gegenteil bewiesen hat. Und genau das macht ihre Figur so menschlich, so tragisch – und so stark.
Ihre Stimme ist schlicht atemberaubend. Kraftvoll, klar, emotional aufgeladen – jede Note sitzt, jede Silbe hat Gewicht. Und wenn sie „Maybe This Time“ singt, wird aus einem bekannten Showtune ein Akt des Überlebens. Noch nie – wirklich noch nie – war dieser Song auf einer Bühne so intensiv, so dringlich, so verletzlich. Kein Showstopper, sondern ein offenes Herz. Ein letzter Versuch, das Leben noch einmal zu spüren, bevor es entgleitet.

Dass Wallace als Amerikanerin mit einem British English aufwartet, das bis ins letzte Detail glaubhaft klingt, ist ein weiteres kleines Wunder. Ihr Akzent ist „spot on“, ihre Sprachführung makellos – sie spielt Sally nicht wie eine Britin, sie ist es. Dieses Maß an stimmlicher, sprachlicher und emotionaler Präzision ist schlicht außergewöhnlich.
Was Wallace leistet, ist nicht weniger als eine Neuerfindung der Rolle. Sie zeigt Sally als Frau, die sich weder romantisieren noch brechen lässt. Eine, die Fehler macht, ja – aber die nie aufhört zu hoffen. Sie ist der lebendige Beweis, dass selbst im Angesicht des Zusammenbruchs Würde, Mut und Menschlichkeit weiterbestehen können.
Die große Stärke der Inszenierung von Rebecca Frecknall: Sie verweigert sich dem sicheren Rückblick. Sie erzählt nicht nur vom Berlin der 1930er-Jahre – sie spricht direkt ins Hier und Jetzt. Und die Parallelen sind erschreckend deutlich.
Wenn wir heute auf das Erstarken rechtspopulistischer Parteien blicken – auf Ausgrenzung, Rassismus, Hass auf Minderheiten, Hetze gegen queere Menschen, auf das Gift der Fremdenfeindlichkeit, das sich in den Diskurs mischt – dann spüren wir, wie aktuell Cabaret ist. Das Musical zeigt eine Gesellschaft, die lieber wegsieht, lieber feiert, statt zu handeln. Und genau das erleben wir heute wieder: politische Normalisierung des Undenkbaren, die schleichende Verschiebung der Grenzen, die gefährliche Sehnsucht nach „einfachen Antworten“.
Rebecca Frecknalls Inszenierung macht klar: Das ist nicht Vergangenheit – das ist Gegenwart. Wenn Sally sagt, sie wolle sich nicht mit Politik befassen, weil das Leben zu schön ist – dann klingt das wie viele Stimmen heute, die meinen, es gehe sie nichts an. Und wenn am Ende die Musik verstummt und der Emcee sein Lächeln verliert, dann bleibt ein bitteres Gefühl: Es hätte nicht so weit kommen müssen.
Auch das intime Setting des Theaters verstärkt diese Botschaft. Man sitzt dicht an den Darsteller*innen, kann den Atem, den Schweiß, das Flackern in den Augen sehen. Es gibt kein Entkommen – und genau das braucht es: ein unmittelbares, schonungsloses Erleben.



Cabaret basiert auf den Berlin-Erzählungen von Christopher Isherwood, die das Lebensgefühl der späten Weimarer Republik einfangen – eine Zeit des künstlerischen Aufbruchs, aber auch der politischen Blindheit. Das Musical von Kander, Ebb und Prince wurde 1966 uraufgeführt, hat seitdem viele Gesichter gehabt – doch selten war es so dringlich wie heute.
Diese Produktion ist nicht nur künstlerisch herausragend, sie ist ein Weckruf. Sie erinnert uns daran, was auf dem Spiel steht, wenn wir Toleranz zur Meinungssache erklären und Menschenrechte verhandelbar machen.
Cabaret im Playhouse Theatre ist ein Erlebnis, das einen nicht loslässt. Brillant gespielt, atemberaubend gesungen, erschreckend aktuell. Es ist ein Appell an unsere Menschlichkeit – und eine Warnung davor, was geschieht, wenn wir sie verlieren.
Ein Musical? Ja. Aber vor allem: eine Mahnung.
Review: THE DEVIL WEARS PRADA
Dominon Theatre London


von Marcel Eckerlein-Konrath
Mit dem Einzug von The Devil Wears Prada (Regie: Jerry Mitchell) ins Londoner Dominion Theatre feiert eine der ikonischsten Modegeschichten der letzten Jahrzehnte ihre große Musical-Premiere im West End. Die Erwartungen sind entsprechend hoch – schließlich basiert das Stück nicht nur auf Lauren Weisbergers Bestseller, sondern vor allem auf dem überaus erfolgreichen Film mit Meryl Streep und Anne Hathaway, der weltweit Kultstatus genießt.
Der Weg dahin war allerdings nicht ganz reibungslos. Das Tryout der Show 2022 in Boston verlief verhalten. Elton John, verantwortlich für die Musik, zeigte sich selbstkritisch und kündigte an, das Material noch einmal „grundlegend zu überdenken“. Nun ist das Musical in London angekommen – überarbeitet, aufpoliert, neu gestylt. Aber reicht das für den großen Auftritt auf dem Laufsteg des West End? Was auf die Bühne gebracht wurde, ist eine weitgehend werkgetreue Umsetzung des Films, die viele bekannte Szenen und Dialoge übernimmt. Diese Nähe zur Vorlage funktioniert auf der einen Seite als emotionaler Anker für Fans des Originals, macht es der neuen Produktion auf der anderen Seite aber schwer, ein eigenes Profil zu entwickeln. Man hat streckenweise das Gefühl, einem gut gemachten Re-Enactment beizuwohnen, das sich eng an eine bekannte Ikone anlehnt, ohne diese ganz erreichen zu können. Die Songs von Elton John wirken, als hätte man ihm den Auftrag gegeben: „Mach’s ein bisschen wie Cyndi Lauper in ‚Kinky Boots‘ – aber bitte nicht zu offensichtlich.“ Das Ergebnis sind routiniert produzierte Musicalnummern, die eher standardmäßig geschneidert und selten mitreißend sind (House of Miranda). Die große Hymne fehlt, der musikalische Glamour bleibt hinter der Marke Elton John überraschend blass. Es klingt gefällig, aber nicht erinnerungswürdig – solide Konfektionsware, keine Haute Couture.

Vanessa Williams bringt als Miranda Priestly zweifellos Stil und Bühnenpräsenz mit – sie betritt die Szenerie mit geschmeidiger Eleganz, ordentlicher Stimme und jener Aura, die man von einer erfolgreichen Mode-Ikone erwartet. Ihre Interpretation ist kontrolliert und präzise, was ihrer Darstellung eine gewisse Noblesse verleiht. Doch genau in dieser Zurückhaltung liegt zugleich das Problem: Miranda bleibt unterkühlt – aber nicht im Sinne einer einschüchternden Grande Dame, sondern eher als distanzierte, fast abstrahierte Figur.
Was bei Meryl Streep im Film als eiskaltes Charisma mit minimalistischem Ausdruck wirkte – ein gehauchtes „That’s all“ konnte ganze Welten zum Einsturz bringen – verliert bei Williams spürbar an dramaturgischer Wirkung. Ihre Miranda scheint sich nie ganz von früheren Rollen zu lösen, insbesondere nicht von Wilhelmina Slater aus Ugly Betty. Die Verbindung ist unverkennbar: die scharfe Zunge, das überlegene Augenrollen, die leicht ironische Distanziertheit. Doch wo Wilhelmina eine überzeichnete Satirefigur war, verlangt Miranda Priestly eine differenzierte Mischung aus Macht, Intelligenz und Furcht einflößender Ruhe.
Es fehlt jene leise, souveräne Autorität, mit der Miranda allein durch Anwesenheit dominiert. Stattdessen wirkt Williams’ Spiel oft wie eine Hommage (Imitation?). Sie ist stets präsent, aber selten bedrohlich. Man beobachtet sie mit Interesse, doch das Gefühl ehrlicher Einschüchterung – so zentral für die Dynamik zwischen Miranda und Andy – stellt sich kaum ein. In den entscheidenden Momenten, etwa bei der berühmten „Cerulean-Blau“ Monolog bleibt ihre Wirkung eher mau und oberflächlich.
Ihre Miranda ist keine Tyrannin, eher eine versierte Strategin – und das kann durchaus als ein neuer Zugang zur Rolle verstanden werden. Doch im direkten Vergleich mit der ikonischen Vorlage fehlt es an Schärfe, an emotionalem Gewicht und jener feinen Mischung aus Faszination und Furcht, die die Figur zur Legende machte.
Georgie Buckland als Andy Sachs macht ihren Job respektabel – stimmlich und schauspielerisch erstklassig. Sie trägt die Show mit Energie, bleibt aber letztlich in einer Rolle gefangen, die zu eng an der Filmvorlage klebt, ohne ihr etwas Eigenständiges abzugewinnen.
Matt Henry als Nigel hat ein feines Gespür für Timing, vefügt über natürlichen Charme und einem warmen, humorvollen Charakter, der jene Leichtigkeit in die Inszenierung bringt, die an vielen Stellen schmerzlich vermisst wird. Er füllt die Rolle mit Leben, ohne sie zu überzeichnen, und balanciert gekonnt zwischen pointiertem Witz und echter Emotionalität.
Sein Nigel ist Mentor, Freund und Mode-Flüsterer in einem – stets auf den Punkt gespielt, mit klug dosierter Energie und einer großen Offenheit, die ihn sofort ins Herz des Publikums rückt. Gerade in den Szenen, in denen er Andy stützt und formt, zeigt sich Henrys Fähigkeit, aus scheinbar beiläufigen Momenten glaubhafte Tiefe zu schöpfen. Auch gesanglich überzeugt er mit starker Stimme und viel Ausdruck – seine Songs gehören zu den mitunter einprägsamsten der Show (Dress Your Way Up).
Bemerkenswert ist zudem, wie sehr Henry mit seiner bloßen Präsenz Szenen dominieren kann. Seine Ausstrahlung ist leuchtend und ehrfurchtgebietend – und im direkten Vergleich wirkt seine Bühnenkraft mitunter sogar eindrucksvoller als die der eigentlichen Hauptfigur Miranda. Während Vanessa Williams‘ Interpretation bisweilen an emotionaler Schärfe vermissen lässt, gelingt es Henry, mit Wärme und Authentizität zu berühren.
Doch der Star der Produktion ist zweifellos Amy Di Bartolomeo als Emily. Ihre Performance, zurecht Olivier-nominiert, ist eine explosive Mischung aus Präzision, Komik und vokaler Brillanz. Jedes Mal, wenn sie die Bühne betritt, richtet sich der Blick ganz automatisch auf sie – sie ist das dramaturgische Gegenstück zu Miranda, sprühend vor Energie, mit einem Timing, das messerscharf sitzt. Ihre Momente sind die stärksten des Abends.
Was wirklich überzeugt, sind die Kostüme und das aufwendig gestaltete Bühnenbild. Hier wird mit Stilgefühl, Detailverliebtheit und handwerklicher Klasse gearbeitet. Die Modeschau-Szenen funkeln, das Redaktionsbüro wirkt lebendig und bis ins kleinste Accessoire durchdacht. In diesen Momenten glaubt man kurz, in die Welt von Runway einzutauchen.
Doch am Ende bleibt das Gefühl, einem luxuriös verpackten Präsent beizuwohnen, dessen Inhalt man leider schon kennt – und den man womöglich nicht dringend gebraucht hätte. Insgesamt ist The Devil Wears Prada im Dominion Theatre ein unterhaltsames, handwerklich gut gemachtes Musical, das seine Geschichte mit Nähe zur Vorlage erzählt. Es wird seine Fans finden – auch wenn es der Inszenierung stellenweise noch an eigener Handschrift fehlt. Wer den Film liebt, wird viel Wiedererkennbares finden; wer nach einem neuen musikalischen Statement sucht, bleibt womöglich etwas unberührt und enttäuscht zurück. Es ist ein solides West-End-Musical – professionell, kurzweilig, doch mit Luft nach oben. „That’s all.“




Review: DEAR EVAN HANSEN
Stadttheater Fürth


von Marcel Eckerlein-Konrath
Mit Spannung wurde die deutsche Erstaufführung des preisgekrönten Broadway-Musicals Dear Evan Hansen erwartet – einem Stück, das mit ungewöhnlicher Ehrlichkeit Themen wie soziale Angststörung, Suizid, Depression, Trauer und die Sehnsucht nach Zugehörigkeit behandelt. Nun hat es den Sprung auf die deutschsprachige Bühne geschafft – in einer Inszenierung, die sich visuell und atmosphärisch eng am amerikanischen Original orientiert, zugleich aber mit ihrer eigenen visuellen Handschrift punktet.
Allen voran der gekonnte Einsatz von Live-Kameras, eingeblendeten Nachrichten, Reels und Social-Media-Kommentaren: Diese Elemente sind nicht bloße Gimmicks, sondern formen den Raum, in dem sich die fragile Identitätssuche der Jugendlichen abspielt. Das Digitale wird zur Bühne für Sehnsucht, Schmerz und Projektion – und in dieser deutschen Fassung klug und effektiv eingesetzt.
Im Mittelpunkt steht Evan Hansen, ein verunsicherter, sozial isolierter Teenager mit ausgeprägten Angststörungen. Durch eine Verkettung tragischer Umstände wird ein an ihn selbst adressierter Brief als Abschiedsbrief eines verstorbenen Mitschülers – Connor – fehlinterpretiert. Aus einer kleinen Notlüge entsteht ein komplexes Netz aus Erfindungen, das Evan plötzlich Aufmerksamkeit, Nähe und Zugehörigkeit verschafft – aber auf einem tragischen Missverständnis beruht.
Das Musical wirft auf berührende Weise die Frage auf, wie wir in einer zunehmend digitalen Welt noch echte Verbindungen knüpfen – und was geschieht, wenn wir Menschen vorschnell in Schubladen stecken, ohne wirklich hinzusehen. Wer bleibt ungesehen, obwohl er längst da ist?

Was dieses Musical über seinen bewegenden Inhalt hinaus so besonders macht, ist die mitreißende und zugleich tief berührende Musik von Benj Pasek & Justin Paul. Das Komponisten-Duo, das auch für Filme wie La La Land und The Greatest Showman gefeiert wurde, liefert hier ein Score, das unter die Haut geht – und im Ohr bleibt.
Stücke wie „Waving Through a Window“, „You Will Be Found“ oder „For Forever“ haben längst den Sprung aus dem Theatersaal in Playlists und Herzen geschafft. Es sind keine reinen Musical-Nummern – sie tragen das moderne Singer-Songwriter-Gen in sich, sind emotional aufgeladen, melodisch eingängig, aber nie banal.
Eine deutschsprachige Einspielung existiert bislang noch nicht, doch das Original Broadway Cast Album ist ein Must-have für Musical-Liebhaber. Es wurde zu Recht mit dem Grammy Award für das beste Musical-Album ausgezeichnet. Das Musical selbst gewann sechs Tony Awards im Jahr 2017, darunter Best Musical, Best Score (Pasek & Paul), Best Book (Steven Levenson) und Best Actor (Ben Platt in der Titelrolle).
Die Uraufführung von Dear Evan Hansen fand im Dezember 2016 am Broadway statt, unter der Regie von Michael Greif. Schon bald entwickelte sich das Stück zu einem kulturellen Phänomen, das über die Theaterwelt hinaus Wirkung zeigte. Die Geschichte eines einsamen Jungen, der plötzlich sichtbar wird – wenn auch unter falschen Vorzeichen – sprach eine ganze Generation an, die zwischen Social Media, Leistungsdruck und Selbstzweifeln navigiert.
Mittlerweile wurde das Musical weltweit aufgeführt, u.a. in London (West End), Kanada, Israel, Mexiko und Japan. Es folgte eine – kritisch umstrittene – Filmadaption mit Ben Platt in der Hauptrolle. Der emotionale Kern des Musicals aber bleibt universell.

In der deutschen Produktion, die insgesamt eine solide Umsetzung bietet, bleibt die Darstellung des Evan Hansen jedoch zwiespältig. Denis Riffel bemüht sich spürbar, die inneren Kämpfe seiner Figur zu erfassen, doch überzeichnet er den Charakter stellenweise so stark, dass sich ein glaubwürdiges Bild nicht recht einstellen will. Die vielen nervösen Laute, das Stottern, das unentwegte Pressen von Geräuschen – all das lässt ihn weniger wie einen jungen Menschen mit Angststörung, sondern eher wie jemanden mit autistischen Zügen (speziell Asperger-Syndrom) erscheinen.
Hier ist eine Differenzierung wichtig: Während sich soziale Angststörungen durch extreme Furcht vor Bewertung und Ablehnung äußern – oft verbunden mit Rückzugsverhalten, Herzrasen, Vermeidungsverhalten –, handelt es sich beim Asperger-Syndrom um eine neurobiologische Entwicklungsstörung des Autismus-Spektrums. Menschen mit Asperger zeigen häufig Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion, ein eingeschränktes Empathievermögen, stereotype Verhaltensmuster – aber nicht zwangsläufig Angst im sozialen Kontakt. Dass der deutsche Evan teils wie eine Verschmelzung beider Krankheitsbilder wirkt, schwächt die emotionale Kohärenz der Figur und erschwert die Identifikation. Diese beiden Krankheitsbilder sind keineswegs austauschbar – ihre Überlagerung in dieser Darstellung verwässert die emotionale Klarheit der Figur.
Yngve Gasoy-Romdal, in der Rolle des Larry Murphy, bleibt leider etwas blass. Sein Gesangsstil, der stets leicht weinerlich gefärbt wirkt, nimmt seinen wenigen Szenen etwas von ihrer emotionalen Wirkung. Dennoch fügt er sich solide ins Ensemble ein und hält sich dabei angenehm zurück. Ein echtes Highlight hingegen ist das Terzett „Requiem“, das mit feiner Abstimmung und bewegender Präsenz zu einem der stärksten Momente des Abends wird.
Michaela Thurner als Zoe Murphy liefert eine sehr überzeugende, nuancierte Performance: Sie trifft die Zerrissenheit zwischen Wut, Schuld und der Suche nach Nähe punktgenau. Ihre Darstellung ist durchweg glaubwürdig und emotional zugänglich – ein klarer Höhepunkt der Inszenierung.
Vanessa Heinz begeistert als Alana Beck mit klarer Stimme, großer Bühnenpräsenz und emotionaler Tiefe – sie verleiht einer Figur, die leicht zur Randerscheinung werden könnte, echtes Gewicht. Ebenfalls stark: Savio Byrczak als Jared. Er sorgt mit trockenem Humor und pointierten Einsätzen für die notwendige Portion Leichtigkeit.
Etwas hölzern und textlich oft schwer verständlich bleibt leider Jelle Wijgergangs als Connor. Seine Szenen, insbesondere in den „Geisterdialogen“ mit Evan, verlieren dadurch an Wirkung und Tiefe.


Besonders hervorzuheben ist Anna Thorén als Heidi Hansen, Evans alleinerziehende Mutter. Ihre Darstellung ist von großer Wärme, Kraft und Verletzlichkeit – sie verleiht der Figur Tiefe und Würde, ohne je ins Sentimentale zu kippen. Heidi ist eine Frau, die alles gibt, oft über ihre Grenzen geht und dennoch immer das Gefühl hat, nicht zu genügen. Thorén macht diesen inneren Zwiespalt spürbar: die erschöpfte Fürsorge, der Stolz auf ihren Sohn, die Angst, ihn zu verlieren. Ihr Solo „So groß, so klein “ gehört zu den emotionalen Höhepunkten des Abends – bewegend und ehrlich.
Ein starkes Gegengewicht bildet Monika Maria Staszak als Cynthia Murphy, die Mutter des verstorbenen Connor. Im Gegensatz zu Heidi ist Cynthia Teil einer wohlhabenderen, aber innerlich zerfallenen Familie – und sucht Halt in der Vorstellung, ihr Sohn habe in seinen letzten Tagen doch noch einen Freund gefunden. Staszak spielt diese Mischung aus Verdrängung, Trauer und Hoffnung mit großer Zurückhaltung und berührender Verletzlichkeit. Während Heidi kämpft, ringt Cynthia – beide Mütter lieben, aber auf ganz unterschiedliche Weise.
Diese beiden Frauenfiguren – so verschieden sie auch sind – zeigen, wie vielschichtig und schmerzhaft Elternliebe sein kann, wenn sie an Grenzen stößt. Und sie sind es letztlich, die dem Stück seinen leisen, aber anhaltenden Nachhall verleihen.
Die deutsche Übersetzung der Lieder und Dialoge durch Nina Schneider gelingt bemerkenswert gut. Sie wahrt den Rhythmus und die Poesie der Originaltexte und punktet dabei auch inhaltlich – vor allem in den Songs, die oft emotional aufgeladen und sprachlich komplex sind. Die Übersetzung der Songtexte ins Deutsche ist insgesamt gelungen, wenngleich manche Nuancen der Originalsprache auf der Strecke bleiben – doch das ist bei derart idiomatisch dichten Stücken fast unvermeidlich. Was jedoch bleibt, ist eine Geschichte, die sehr berührt.
Die Regie und das Bühnenbild von Markus Olzinger schaffen ein klares, fokussiertes Setting, das zwischen Intimität und medialer Überwältigung changiert. Die flexible, minimalistische Bühne lässt Raum für die Figuren – und für die digitalen Projektionen, die nie zum Selbstzweck werden, sondern stets dem Innenleben der Figuren dienen.
Diese deutsche Erstinszenierung von Dear Evan Hansen überzeugt in vielen Bereichen: mit ihrer starken Musik, ihrer emotionalen Thematik und einer visuell überzeugenden Umsetzung. Schwächen in der darstellerischen Feinzeichnung – vor allem bei der Hauptfigur – trüben das Gesamtbild zwar leicht, doch bleibt der Abend lohnenswert und bewegend. Gerade in Zeiten, in denen psychische Gesundheit noch immer zu wenig thematisiert wird, ist Dear Evan Hansen auf der Bühne ein wichtiges Zeichen.
Review: Disneys HERCULES
Neue Flora, Hamburg


von Marcel Eckerlein-Konrath
Was genau Disney sich dabei gedacht hat, ausgerechnet Hercules als abendfüllendes Musical auf die Bühne zu bringen, bleibt ein Rätsel von mythologischen Ausmaßen. Vielleicht war es eine Laune der Götter. Vielleicht ein Versehen. Wahrscheinlicher aber: eine Entscheidung in einem fensterlosen Konferenzraum, fernab jeglichen Theaterverstands. Was dabei herauskam, ist eine Produktion, die selbst in der Unterwelt noch als Foltermethode durchgehen würde. Götter müssen offenbar einen sehr, sehr bösen Sinn für Humor haben. Es beginnt eigentlich vielversprechend: Die Musen (Leslie Beehann, Virginia Vass, Venolia Manale, UZOH und Jessica Reese) – gesanglich toll und mitreißend – sind das musikalische Herzstück der Show. Sie kämpfen sich textlich durch ein Libretto, das klingt, als hätte jemand die Lyrics des Openers auf „Repeat“ gestellt. Gefühlte zwanzig Varianten desselben Songs („Genauso war’s“), aber keine Idee, wie man daraus dramaturgisch Spannung erzeugt. Gospel-Energie trifft auf kreativen Stillstand. Und so ist der erste Akt ein zäher, klebriger Kaugummi der Langeweile – man kaut und kaut, aber der Geschmack bleibt aus. Was auf der Bühne der Neuen Flora Hamburg als Musical-Event angekündigt wurde, entpuppte sich als zweieinhalbstündiger Beweis dafür, dass nicht jede Disney-Vorlage für die Bühne taugt. Hercules – Das Musical ist schlimmer als ein Autounfall: Man will wegsehen, aber schafft es einfach nicht, weil man sich fragt, ob es noch schlimmer werden kann. Spoiler: Ja, es kann.
Gespickt mit peinlichen Kalauern wie „Ich bin ein Gott, deswegen mag ich Götterspeise“ dümpelt die Geschichte leblos vor sich hin. Die Witze funktionieren alle nicht als Witz, weil sie keinerlei Mehrwert bieten – weder inhaltlich, noch charakterbezogen, noch sind sie ansatzweise komisch.
Hades, gespielt von Detlef Leistenschneider, hätte durchaus das Potenzial, der strahlende Gegenpol zum Heldentum des Hercules zu sein – eine Figur voller Feuer, Hinterlist, dämonischer Eleganz. Doch was auf der Bühne erscheint, ist das genaue Gegenteil: eine Karikatur, irgendwo zwischen Kindertheater-Sidekick und Schurken Imitation gone wrong. Leistenschneiders Hades scheint nicht zu wissen, was er sein will – oder sein darf. Diabolisch? Fehlanzeige. Ironisch? Wenn überhaupt, unfreiwillig. Stattdessen erleben wir eine jammernde, grimassierende Witzfigur, der nicht ansatzweise an den Gott der Unterwelt erinnert. Die Inszenierung gibt ihm einen skurrilen Psycho-Unterton mit – inklusive eines Ödipus-Komplexes, der nur ungläubiges Kopfschütteln auslöst. Die Figur wirkt unfertig, halbherzig, fehlgeleitet. Was wohl als moderne Idee gedacht war, gerät zur Farce. Der Versuch, ihn als durchgeknallten diabolischen Antagonisten zu inszenieren, scheitert grandios. Sein Kostüm? Ein einziger modischer Amoklauf. Die blaue Perücke – eine Art Halloween-Relikt zwischen Anime-Con und Karneval. Hades ist kein ernstzunehmender Gegenspieler, kein düsterer Gegentwurf zur leuchtenden Heldenreise – sondern eine dramaturgische Fehlzündung, die den mythologischen Unterbau der Geschichte zur unfreiwilligen Persiflage verkommen lässt.
Die Choreografien von Casey Nicholaw und Tanisha Scott erinnern streckenweise an das, was man auf einem Sommerfest eines Berufskollegs der 1980er-Jahre erwarten würde – dargeboten von der wenig ambitionierten B-Gruppe, die beim Vortanzen für die eigentliche Aufführung durchgefallen ist. Bewegungsfolgen ohne Dynamik oder szenische Einbettung reihen sich aneinander. Was als dynamischer Showdown, als kraftvolle Bewegungssprache gedacht war, entfaltet sich auf der Bühne in einer bizarren Mischung aus Schulaufführung, volkshochschultauglichem Ausdruckstanz und rhythmisch entgleistem Aufwärmprogramm. Kein Takt sitzt und keine Bewegung folgt einer klaren Linie oder gar einer choreografischen Intention.
Besonders schmerzhaft kulminiert dieser choreografische Offenbarungseid im „epischen“ Kampf gegen das riesige Wurm-Monster. Ein Moment, der eigentlich Suspense und Spektakel versprechen sollte – und stattdessen unbeabsichtigte Komik der schlimmsten Sorte liefert. Die Puppe selbst – ein Hybridwesen aus Thermomatte, Staubsaugerschlauch und leeren Poolnudeln – wird gelangweilt vom gut sichtbaren Puppenspieler gesteuert, der vermutlich denkt: Was genau ist hier schiefgelaufen in meinem Leben?
Während Hercules und Meg mit übertriebenem Ernst gegen das Latex-Gebilde ankämpfen, als hätten sie es mit einem Superschurken zu tun, flüchtet sich das Publikum kollektiv in die innere Emigration. Einige versuchen, das Geschehen durch intensives Blinzeln verschwimmen zu lassen, andere scheinen innerlich Einkaufslisten durchzugehen oder seelisch bereits beim nächsten Theaterstück. Der Rest? Lacht leise. Aus Verzweiflung. Oder weil alles so tragisch ist, dass es nur noch komisch sein kann.
Schauspielerisch bleibt vieles blass. Philipp Büttner als Hercules hat die physische Präsenz, aber sein Charakter bleibt ein naiver Hohlkörper. Mehr Kraft als Köpfchen – was zum Konzept durchaus passt, aber wenig Charme entfaltet. Ein seltener Lichtblick in diesem ansonsten musikalisch blassen Abend ist Büttners Interpretation von „Endlich angekommen“. Mit kraftvoller Stimme, emotionaler Tiefe und einem feinen Gespür für phrasiertes Erzählen gelingt ihm ein Moment echter musikalischer Präsenz. Es ist einer der wenigen Augenblicke, in denen man für einen Moment vergisst, wie schwach der Rest des Scores ist. Mae Ann Jorolan als Meg verleiht ihrer Figur eine moderne Note, ist stimmlich überzeugend („Nein, ich bin nicht verliebt“), bleibt aber in einer Inszenierung gefangen, die keine Tiefe zulässt. Ihre Emanzipation wirkt wie eine Fußnote im Skript, ihr Potenzial verschenkt.
Und dann wären da noch Karl und Heinz – zwei Figuren, die wirken, als hätte man sie versehentlich aus einem RTL-II-Comedy-Format der frühen 2000er in dieses Musical teleportiert. Johnny Galeandro und André Haedicke sollen offensichtlich als Comic Relief fungieren, doch statt Erleichterung bringen sie vor allem eines: Fremdscham gespickt mit Boomer Humor. Karl und Heinz tragen dramaturgisch nichts bei – sie sind nicht einmal sinnvoll eingegliedert. Ihre Szenen fühlen sich an wie Pausenfüller, die die Handlung nicht nur unterbrechen, sondern ihr aktiv im Weg stehen.
Musikalisch bleibt Hercules ebenso blutleer. Die neuen Songs von Alan Menken sind belanglos, melodisch austauschbar, dramaturgisch wirkungslos. Kein einziger Ohrwurm, kein einziger Moment musikalischer Erhebung. Die neuen Songs sind so generisch, dass man sich schon während des Hörens fragt, ob sie überhaupt stattfinden. Keine Melodie bleibt hängen, kein Moment brennt sich ein.
Dass Casey Nicholaw hier Regie geführt haben soll, glaubt man nur, wenn man es schwarz auf weiß liest. Zwischen The Book of Mormon und Hercules liegen Welten – Welten, in denen jedes Gespür für Tempo, Timing und Witz verloren gegangen ist. Diese Inszenierung hat keinen Drive, keine Spannung, keinen Rhythmus. Die Inszenierung? Ein Trauerspiel, das durch nichts geadelt wird – außer durch das Mitleid, das man mit den Darsteller:innen empfindet, die alles geben, obwohl es nichts zu retten gibt.
Wer je gedacht hat, Hercules sei ein unterschätzter Disney-Film mit Potenzial für die große Bühne – wird hier eines Besseren belehrt. Es funktioniert nicht. Und das auf so vielen Ebenen. Die Vorlage – ein durchaus cleverer, musikalisch origineller und visuell starker Animationsfilm von 1997 – bietet eigentlich alles, was ein moderner Musical-Hit braucht: starke Archetypen, eine Prise antike Dramatik, eine Coming-of-Age-Geschichte und jede Menge Spielraum für Humor und Emotion. Doch was in der Disney-Version charmant, rhythmisch pointiert und ironisch durchkomponiert ist, wird in dieser Bühnenumsetzung auf frappierende Weise entkernt. Statt Götterglanz und Heldenreise gibt’s hier zähe Dialoge, plakative Effekte, bemühten Slapstick und eine erstaunliche kreative Leere, die selbst die schönsten mythologischen Stoffe in pure Langeweile verwandelt.
Was als potenziell frischer, antiker Pop-Mythos hätte auftrumpfen können, verkommt hier zur griechischen Tragödie im schlechtesten Sinne: überlang, überflüssig, und in seiner schlimmsten Form – langweilig.



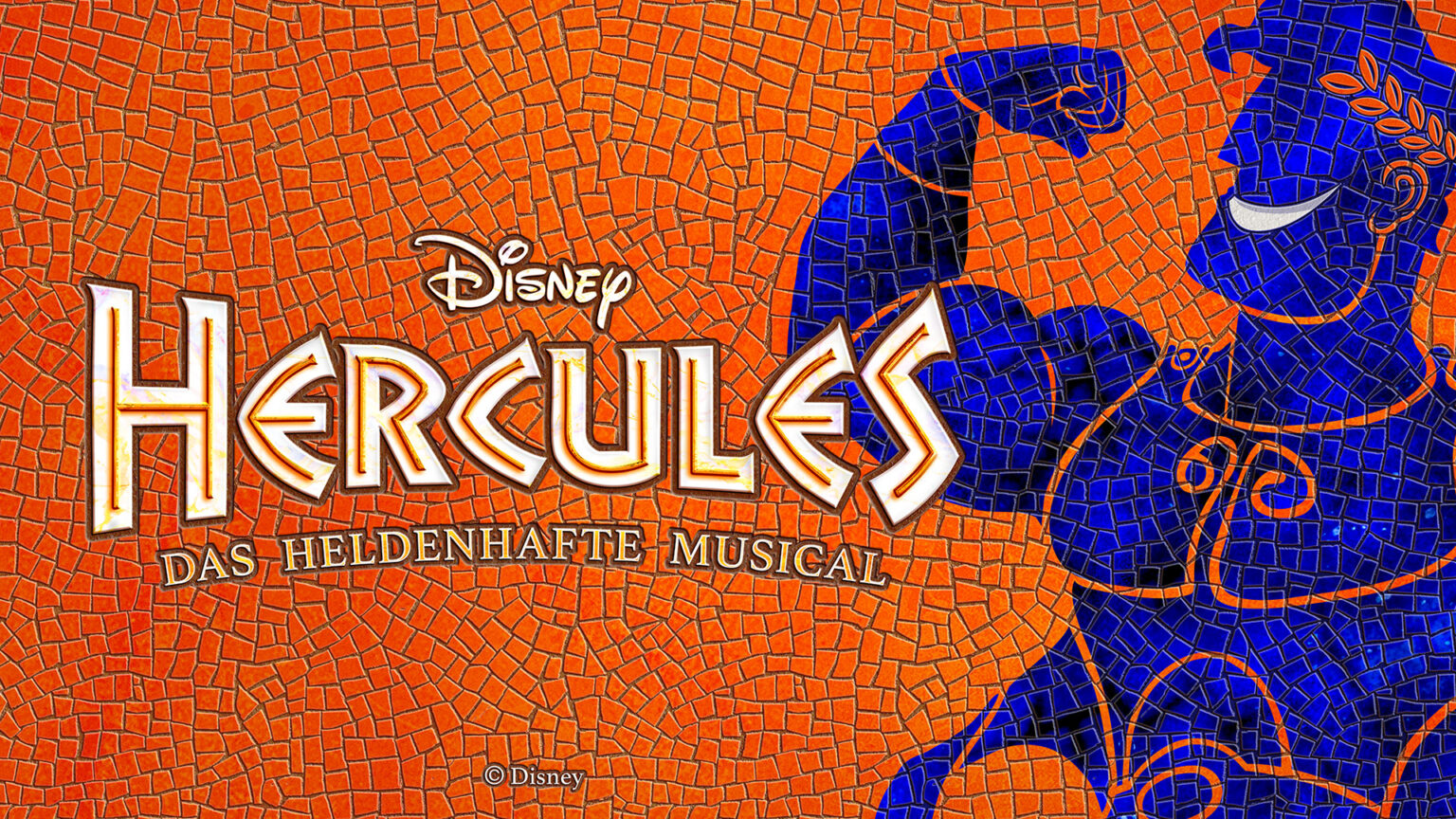
Review: ELISABETH – DAS MUSICAL
in der Schönbrunn-Version
Theater des Westens, Berlin


von Marcel Eckerlein-Konrath
„Ich gehör nur mir“ – Ein Abend mit Elisabeth im Theater des Westens
Es gibt Musicals, die kommen und gehen – und dann gibt es Elisabeth. Seit seiner Uraufführung 1992 in Wien hat sich das Werk von Michael Kunze (Buch und Liedtexte) und Sylvester Levay (Musik) zu einem wahren Dauerbrenner entwickelt. Trotz zunächst durchwachsener Kritiken zur Premiere, fand Elisabeth rasch ihren Weg in die Herzen eines internationalen Publikums. Karl Löbl, eine prominente Stimme der österreichischen Kulturkritik, äußerte sich unmittelbar nach der Weltpremiere: Das Publikum ist enthusiasmiert. Ich selbst bins nicht ganz. Heute gilt das Stück als das erfolgreichste deutschsprachige Musical aller Zeiten. In Berlin machte nun die Tourversion Station – in einer konzertanten Fassung im ehrwürdigen Theater des Westens, mit einem imposanten, sichtbar auf der Bühne platzierten Orchester.
Klanglich ein Fest für die Sinne: Unter der präzisen und einfühlsamen Leitung von Bernd Steixner entfaltet sich der musikalische Kosmos von Sylvester Levay in all seiner Pracht. Doch genau hier liegt auch die Kraft dieser Interpretation: Die Musik ist keine bloße Kulisse, sondern emotionales Rückgrat der Inszenierung, das Elisabeths Lebensweg nicht nur begleitet, sondern musikalisch erzählt. Trotzdem: bei aller orchestralen Wucht: gelegentlich geriet die Balance aus dem Gleichgewicht. Mehr als einmal übertönte das Orchester das Ensemble, sodass insbesondere in den Ensembleszenen Textverständlichkeit auf der Strecke blieb. Wer das Stück nicht ohnehin mitsingen kann – und das dürfte bei dieser treuen Fanbase nicht wenige betreffen – hatte mitunter Mühe, dem Geschehen zu folgen.
Im Zentrum der Inszenierung aber: Sofie De Schryver als Elisabeth – eine wahre Entdeckung. Mit frischer Energie haucht sie der ikonischen Figur neues Leben ein. Sie balanciert die emotionalen Extreme der Kaiserin von Österreich mit beeindruckender Leichtigkeit: charmant und zerbrechlich in den Jugendjahren, stolz und unnahbar als gekrönte Frau, hart und abweisend gegenüber ihrem Sohn Rudolf – und zugleich immer getrieben vom verzweifelten Wunsch nach Selbstbestimmung. Ihr „Ich gehör nur mir“ – das emotionale Zentrum des Musicals – gelingt herzzerreißend schön: gesanglich makellos, lupenrein intoniert, fein nuanciert interpretiert und mit einer Intensität, die tief berührt. Mit scheinbarer Mühelosigkeit meistert sie selbst die teilweise schwindelerregenden Höhen der Partitur – Töne, bei denen andere kämpfen, lässt sie aufblühen, mit einer Stimme, die beeindruckt. Es ist einer dieser seltenen Musicalmomente, in denen Musik, Text und Interpretation zu einer Einheit verschmelzen. Sofie De Schryver bringt nicht nur stimmliche Brillanz, sondern auch eine besondere Aura mit auf die Bühne – eine Mischung aus verletzlicher Eleganz und unbeugsamer Stärke, die sie zur idealen Elisabeth macht und ihr ein neues Gesicht verleiht.
Etwas blass bleibt Lukas Mayer in der Rolle des Tod. Zwar verfügt er über eine gute Stimme und singt technisch sauber, doch es fehlt seiner Interpretation an jener dunklen Faszination und mysteriösen Anziehungskraft, die diese schillernde Figur so besonders macht. Wo man sich ein wenig mehr Verführung, Abgründigkeit und emotionale Spannung wünschen würde, bleibt seine Darstellung eher zurückhaltend und kontrolliert. Ein Ansatz, der zwar interessant gedacht ist, in der Umsetzung jedoch nicht ganz die emotionale Tiefe und dramaturgische Präsenz entfaltet, die dem personifizierten Tod als Gegenspieler Elisabeths innewohnen sollte.
Sehr überzeugend und mit feinem Gespür für Nuancen gestaltet Dennis Henschel die Rolle des Kaiser Franz Joseph. Sein warm timbrierter Bariton trägt mühelos durch den Raum und verleiht der Figur eine eindrucksvolle stimmliche Präsenz. Technisch sicher und mit großem musikalischem Feingefühl singt er, stets auf den emotionalen Kern fokussiert. Besonders hervorzuheben ist seine differenzierte darstellerische Leistung: Henschel zeichnet ein vielschichtiges Porträt des jungen Kaisers, der zu Beginn der Handlung noch Idealismus und Hoffnung in sich trägt, später jedoch zunehmend unter der Last von Krone, Pflicht und familiären Spannungen zerbricht. Er zeigt Franz Joseph nicht als kalten Machtmenschen, sondern als tragische Figur – zerrissen zwischen Staatsräson und privatem Scheitern, zwischen tief empfundener Liebe zu Elisabeth und der Unfähigkeit, ihr die Freiheit zu schenken, nach der sie sich sehnt. Gerade in den stilleren Momenten – etwa in der Konfrontation mit Elisabeth (Boote in der Nacht) oder beim Blick auf das Schicksal seines Sohnes Rudolf – gelingt es Henschel, große emotionale Tiefe mit stiller Würde zu verbinden. So entsteht ein berührender Kontrapunkt zu Elisabeths innerem Aufbegehren – einer, der das Kaiserpaar nicht nur als Gegensätze, sondern als tragisch verbundene Seelen erfahrbar macht. Dennis Henschel liefert damit nicht nur gesanglich, sondern auch darstellerisch eine der stärksten Leistungen des Abends.
Weniger einprägsam bleibt leider Robin Reitsma als Lucheni, der Erzähler und Attentäter in Personalunion. Zwar verfügt er über eine ordentliche Gesangstechnik, doch seine Interpretation der zentralen Figur des Stücks bleibt hinter den Erwartungen zurück. Lucheni, der in Elisabeth nicht nur als Mörder, sondern auch als Kommentator der Ereignisse fungiert, verlangt nach einem Schauspieler, der die Grenze zwischen Zynismus und Faszination auf faszinierende Weise ausschöpft. Doch bei Reitsma fehlt dieser bissige, scharfsinnige Unterton, der diese Rolle so außergewöhnlich macht. Der bissige Humor und die giftige Ironie, die Lucheni zu einem der faszinierendsten Charaktere des Musicals machen, kommen in seiner Darbietung nicht zum Tragen (Kitsch). Die Rolle lebt von einem subversiven Charme, der hier leider zu wenig spürbar ist. Lucheni wird somit mehr zu einem Beobachter als zu einem wahren Antagonisten, der mit seiner zynischen Weltsicht das Publikum in den Bann zieht.
Die Nebenrollen bieten ein durchwachsenes Bild: Masha Karell punktet als Erzherzogin Sophie mit einer soliden Leistung und überzeugt vor allem in ihrem „Bellaria“ Solo. Dennis Hupka hingegen bleibt in der Rolle Rudolfs blass – weder stimmlich noch darstellerisch kann er der tragischen Figur Elisabeths Sohnes ausreichend Tiefe verleihen. Sein Solo Wenn ich dein Spiegel wär bleibt schwach. Claus Dam, bereits bei der deutschen Uraufführung in Essen als Vater Max auf der Bühne, wirkt in dieser Tourfassung müde, fast wie auf Autopilot. Man spürt die Routine – und vermisst den Funken.
Die konzertante Fassung mit großflächigen Projektionen und reduziertem Bühnenbild setzt klugerweise den Fokus auf die Musik und das Ensemble. Visuell bleibt das Ganze eher dezent – aber das passt, denn Elisabeth war immer ein Stück, das in seinen besten Momenten von innerer Dramatik und musikalischer Kraft lebt.
Historisch betrachtet bleibt das Musical trotz dichter Atmosphäre eine freie Interpretation: Die echte Elisabeth war komplexer, politischer, kultivierter – eine Reisende, eine Dichterin, eine von ihrer Zeit entfremdete Kaiserin. Der Film Sissi mit Romy Schneider hat ein bis heute wirkmächtiges, verklärtes Bild geschaffen. Kunzes Elisabeth dagegen ist eine Frau im Widerstand gegen ein System, gegen Erwartungen, gegen ein Leben in Gefangenschaft. Ein faszinierender Gegensatz.
Heute blickt das Musical auf eine riesige Fangemeinde – von Japan bis Ungarn, von Wien bis Seoul. Die Musik ist längst Kult, die Texte in Herz und Hirn ganzer Generationen eingebrannt. Die aktuelle Tourfassung mag an manchen Stellen Schwächen offenbaren – doch im Kern bleibt Elisabeth das, was es schon lange ist: ein bewegendes, musikalisch brillantes Portrait einer Frau, die sich nicht beugen ließ. Eine, die sich selbst gehörte.



Review: CHICAGO
Komische Oper Berlin
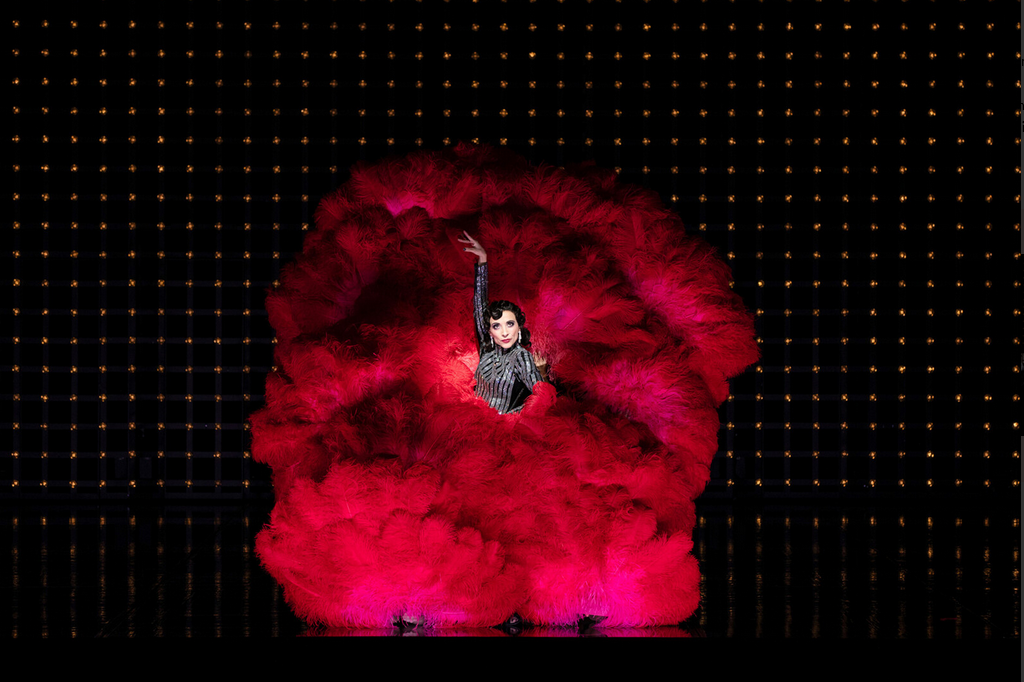

von Marcel Eckerlein-Konrath
Manchmal blitzt es auf in der Theaterlandschaft: Ein Moment, in dem alles stimmt – Timing, Talent, Tanz und Temperament. Barrie Koskys Neuinszenierung des Musicals Chicago ist ein solches Funkeln. Mit über 6.500 Glühlampen im Bühnenbild, das Michael Levine mit ebenso viel Eleganz wie kalkulierter Finesse gestaltet hat, wird nicht nur das Spotlight auf die Protagonist*innen gerichtet, sondern ein elektrisierendes Spektakel entfacht – Broadway-Flair, raffiniert ins Berliner Jetzt transponiert.
Chicago basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von 1926, das von der Journalistin Maurine Dallas Watkins geschrieben wurde – inspiriert von realen Mordprozessen zweier Frauen, die sich in den 1920ern in der amerikanischen Boulevardpresse in glamouröse Antiheldinnen verwandelten. Die Musicalfassung von John Kander (Musik), Fred Ebb (Texte) und Bob Fosse (Regie & Choreografie) wurde 1975 uraufgeführt. Doch der große internationale Durchbruch kam mit dem minimalistischen, düster-raffinierten Broadway-Revival von 1996, das seither ungebrochen gespielt wird.
Unvergessen ist die gefeierte Londoner Produktion von 1997 mit Ute Lemper und Ruthie Henshall – eine Besetzung, die Maßstäbe setzte. Das dazugehörige Cast-Album – eine Studioaufnahme, kein Live-Mitschnitt – ist bis heute ein Referenzwerk. Selten klang ein Cast Album derart lebendig, virtuos und stimmlich präzise und voller vokaler Raffinesse. Henry Goodman als Billy Flynn glänzte darin mit geschmeidiger Arroganz als Meister der subtilen Manipulation.
Koskys Version ist opulenter und größer als die Broadway und West End Revial Inszenierung. Sie ist ein Fest des Überflusses – doch nie plakativ. Er holt das amerikanische Vaudeville auf die Bühne der Komischen Oper, durchdringt es mit Witz, Tempo und einem Gespür für groteske Schönheit. Wie er selbst sagt: „Chicago ist ein Stück über witzige, charmante Monster.“ Genau dieses Wechselspiel zwischen Anziehung und Abscheu macht seine Vision so faszinierend.

Katharine Mehrling als Roxie Hart und Ruth Brauer-Kvam als Velma Kelly erfüllen die Bühne zu jedem Zeitpunkt mit Energie und Präsenz. Beide verwandeln ihre Charaktere in lebendige, pulsierende Wesen, die den Zuschauer mit jeder Geste und jedem Blick fesseln.
Katharine Mehrling, als Roxie Hart, überzeugt nicht nur mit einer bemerkenswerten stimmlichen Vielfalt, sondern auch mit einer unglaublichen Bühnenpräsenz. Sie schafft es, die anfängliche Unschuld und Naivität ihrer Figur zu bewahren, während sie gleichzeitig die immer komplexer werdende Dunkelheit von Roxies Charakter entfaltet. Mehrling spielt mit den vielen Facetten ihrer Figur, die zwischen Manipulation, Charme und eiskalter Berechnung schwankt. Dabei bleibt sie jederzeit glaubwürdig, was die Tragik und den Humor ihrer Roxie verstärkt.
Ruth Brauer-Kvam, als Velma Kelly, bringt ebenfalls eine beeindruckende Vielseitigkeit mit. Ihre Velma ist keine einfache Femme Fatale, sondern eine vielschichtige Frau, die hinter der glamourösen Fassade ihre eigenen Dämonen bekämpft. Brauer-Kvam spielt mit einer Mischung aus Wut, Verletzlichkeit und einer unerschütterlichen Selbstsicherheit, die ihre Figur auf faszinierende Weise ambivalent macht. Besonders bemerkenswert ist die Art, wie sie die chaotische, aber zugleich kontrollierte Energie von Velma auf die Bühne bringt. Ihre Tanz- und Gesangsnummern sind präzise und kraftvoll, wobei ihre Körperbeherrschung und ihr Timing in perfekter Harmonie mit der Choreografie von Otto Pichler steht.
Die Chemie zwischen den beiden Schauspielerinnen ist elektrisierend. Ihre Interaktionen sind ein Balanceakt zwischen Konkurrenz und Kameradschaft, Liebe und Hass – ein Spiel, das von harter Rivalität und gleichzeitiger Bewunderung geprägt ist. Es ist faszinierend zu sehen, wie sie sich im Laufe der Aufführung immer wieder an den Rand des Chaos bewegen, dabei aber nie aus dem Gleichgewicht geraten. Diese explosive Dynamik zwischen Roxie und Velma – zwei Frauen, die sowohl miteinander als auch gegeneinander kämpfen – ist das Herzstück der Inszenierung und zieht das Publikum von Anfang bis Ende in ihren Bann.
Jörn-Felix Alt durchdringt als Billy Flynn mit Perfektion das gesamte Geschehen. Mit markanter Bühnenpräsenz und messerscharfem Schauspiel verkörpert er den schillernden Star-Anwalt als eleganten Marionettenspieler – ein Mann, der stets die Fäden in der Hand hält, während seine Klientinnen ahnungslos an den Strippen tanzen.
Alt spielt Flynn nicht als bloßen Zyniker, sondern als kalkulierenden Verführer, dessen Lächeln nie ganz die Augen erreicht – ein Mann, der das System nicht nur durchschaut, sondern es in jedem Moment zu seinem Vorteil choreografiert. Seine beiden großen Nummern „Ich bin nur für Liebe da“ und Hokuspokus“ serviert er mit perfektem Understatement und sind Showstopper voller Raffinesse und rhythmischer Präzision.
Er bringt das Kunststück fertig, gleichzeitig zu glänzen und zu kontrollieren, zu verführen und zu manipulieren – ein Charmeur mit Skalpell. Kein Laut zu viel, kein Blick zu wenig. Ein souveräner Strippenzieher, der das Ensemble wie ein Varieté-Dompteur durch das Spektakel lenkt. Eins von vielen Highlights der Produktion.

Andreja Schneider verleiht Mama Morton eine wunderbar ironische Autorität und bringt mit warmer Stimme und pointiertem Spiel genau die Ambivalenz dieser Figur auf den Punkt. Das Ensemble von Chicago unter der Choreografie von Otto Pichler ist in seiner Ausführung eine wahre ästhetische Wucht. Es ist ein Hochgenuss für die Augen, ein visuelles Spektakel, das die Sinne auf eine unverwechselbare Weise berauscht. Jeder Schritt, jede Bewegung, jedes noch so kleine Detail ist bis ins Letzte durchdacht und präzise in Szene gesetzt. Pichlers Choreografie fängt die Essenz des Chicago der 1920er Jahre auf brillante Weise ein – das vibrierende, energiegeladene, von Glamour und Verführung durchzogene Chicago, wo jede Bewegung, jeder Tanzschritt gleichzeitig ein Spiel mit Macht, Begierde und Gefahr ist. Und trotz des Vergleichs mit Bob Fosse schafft Pichler es, eine eigene Handschrift zu entwickeln, die Chicago frisch und aufregend wirken lässt, ohne dabei die Wurzeln der klassischen Inszenierung aus den Augen zu verlieren.
Barrie Koskys Inszenierung von Chicago ist eine brillante Mischung aus kluger Regie, visuellem Hedonismus und subtiler Ironie, die das Original von 1975 in eine neue, überhöhte Dimension katapultiert. Koskys Werk lebt von einer lasziven Eleganz, die durch die intelligent eingesetzten Zwischentöne von Ironie besticht. Er versteht es meisterhaft, das Spiel mit den Genres zu nutzen, wobei er einerseits dem klassischen Charme der 1996er Revival-Version huldigt, aber gleichzeitig eine eigene, tiefgründige Handschrift einbringt, die das Stück mit einer bis ins Detail durchdachten Interpretation neu erfindet. Das Stück selbst über Egoismus, Täuschung und die Verwertbarkeit von Verbrechen im Showbusiness, wird unter Koskys Leitung zu einer furiosen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und ihrer Faszination für Skandale, Ruhm und die dunklen Seiten des menschlichen Begehrens.
Am Ende bleibt Chicago in Koskys Inszenierung nicht nur ein Musical über Skandale und Verbrechen im Showbiz – es wird zu einem rauschenden Fest, in dem das Publikum von der Kunst der Verführung in den Bann gezogen wird. Und wenn in dieser Welt von Gier und Egoismus wirklich jede*r nur an sich selbst denkt, dann kann sich das Publikum immerhin glücklich schätzen, an diesem fulminaten Exzess teilhaben zu dürfen.
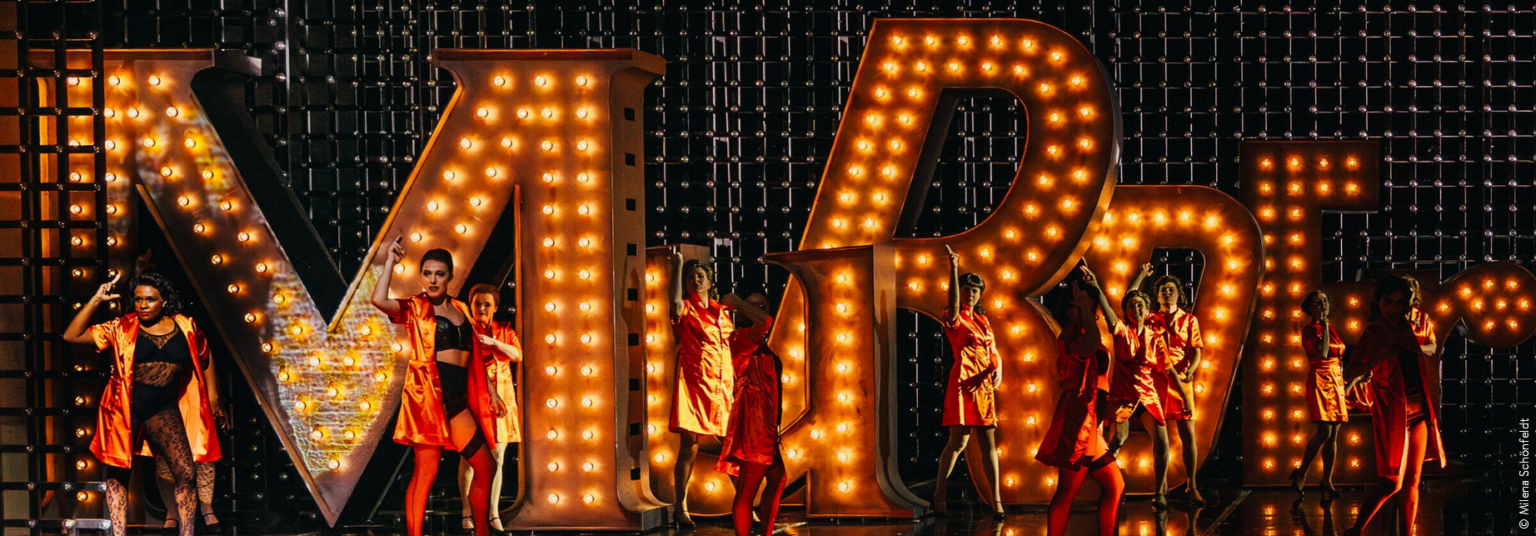

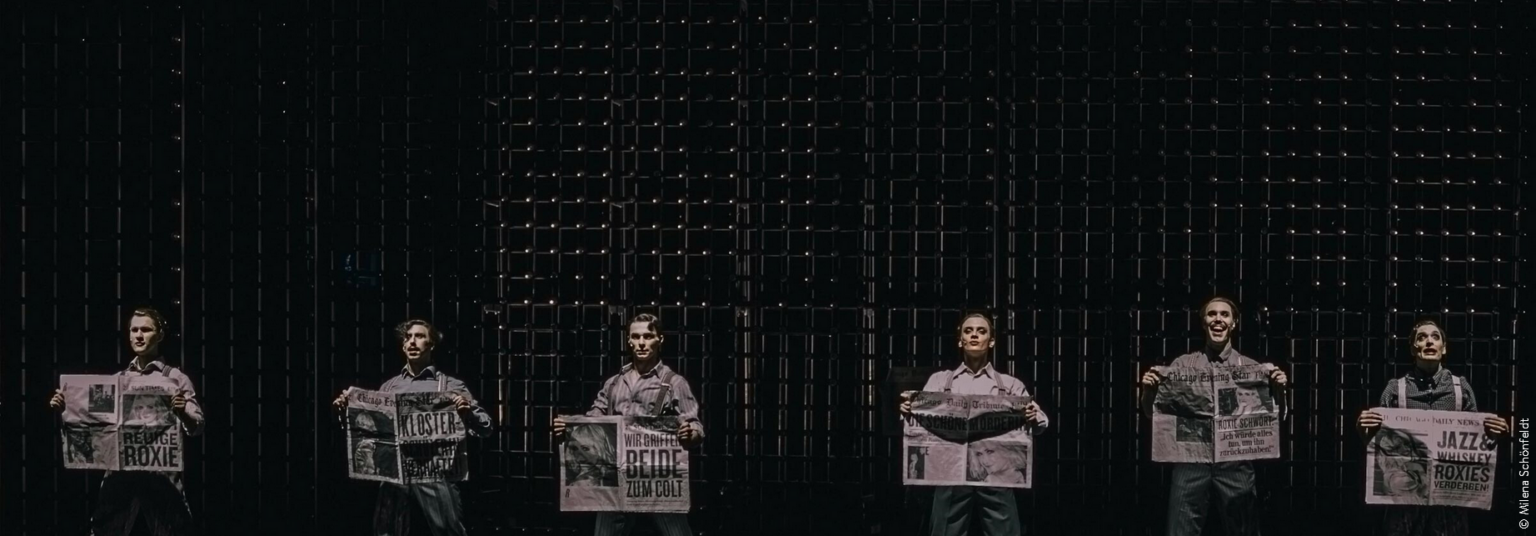
Review: & JULIA
Operettenhaus Hamburg

von Marcel Eckerlein-Konrath
In Hamburg, wo die Elbe fließt und die Reeperbahn ihren nächtlichen Glanz verströmt, steht das Operettenhaus seit Jahrzehnten für große musikalische Momente. Dieses traditionsreiche Theater, 1986 zur Musicalbühne umgewandelt, hat mit Produktionen wie Cats, Mamma Mia! oder Tanz der Vampire Meilensteine der deutschen Musicalgeschichte gesetzt. Nun beherbergt es ein Stück, das ebenso frech wie tiefgründig, ebenso bunt wie berührend ist: & JULIA – eine popmusikalische Revolution des klassischen Shakespeare-Stoffes.
Was wäre, wenn Julia nicht gestorben wäre? Wenn sie sich nicht in den Tod gestürzt hätte aus jugendlicher Verzweiflung, sondern beschlossen hätte: Das Leben beginnt jetzt erst recht?
Genau diese Frage stellt sich Anne Hathaway – nicht die Schauspielerin, sondern die Ehefrau Shakespeares. In dieser clever gebrochenen Metaebene beginnt die Geschichte von & JULIA: Anne schreibt ihrem Mann das Ende seiner berühmtesten Tragödie kurzerhand um. Ihre Julia lehnt sich gegen das vorgezeichnete Schicksal auf, zieht nach Paris, begegnet neuen Lieben, alten Illusionen und der Frage, wer sie jenseits von Romeo eigentlich ist.
Es ist ein brillanter Kunstgriff: Die klassische Tragödie wird mit popkultureller Selbstermächtigung versetzt, und was entsteht, ist kein bloßes Spektakel, sondern ein subversiv intelligentes, musikalisch mitreißendes Theatererlebnis.
Im Zentrum des Musicals steht das imposante Songbook von Max Martin, dem schwedischen Superproduzenten, der die Popwelt der letzten drei Jahrzehnte geprägt hat wie kaum ein anderer. Ob Britney Spears‘ ...Baby One More Time, Katy Perrys Roar, Céline Dions That’s The Way It Is, Kelly Clarksons Since U Been Gone oder die Backstreet Boys mit I Want It That Way – die Songs sind vertraut, aber ihre Wirkung in diesem neuen erzählerischen Kontext ist überraschend emotional, oft humorvoll und stets klug inszeniert.
Was schnell zur Jukebox-Falle hätte werden können, wird hier zu einem herausragenden Beispiel für musikalisches Storytelling. Die Hits sind nicht bloße Einschübe, sie treiben Handlung und Figurenentwicklung aktiv voran.

Willemijn Verkaik als Anne ist das unbestrittene Kraftzentrum des Abends. Ihre Bühnenpräsenz ist ebenso eindrucksvoll wie ihre stimmliche Ausnahmeklasse. In der Ballade That’s The Way It Is erschafft sie einen Moment purer musikalischer Magie – getragen von technischer Brillanz, tiefer Emotionalität und einer Bühne, die kurz den Atem anhält. Die stehenden Ovationen, die ihr folgen, sind nicht weniger als verdient.
Chiara Fuhrmann in der Rolle der Julia ist eine wunderbare Besetzung: jugendlich-frisch, mit klarem, durchsetzungsfähigem Gesang und großem spielerischen Charme. Sie balanciert mühelos zwischen rebellischem Trotz und innerer Verletzlichkeit – eine moderne Heldin, der man gerne folgt.
Jacqueline Braun jedoch ist der heimliche Showstealer des Abends. Als Julias Amme bringt sie nicht nur großartige komödiantische Momente, sondern auch eine gesangliche Wucht auf die Bühne, die ihresgleichen sucht. Ihre Szenen sind geprägt von Witz, Timing und einer Stimme, die im besten Sinne überwältigt. Man wünscht sich tatsächlich, sie würde die Bühne nie verlassen.
Andreas Bongard als Shakespeare selbst bleibt solide, angenehm präsent, humorvoll. Stimmlich kann er mit der Wucht Verkaiks zwar nicht mithalten – doch in seiner charmanten Unsicherheit und ironischen Selbstreflexion liegt eine Rolle, die er klug ausfüllt.
Zwischen popkultureller Explosion, Shakespeare’scher Ironie und queerer Selbstermächtigung entfaltet sich im zweiten Handlungsstrang von & JULIA eine Geschichte, die leiser beginnt – und umso nachhaltiger wirkt: die Erzählung von May und François, zwei Figuren, die einander inmitten des schrillen Trubels begegnen – und in ihrer Zartheit herausragen.
May, gespielt mit bemerkenswerter Sensibilität und natürlicher Bühnenpräsenz von Bram Tahamata, ist nicht-binär – und bringt damit eine Identität ins Musical, die bislang viel zu selten auf großen Bühnen in den Mittelpunkt gerückt wird. Es ist das Verdienst der Inszenierung, dass Mays Geschichte nicht mit Pathos oder Belehrung erzählt wird, sondern mit Empathie, Humor und Mut. Die Figur ist stolz, verletzlich, selbstironisch – und damit durch und durch menschlich.
In der zögerlich-ungeschickten Annäherung an François Dubois, den liebenswert unbeholfenen jungen Adligen, gespielt von Oliver Edward, findet & JULIA zu Momenten echter Emotionalität. Edwards verleiht François eine warmherzige Unsicherheit, einen leichten, spitzbübigen Charme – und wenn beide gemeinsam auf der Bühne stehen, spürt man: Hier treffen sich zwei Seelen, nicht zwei Rollenklischees.
Der Song I’m Not A Girl, Not Yet A Woman, interpretiert von May, ist einer der großen Gänsehautmomente des Abends. Was bei Britney Spears einst eine Coming-of-Age-Hymne für Teenager war, wird hier zu einer zutiefst persönlichen, authentischen Selbstverortung – zart, ehrlich, mutig und von Herzen kommend.
Die Chemie zwischen Tahamata und Edward ist fein gezeichnet, niemals aufgesetzt. Ihr Duett Perfect (im Original von Pink) ist ein weiterer Höhepunkt: ein Liebeslied, das weniger auf große Gesten, als auf stille Akzeptanz setzt. Das macht es umso kraftvoller.
Während viele Figuren in & JULIA durch Tiefe, Wandlung und Witz glänzen, bleibt Raphael Groß in der Rolle des Romeo etwas hinter dem strahlenden Ensemble zurück. Sicher, er erfüllt das Bild des überromantischen Schönlings mit Charme und einem gewissen Bühnenflair – doch leider bleibt seine Darstellung insgesamt recht eindimensional.
Vielleicht liegt es zum Teil am Rollenprofil, das Romeo bewusst als überzeichnete Karikatur seiner eigenen literarischen Tragik anlegt – ein Mann, der nicht über Julia, sondern vor allem über sich selbst hinwegkommen muss. Doch wo die Inszenierung Raum ließe für ironische Brechung oder emotionale Tiefe, bleibt Großs Spiel oft an der Oberfläche.
Besonders hervorzuheben ist das Ensemble: eine brillante Mischung aus tänzerischer Präzision, stimmlicher Stärke und mitreißender Spielfreude. Die Choreografien sind energetisch, die Szenenübergänge fließend, und das Timing sitzt auf den Punkt. Hier wird mit Lust und Liebe zum Detail gearbeitet – das spürt man in jeder Bewegung.
Ein wahres Geschenk ist auch die deutsche Übersetzung der Dialoge. Sie sind unverschämt witzig, clever konstruiert, anspielungsreich und dennoch zugänglich. Der Humor ist temporeich, manchmal frech, oft überraschend – und trifft durchweg ins Schwarze.
& JULIA ist weit mehr als eine moderne Shakespeare-Variation. Es ist ein Musical, das mit Erwartungen spielt, sie übertrifft, das Genre feiert und dabei etwas Eigenes schafft. Es bringt Feminismus, queere Perspektiven, Humor und Herz auf eine Bühne, die bebt vor Energie – und das alles mit dem Glitzer eines popmusikalischen Welttheaters.
Ein Abend, der leicht beginnt, laut lacht – und doch mit leisen Fragen endet: Was will ich selbst vom Leben? Was ist mein eigener Text?
Ein Muss für Musical-Fans, ein Geschenk für alle, die Theater mit einer Explosion aus Witz, Pop und Empowerment lieben.
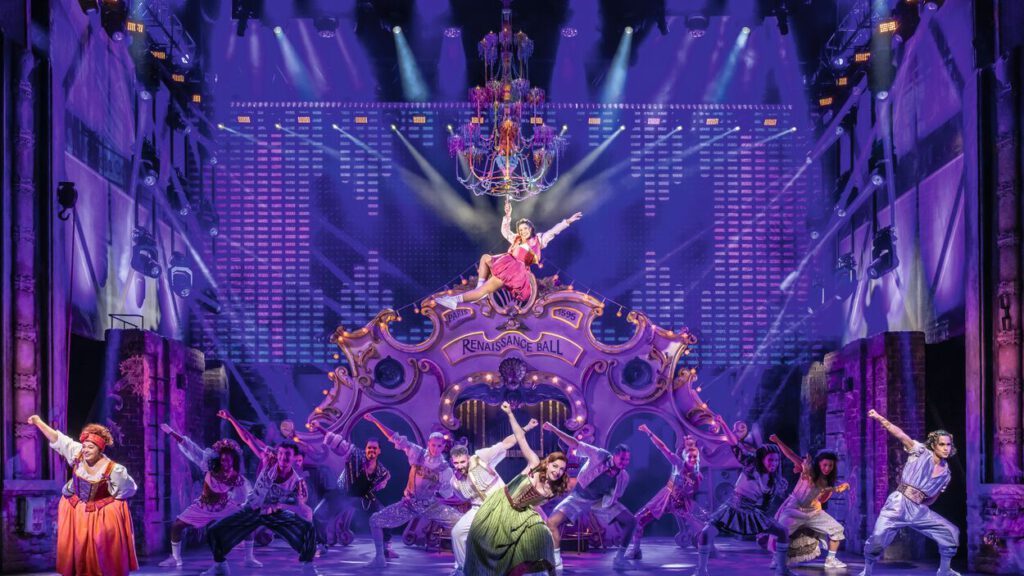



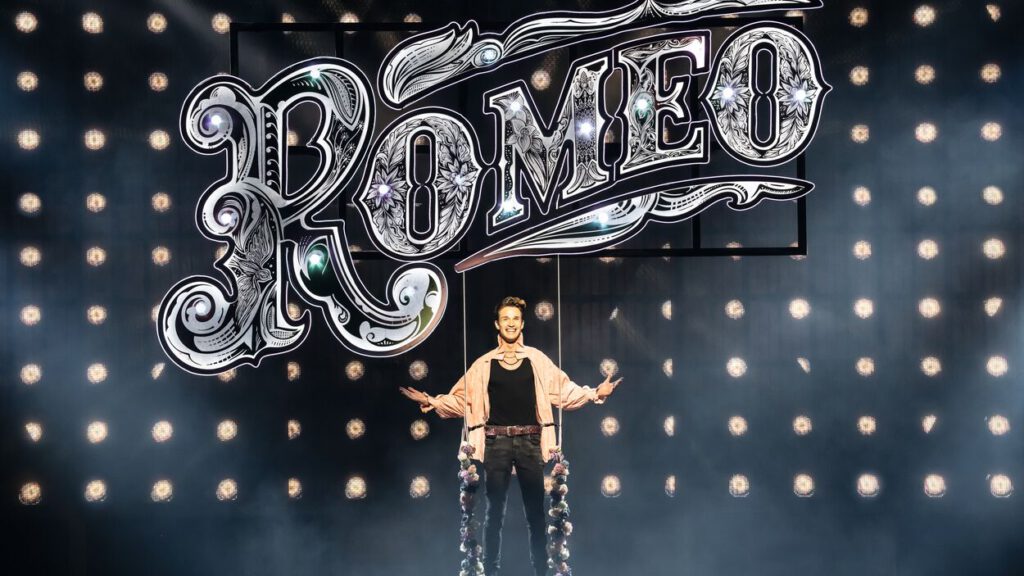
Review: LA CAGE AUX FOLLES
Komische Oper Berlin


von Marcel Eckerlein-Konrath
Subtil taucht im Wortschatz von Regisseur Barrie Kosky nur sehr sporadisch auf, zumindest wenn es um seine Inszenierung von Jerry Hermans Musical „La Cage Aux Folles“ geht. Mit seiner Arbeit für die Komische Oper Berlin demonstriert der beliebte australische Regisseur eine kurzweilig, opulent bunte Symphonie aus Farben und Formen, umschmeichelt von exorbitant aufwändigen Kostümen von Klaus Bruns. Jeder der weiß, was sich hinter Tom of Finland und seiner homoerotischen Kunst verbirgt, wird sich ein Schmunzeln beim Bühnenbild von Rufus Didwiszus nicht verkneifen können. Da wir uns aber weder bei Strindberg, noch bei Ibsen befinden und auch die Dialoge eher „Golden Girls“ als „Totentanz“ sind, ist eine gewisse erfrischende Spitzfindigkeit uneingeschränkt willkommen. Als das Musical von Hermann, mit dem Buch von Harvey Fierstein am 21. August 1983 uraufgeführt wurde, war die Welt noch eine andere. Motorola brachte das erste kommerzielle Mobiltelefon auf den Markt, es war das Ende des Kalten Krieges, Michael Jacksons „Thriller“ erschien und in der Filmwelt feierten Filme wie „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ und „Scarface“ Erfolge. Nelson Mandela und Oliver Tambo erhielten den UNESCO-Preis für ihre Arbeit im Kampf gegen die Apartheid in Südafrika. Und es war der Beginn der AIDS Krise, die verheerende Auswirkungen auf Millionen von Menschen weltweit hatte. Als das Musical debütierte, war die Diskussion über gleichgeschlechtliche Beziehungen und Transgender-Themen noch relativ neu und oft von Vorurteilen und Tabus geprägt.

La Cage Aux Folles brachte diese Themen jedoch selbstbewusst, wie selbstverständlich auf die Bühne und leistete einen wichtigen Beitrag zur zunehmenden Akzeptanz und Sichtbarkeit der LGBTQ+ Community. So wurde ein schwules, sich liebendes Paar auf der Bühne zu einem gigantischen Broadway Erfolg. Es gewann mehrere Tony Awards, darunter den für das beste Musical, und lief über 1.700 Vorstellungen. Die Premiere im Berliner Theater des Westens, wurde damals bei der deutschsprachigen Uraufführung zu einem Triumph für Intendant Helmut Baumann und „Ich bin, was ich bin“ zu einer Hymne und genießt seitdem Kultstatus. Für die Komische Oper verwendet Kosky die neue Übersetzung von Martin G. Berger, der „La Cage“ bereits an der Oper Basel mit Stefan Kurt inszenierte. Kurt ist auch in Berlin als Zaza zu sehen. „La Cage Aux Folles“ dreht sich um das Leben des schwulen Paares Georges, dem Besitzer eines Nachtclubs, und Albin, der als Drag Queen namens Zaza in Georges‘ Club auftritt. Probleme entstehen, als Georges‘ Sohn Jean-Michel ankündigt, dass er heiraten möchte. Jean-Michel ist der Sohn von Georges aus einer früheren heterosexuellen Beziehung und ist besorgt darüber, wie seine konservativen zukünftigen Schwiegereltern auf seine unkonventionelle Familie reagieren würden. Um den Eltern seiner Verlobten einen traditionelleren Eindruck zu vermitteln, bittet Jean-Michel Georges und Albin, ihre wahre Identität zu verbergen, was zu wunderbar komischen Verwicklungen führt. Stefan Kurt kann als Zaza sämtliche Register seines Schauspielportfolio ziehen und ist als Revuestar absolut überragend. Seine gesanglichen Qualitäten erinnern leicht an eine Marlene Dietrich oder Hildegard Knef mit einem Schuss Georgette Dee und reichen zwar nicht an einen ausgebildeten Musicalsänger heran, können aber dennoch überzeugen und treffen direkt ins Herz. Das was Kurt gesanglich nur andeutet, macht er schauspielerisch umso eindringlicher und eindrucksvoller in einer rundherum überzeugenden und starken Charakterisierung wett. Als sein Mann Georges ist Kammersänger Peter Renz ein guter Gegenpart zu Stefan Kurt, wenngleich der ausgebildete Tenor erwartungsgemäß auf dem musikalischen Sektor besser punkten kann als sein Kollege. Auch wenn die beiden gut harmonieren und die Chemie stimmt, glaubt man ihnen das verliebte, seit langer Zeit zusammenlebende Paar nicht so ganz. Daniel Daniela Ojeda Yrureta ist als Zofe Jacob mit stetig wechselnden Kostümen (auch hier zieht Klaus Bruns wieder alle Register seines Könnens) mit Akrobatik und einem Feuerwerk der Exzentrik ein echter Scene Stealer, der mit vulkanartigem Temperament für reichlich Lachsalven sorgt. Nicky Wuchinger und Maria-Danaé Bansen als Jean-Michel und Ann bleiben etwas farblos und austauschbar im Hintergrund, während Angelika Milster einen leicht desolaten Gastauftritt als Clubbesitzerin Jaqueline hinlegt. Auch wenn die große Diva nur wenige Zeilen singt, wirken ihre wenigen Dialoge stark unterprobt und etwas fahrig. Sie tritt bei der Wiederaufnahme in die Stilettos von Helmut Baumann, der Zaza der deutschen Uraufführung, der Jacqueline vor Milster spielte.
Grandios sind die Cagelles, die mit tänzerischer Finesse (Choreographie: Otto Pichler und Stepp-Choreographie: Mariana Souza) und überdrehter Slapstick zu einer weiteren, wertvollen Bereicherung für die Show werden. Dezenz ist auch hier eher Schwäche, denn der Humor ist streckenweise derb, besonders im ersten Akt stark, im zweiten hingegen etwas schleppender. Unter der hervorragenden musikalischen Leitung von Maestro Koen Schoots versprüht das Orchester der Komischen Oper einen satten Sound, der in der aktuellen Ausweichstätte im Schillertheater formvollendet ins Parkett brandet. „Ich bin was ich bin“ ist nach wie vor eine Hymne an die Individualität und ein Manifest für die Akzeptanz, trotz möglicher Ablehnung oder Verurteilung durch andere. Der Song ist, wie das Musical selbst, eine Feier der Individualität und ermutigt dazu, sich selbst treu zu bleiben und sich nicht von gesellschaftlichen Normen oder Vorurteilen einschränken zu lassen. „Es wird kein zurück, kein Fangnetz geben, einmal, also outet euch und raus ins Leben! Man lebt ohne Sinn, bis man dann sagt: Hey Welt, ich bin, was ich bin!“ Harvey Fierstein schrieb das zentrale Lied zunächst als Monolog und wurde dann von Jerry Herman in den prägnanten Song übersetzt, den wir alle kennen und lieben. So feiert Kosky mit seiner Inszenierung das Leben und die Liebe in jeder Form und Farbe. Und wenn dann am Ende „Die schönste Zeit ist jetzt“ ertönt, wissen wir alle, vielleicht etwas geblendet von Pailletten und Federn, das alles gut werden wird. Dazu sagt Kosky: „Die Aufführung von ‚La Cage Aux Folles‘ sollte für die Leute wie eine Batterie sein! Nach dem Besuch sollten sich alle viel, viel besser fühlen als davor. Die Vorstellung sollte sie befreien! […] Es ist so wichtig, das Musiktheater als einen Ort zu haben, wo man drei Stunden den Alltag vergessen kann, um neue Energie zu tanken.“


Review: LES MISÉRABLES
Gärtnerplatztheater München


von Marcel Eckerlein-Konrath
Als die Musicalversion von Victor Hugos Roman „Les Misérables“ 1985 im Londoner Barbican Theatre Premiere feierte, waren die Kritiken der Presse vernichtend. Von „geistlos“, „synthetisch“ und „schrecklich“ war da die Rede. Kaum jemand konnte sich vorstellen, dass dieses Werk die Zeit überstehen würde, geschweige denn Musicalgeschichte schreiben könnte. Nach über 15.000 Vorstellungen im Londoner West End, zahlreichen Tony Awards, einem Grammy, einer starbesetzten, Oscar prämierten Verfilmung und unzähligen internationalen Produktionen, kann man getrost behaupten, dass sich das Werk als astreiner Welthit entpuppt hat. Im Laufe der Zeit verstummten die negativen Kritiken, einige Vertreter unserer Zunft betrachteten das Werk sogar nach Jahren noch einmal neu und weitaus wohlwollender. Denn eins muss sich jeder Kritiker zugestehen: „Les Misérables“ hat es verdient, als musikalisches Meisterwerk betrachtet zu werden. Das nun das Staatstheater am Gärtnerplatz den Zuschlag für eine neue Produktion unter dem wachsamen Auge von Original Produzent Cameron Mackintosh erhalten hat, gleicht einer Sensation. Als Rechteinhaber wählt Mackintosh sehr sorgfältig die Produktionen aus und vergibt nur äußerst selten Lizenzen. Umso erfreulicher ist es, dass „Les Misérables“ nun endlich in München zu sehen ist, nachdem sich Intendant Josef E. Köpplinger mehrere Jahre vergeblich darum bemühte die Rechte zu ergattern. Es ist eine Freude die üppige, gewaltige Musik von Claude-Michel Schönberg in solch großer orchestraler Besetzung unter der Leitung von Maestro Koen Schoots zu erleben. Für seine Inszenierung hat Regisseur und Gärtnerplatz Intendant Josef E. Köpplinger behutsam die Original Inszenierung von Trevor Nunn und John Caird adaptiert und beeindruckend auf die die Münchner Bühne gebracht. Wie im Original Konzept gibt es eine Drehbühne, die funktional arbeitet und so schnelle Szenenwechsel ermöglicht. Dazu gibt es eine Treppe und verschiedene Versatzstücke aus beweglichen Podesten und natürlich die große Barrikade im zweiten Akt (Bühnenbild: Rainer Sinell).

An diesem Premierenabend liegt ein ganz besonderes Knistern in der Luft. Als das Orchester die ersten Töne des Prologs anstimmt wird schnell klar, hier geschieht etwas monumentales. Kraftvoll strömen die Töne den Zuschauern entgegen und geben den Blick auf die Bühne und das Gefangenenlager frei, in dem Jean Valjean festgehalten wird und zur Zwangsarbeit verdammt ist. Schon bei den ersten Tönen durch Hauptdarsteller Armin Kahl ist eine merkliche stimmliche Restriktion zu hören. Und ja Kahl ist so angeschlagen, dass er im zweiten Teil durch die alternierende Besetzung Filippo Strocchi ersetzt wird. Live Theater ist wahrlich eine grausame Geliebte: so schön, wie auch unberechenbar zugleich. So liefert Strocchi eine solide Darstellung des Jean Valjean und eine eindringlich gefühlvolle Version von „Bring ihn heim“. Doch der Star des Abends ist in jedem seiner Auftritte mit gewaltiger, bebender Stimme Daniel Gutmann als Inspektor Javert, der Valjean über Jahre verfolgt und ihn nicht loslassen kann. Er repräsentiert eindringlich einen Charakter, in einem Konflikt mit dem Prinzip der menschlichen Gnade und Vergebung. Gutmanns starker Bariton malt eine breite Palette von Klangfarben und Ausdrucksmöglichkeiten und ist dabei kraftvoll und omnipräsent, gleichzeitig aber auch sehr nuanciert und sanft. Javert ist in Gutmanns Charakterisierung eine tragische Figur, die die Komplexität des menschlichen Geistes und die Nuancen von Recht und Gerechtigkeit im Verlauf des Musicals in Frage stellt. Seine Version von „Stern“ gehört zu einem eindrucksvollen Gänsehaut Moment und dem Highlight des Abends. Eine bessere, tiefgreifendere Darstellung ist derzeit kaum auf deutschsprachigen Bühnen zu erleben. Zu recht erhält Gutmann dafür frenetischen, lang anhaltenden Applaus. Somit reiht sich sein Javert in die A Liga eines Philip Quast, Jeremy Secomb und Norm Lewis ein. Bravo!
Wietske van Tongeren gibt eine stimmgewaltige Fantine, eine tragische Figur, die die harte Realität des Lebens in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts widerspiegelt. Ihr Charakter symbolisiert sehr gut die Opferbereitschaft und den unermüdlichen Kampf gegen Armut und Ungerechtigkeit. Das alles schafft van Tongeren herzzerreißend und mit warmer, schöner Stimmfärbung einzufangen. Als gieriges Ehepaar Thénardier, die skrupellos bereit sind eiskalt über Leichen zu gehen, überzeugen Alexander Franzen und Dagmar Hellberg. Die beiden liefern ein wahres Kabinettstück der Komik, gepaart mit beißendem Zynismus und derben Klamauk. Die Thénardiers sind nicht nur Antagonisten für die anderen Charaktere des Musicals, sondern auch Symbole für die Korruption und Verderbtheit, die in einer Gesellschaft grassieren können, in der Armut und Ungerechtigkeit herrschen. Franzen und Hellberg liefern solch ein großartiges Portrait dieser durch und durch unsympathischen Figuren und stehlen so manche Szene am Premierenabend, das es eine wahre Freude ist. Mit unbändiger Leidenschaft und fantastischer Stimme berührt Katia Bischoff als Eponine und ihrem „Nur für mich“. Eponines Liebe zu Marius (gut: Florian Peters) ist ein wichtiger Teil des Musicals. Obwohl Marius sie nur als gute Freundin betrachtet und seine Gefühle ausschließlich für Cosette (der glockenhelle Sopran von Julia Sturzlbaum erfreut) reserviert sind, bleibt Eponine ihm treu ergeben. Ihre unerwiderte Liebe zu Marius bringt sie dazu, heroische Taten zu vollbringen, um ihn zu beschützen und glücklich zu sehen, auch wenn dies bedeutet, ihre eigenen Gefühle zu unterdrücken und für ihn zu leiden. Obwohl die deutsche Übersetzung von Heinz Rudolf Kunze sehr stimmig ist und grobflächig sehr gut funktioniert, gibt es beim Duett von Eponine und Marius mit „Der Regen“ einige Textzeilen, die den Terminus Kitsch in eine ganz neue Sphäre katapultiert: „Ich bin nicht mehr in Not // Der Regen färbt mich rot,// doch tut er mir nicht weh.// Ihr helft – ich könnt‘ vor Glück verglüh’n. // Ihr schützt mich vor der Nacht,// Ihr haltet mich ganz sacht // und Regen läßt die Blumen blüh’n.“


Unbedingte Erwähnung muss das wahrlich große, wie großartige Ensemble finden. Jeder einzelne Darsteller, jede einzelne Darstellerin spielt mit einer solcher Hingabe und Leidenschaft, das die beklemmende Atmosphäre vor der französischen Revolution eindrucksvoll eingefangen wird. Dazu ist die Diktion hervorragend und perfekt abgestimmt. Merlin Fargel ist ein glühender, stimmlich beeindruckender Enjolras, während Florian Peters als Marius mit „Dunkles Schweigen an den Tischen“ überzeugen kann.
Boubil und Schönberg haben mit „Les Misérables“ ein eindrucksvolles Meisterwerk und Gesamtkunstwerk für die Ewigkeit geschaffen. Die emotionalen Balladen funktionieren dabei ebenso hervorragend, wie die hymnischen Ensemble Nummern „Am Ende des Tags“, „Morgen schon“ oder „Hört ihr wie das Volk erklingt?“ Themen wie Liebe, Vergebung, soziale Gerechtigkeit und den Kampf um Freiheit sind zeitlos und berühren auch so viele Jahre nach der Uraufführung. Das Musical hat einen weiten Weg hinter sich, von einer französischen Konzertproduktion im Jahr 1980 zur gefeierten West End Show und später zum Broadway Erfolg und ganze 43 Jahre später endlich als Premiere in München. Das Warten hat sich gelohnt. „Les Misérables“ gibt als komplett durchkomponiertes Musical all das, was der geneigte Zuschauer erwartet und noch so viel mehr. Ein Abend, der sicher in die Chroniken des Gärtnerplatztheaters eingehen wird, als Erfolg auf ganzer Linie. Zurecht sind alle Vorstellungen bereits ausverkauft, doch die Glücklichen, die ein Ticket besitzen, können sich auf ein perfekt abgestimmtes Theaterereignis freuen. „Les Misérables“ wird somit in München zu einem uneingeschränkten Triumph für Köpplinger und seinem hervorragenden Ensemble und Kreativ Team. Der Siegeszug eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten geht unangefochten weiter.
Review: JESUS CHRIST SUPERSTAR
Staatstheater Nürnberg


von Marcel Eckerlein-Konrath
Ende 2023 fällte ich eine für mich eine wichtige Wahl: ich trat aus der römisch katholischen Kirche aus. Eine wahrlich nicht leichte Entscheidung gegen eine Gemeinschaft, der ich über mehrere Jahrzehnte angehörte. Ich war als Ministrant und Lektor zudem auch jahrelang aktiv in das Gemeindeleben einbezogen. Obwohl meine persönlichen Erfahrungen zum Glück positiver Natur waren, konnte ich als homosexueller Mann nicht länger mit ansehen, wie sehr die Kirche ihr eigenes Unternehmen gegen die Wand fährt, wie Werte verkauft werden und vor allem wie mit Opfern von sexuellem Missbrauch verabscheuungswürdig schlecht umgegangen wird. Die Kombination aus Machtstrukturen, durch die Täter geschützt werden und Opfern denen kein Gehör geschenkt wird, soll angeblich durch eine Kommission aufgearbeitet werden. Diese Kirche ist schon seit Jahren nicht mehr meine Kirche. Die Kirchenoberen haben immer noch nicht verstanden, dass Kindesmissbrauchs ein Verbrechen, und nicht etwa Beiwerk des kirchlichen Daseins ist. Seit Jahren gibt die katholische Kirche nur das zu, was man ihr lückenlos nachweisen kann und schützt ansonsten auch heute noch überführte und verurteilte Sexualstraftäter in ihren Reihen. Und dabei wundert sie sich, dass immer mehr Gläubige der katholischen Kirche enttäuscht den Rücken kehren. Das Problem der katholischen Kirche ist das Bodenpersonal, doch auch die evangelische Kirche zieht mit dieser These nach. Laut einer Studie sind zwischen 1946 und 2020 geschätzt 9.355 Kinder und Jugendliche in evangelischer Kirche und Diakonie sexuell missbraucht worden. Die Studie geht von knapp 3.500 Beschuldigten aus, davon gut ein Drittel Pfarrer oder Vikare. Gleich zu Beginn von „Jesus Christ Superstar“ am Staatstheater Nürnberg, wirft Regisseur Andreas Gergen durch Videoeinspielungen (Momme Hinrichs) rotierende Headlines dem Zuschauer entgegen. Schlagzeilen fordern Missbrauchsfälle in der Kirche aufzuarbeiten, thematisieren die gleichgeschlechtliche Ehe (oder etwas reißerischer „Homo Ehe“) und sprechen die Rolle der Frau in der Kirche an. Hier startet Gergen direkt stark und am Puls der Zeit in den Abend. Wir befinden uns in der Vatikanstadt inmitten kopulierenden Würdenträgern der katholischen Kirche.

Dann richtet sich der Fokus auf Judas. Til Ormeloh ist ein eindringlicher und charismatischer Judas, der mit „Heaven on Their Minds“ auch direkt einen der stärksten Nummern der Rock Oper hat. Jesus lebt mit Maria Magdalena und ihrem gemeinsamen Sohn in einer himmelblauen Einraum Butze mit Mahatma Ghandi Bild, Pace Flagge und einem Einrichtungsstil, der irgendwo zwischen Pseudo Yuppie, Ikea und Prenzlauer Berg liegt. Als Jesus scheint Lukas Mayer, besonders im ersten Akt, wie eine wandelnde Baldrianimplosion. Wie im Delirium singt er gleichgültig seine Songs wie Schlager herunter und schafft keine Persönlichkeit und Struktur der Figur Jesus einzuhauchen. Ohne markante Merkmale oder Charakterzüge zeichnet Mayer so einen teilnahmslosen, faden und langweiligen Jesus. Kaum glaubhaft vermittelbar, dass er eine so hypnotische Wirkung auf seine Jünger (hier heißen sie Jesus People und leben in einer Art Hippie Kommune zusammen) hat. Maria Magdalena wird mit souliger Stimme von Dorina Garuci interpretiert. Gesanglich weiß Garuci durchaus zu überzeugen, kratzt mit ihrer Darstellung aber leider nur sehr blass an der Oberfläche einer Charakterzeichnung ihrer Figur und bleibt dadurch etwas farblos. Ihre innere Zerrissenheit wird lediglich bei „I Don’t Know How To Love Him“ etwas nachvollziehbarer deutlich. Wesentlich stärker schauspielerisch, wie gesanglich ist Marc Clear als „Ich wasche meine Hände in Unschuld“ Pontius Pilatus. Mit sehr viel Tiefe und Farbe schafft er es aus seiner verhältnismäßig überschaubaren Rolle das Maximum herauszuholen. Sein Pilatus ist zweifelnd und heuchlerisch, gebrochen und feige. Eine starke Leistung!
In jeder „Jesus Christ“ Inszenierung gibt es diese eine Nummer, die Lloyd Webber als Revuenummer geschrieben hat und in anderem Kontext und mit anderem Text sicher auch als Vaudeville Gassenhauer funktionieren würde: „King Herod’s Song“, bei dem Tim Rice einen seiner denkwürdigsten Reime konzipiert hat: „Prove to me that you’re no fool / Walk across my swimming pool“. Ensemble Mitglied Hans Kittelmann kann als Herodes nicht so recht punkten und schafft nicht den Spagat zwischen der derben Komik und der zugleich düsteren Darstellung der Begegnung zwischen Jesus und seiner Figur kurz vor der Kreuzigung. Was aber auch daran liegen kann, das Gergen die Nummer als platte Revuegroteske inszeniert. Ministranten tanzen um Herodes teilweise kopulierend herum, während Herodes seine Unterwäsche samt Strapsen und Kreuz entblößt. Das Lied steht stark im Kontrast zur restlichen komplexen Musik von Andrew Lloyd Webber und fällt daher etwas aus dem musikalischen Rahmen. Applaus gibt es dennoch danach, was aber mehr dem Song, als dem Darsteller zuzuschreiben ist (Musikalische Leitung: Jürgen Grimm). Einen guten Eindruck hinterlassen Alexander Alves de Paula als Kaiphas, der mit starkem Bass punkten kann und Samuel Türksoy als Petrus. Er hat gemeinsam mit Dorina Garuci das wunderschöne Duett „Could We Start Again Please“ im zweiten Akt und weiß stimmlich zu überzeugen.

Andrew Lloyd Webber und Tim Rice begannen ihre Zusammenarbeit in den späten 1960er Jahren. Sie waren inspiriert von der Idee, die Geschichte von Jesus Christus als zeitgenössisches Rock-Musical zu erzählen, und begannen, Songs und Texte zu entwickeln. Ursprünglich als Konzeptalbum konzipiert, wurde „Jesus Christ Superstar“ in den 1970ern zu einem sofortigen Erfolg. Die Musik, die eine breite Palette von Rock- und Pop-Einflüssen zeigt, gepaart mit den scharfsinnigen Texten von Tim Rice, fand schnell Anklang bei einem jungen Publikum. Das Album verkaufte sich weltweit millionenfach und erreichte hohe Chartplatzierungen. Der Übergang von der Konzeptalbum-Bühnenshow zum Musical erfolgte dann schnell. „Jesus Christ Superstar“ debütierte 1971 am Broadway und wurde ein sofortiger Erfolg. Die Show revolutionierte das Musical-Genre, indem sie Rockmusik in das traditionelle Theater einführte und eine neue Ära des musikalischen Theaters einläutete. 1972 erfolgte dann die Premiere am Londoner West End, wo das Stück stolze acht Jahre lang lief. Damals gab es zahlreiche Proteste und Menschen, die gegen das Musical demonstrierten, weil es angebliche Blasphemie und die Verherrlichung von Judas als zu sympathischen Charakter darstelle. Eine solche Unterstellung würde heute sicher niemand mehr der Show oder der Inszenierung von Gergen ankreiden. Auch wenn dieser als Regisseur oft zum Rundumschlag auf die Institution Kirche ansetzt und ausholt, sind einige Statements nur behauptet, aber nicht konsequent genug ausgeführt. Das Bodenpersonal der Kirche wird zwar als heuchlerisch und manipulativ dargestellt, der letzte elektrisierende und zünde Funke bleibt aber aus, der die Kirche eiskalt entlarvt.

Die große Nummer von Jesus im zweiten Akt „Gethsemane (I Only Want To Say)“ habe ich schon viel viel stärker gehört (Michael Ball, Drew Sarich). Der Song sollte Jesus vor allem als einen Mann, der mit seinen eigenen menschlichen Schwächen und Emotionen zu kämpfen hat, zeigen. Die Texte von Tim Rice reflektieren sehr gut die inneren Kämpfe und Zweifel von Jesus und stellen gleichzeitig existenzielle Fragen nach dem Sinn seines Opfers und seiner Beziehung zu Gott. Dies transportiert sich durch Lukas Mayers Darstellung und Gesang nur sehr marginal. Punkten kann er aber in der entscheidenden und grausamen Kreuzigung, die durch Video eindringlich intensiv, fast schon abnorm festgehalten wird. Auch wenn die Einbindung von Videoelementen nichts neues ist, gelingt es Gergen hier perfide die Perversität dieser Massakrierung aufzuzeigen. Til Ormeloh kann mit seiner Nummer „Jesus Christ Superstar“ erneut zeigen was er kann, wenn er als Todesengel hereinschwebt und den blutüberströmten Jesus für ein letztes geiferndes Interview zur Effekthascherei ausschlachtet.
Andreas Gergen schafft mit seiner Inszenierung ein Bewusstsein für die vielen Fehlentscheidungen des Klerus, legt den Finger letztendlich aber zu oberflächlich in die Wunde. Die Vehemenz hätte durchaus noch etwas intensiver die Kirche an den Pranger stellen dürfen, weswegen seine Version von „Jesus Christ Superstar“ etwas an emotionaler Resonanz und Individualität vermissen lässt.
Fotos Pedro Malinowski
Review: FOLLIES
Staatstheater Wiesbaden
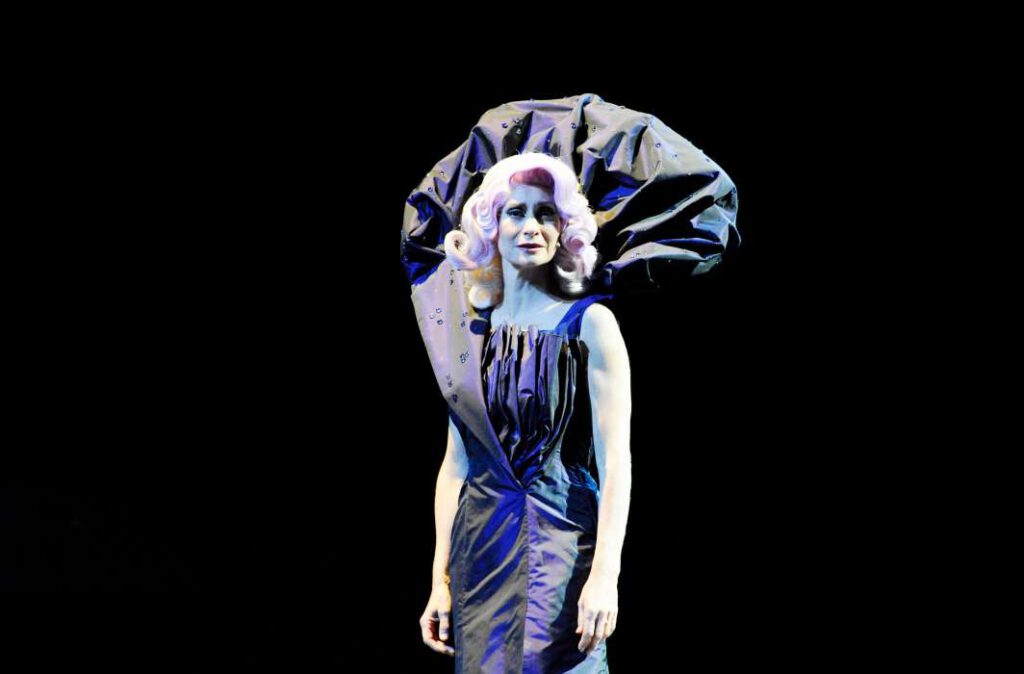

von Marcel Eckerlein-Konrath
In seiner letzten Spielzeit als Intendant des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden wagt Uwe Eric Laufenberg ein außergewöhnliches Unterfangen: Stephen Sondheims Musical Follies kehrt auf die deutsche Bühne zurück. Unter der Regie von Tom Gerber entfaltet sich ein opulentes Spektakel, das mit einem herausragenden Ensemble, prächtigen Kostümen und einem eindrucksvollen Orchester einen unvergesslichen Theaterabend bietet.
Follies spielt im Jahr 1970 in einem zum Abriss bestimmten Theater, dem ehemaligen Schauplatz der glanzvollen Weismann-Revue. Der Impresario Dimitri Weismann lädt seine ehemaligen Showgirls zu einem letzten Treffen ein. Im Mittelpunkt stehen Sally Durant Plummer (Pia Douwes) und Phyllis Rogers Stone (Jacqueline Macaulay), die mit ihren Ehemännern Buddy (Dirk Weiler) und Ben (Thomas Maria Peters) erscheinen. Während die Gäste in Erinnerungen schwelgen, treten die jüngeren Versionen der Hauptfiguren auf und konfrontieren sie mit verpassten Chancen und unerfüllten Träumen. Die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen, und die Charaktere müssen sich ihren Lebensentscheidungen stellen.

Pia Douwes haucht der Figur der Sally Durant Plummer eine überwältigende emotionale Tiefe ein, die weit über bloße Sentimentalität hinausgeht. Ihre Darstellung changiert mit faszinierender Leichtigkeit zwischen bittersüßer Nostalgie, aufgestauter Lebensenttäuschung und einer nahezu schmerzhaften, inneren Fragilität. In jedem Blick, in jeder Geste liegt das Ringen um ein Leben, das anders hätte verlaufen können. Besonders in ihrem Solo „Ich verlier’ den Verstand“ entfaltet sie eine gesangliche Ausdruckskraft, die in ihrer klanglichen Klarheit und emotionalen Wucht schlichtweg atemberaubend ist. Douwes gelingt es, das fragile Innenleben Sallys mit so viel Wahrhaftigkeit zu zeichnen, dass der Zuschauer nicht nur Anteil nimmt, sondern regelrecht mitfühlt – als würde das Herz dieser Figur für einen Moment auf offener Bühne schlagen. Ein glanzvoller, tief berührender Höhepunkt des Abends.
Jacqueline Macaulay verkörpert Phyllis Rogers Stone mit einer faszinierenden Mischung aus kühler Eleganz, messerscharfer Ironie und verletzlicher Tiefe. Ihre Darstellung lebt von einer geradezu filmischen Präzision – jeder Satz ist pointiert, jeder Blick kalkuliert, jede Geste sitzt. Macaulay spielt Phyllis nicht einfach als zynische High-Society-Frau, sondern als vielschichtige, emotional erschöpfte Frau, die sich im goldenen Käfig ihres Lebens eingerichtet hat – und dabei langsam erstickt.
Ihr Zusammenspiel mit Thomas Maria Peters als Ehemann Ben offenbart auf subtile Weise die Erosion einer Ehe, die längst nur noch aus Fassaden besteht. Und doch ist da unter der Oberfläche eine explosive Wut, eine aufgestaute Sehnsucht nach Authentizität, die in Macaulays Interpretation jederzeit spürbar bleibt.
Besonders eindrucksvoll gelingt ihr dies in dem Solo „Könnt’ ich dich verlassen?“ – ein sarkastisch brillanter, musikalischer Monolog, in dem sie mit funkelndem Spott und schneidender Präzision die Trümmer einer gescheiterten Beziehung ausleuchtet. Ihre Stimme ist dabei zugleich kraftvoll, geschmeidig und von einer kontrollierten Intensität, die jedes Wort auflädt.
Macaulay gelingt mit dieser Phyllis das Kunststück, sowohl Diva als auch tief verletzlicher Mensch zu sein – eine Frau, die durch die Jahrzehnte hinweg Haltung bewahrt hat und nun beginnt, Risse zu zeigen. Ein ebenso intelligenter wie berührender Auftritt.
April Hailer setzt als Carlotta Campion ein fulminantes Ausrufezeichen in dieser Wiesbadener Follies-Inszenierung – ein einziger, großer Moment, der den Saal zum Beben bringt. Ihr Auftritt mit dem legendären Song „Bin noch hier“ („I’m Still Here“), einem der wohl ikonischsten Stücke aus Stephen Sondheims Gesamtwerk, ist nicht nur musikalisch brillant, sondern auch schauspielerisch ein kleines Meisterwerk.
Hailer beginnt die Nummer beinahe beiläufig, fast erzählend – wie eine Frau, die in einem Nebensatz ihr gesamtes Leben Revue passieren lässt. Doch mit jedem Vers wächst ihre Präsenz, gewinnt die Figur an Kontur. Sie durchmisst mit großem stimmlichem Facettenreichtum ein ganzes Leben: Aufstieg, Fall, Wiederaufstieg, Glanz, Verrat, Enttäuschung – und Überleben. Dabei changiert sie mühelos zwischen rauer Selbstironie, trotzigem Humor und einer ungebrochenen Stärke, die Carlotta als wahre Überlebenskünstlerin entlarvt.
Stimmlich glänzt Hailer mit sattem Timbre und punktgenauer Phrasierung. Jeder Ton sitzt, jede Silbe ist mit Bedeutung aufgeladen. Sie durchlebt das Lied, anstatt es nur zu singen – als würde sie in diesem Moment tatsächlich jeden einzelnen Lebensabschnitt noch einmal durchleben. Die berühmte Textzeile „I got through all of last year… and I’m here“ wird unter ihren Händen zur kämpferischen Lebensmaxime einer Frau, die nie untergegangen ist, egal wie hoch die Wellen schlugen.
Das Publikum dankt ihr zu Recht mit lang anhaltendem Applaus – ein echter Showstopper, nicht nur wegen der Musik, sondern wegen der schieren Wucht ihrer Bühnenpräsenz. April Hailer zeigt: Carlotta ist nicht nur noch da – sie ist immer noch eine Klasse für sich.
Dirk Weiler als Buddy und Thomas Maria Peters als Ben ergänzen das Hauptquartett mit überzeugenden Darstellungen. Weiler bringt die Zerrissenheit seiner Figur zum Ausdruck, während Peters die innere Leere hinter Bens erfolgreicher Fassade offenbart.
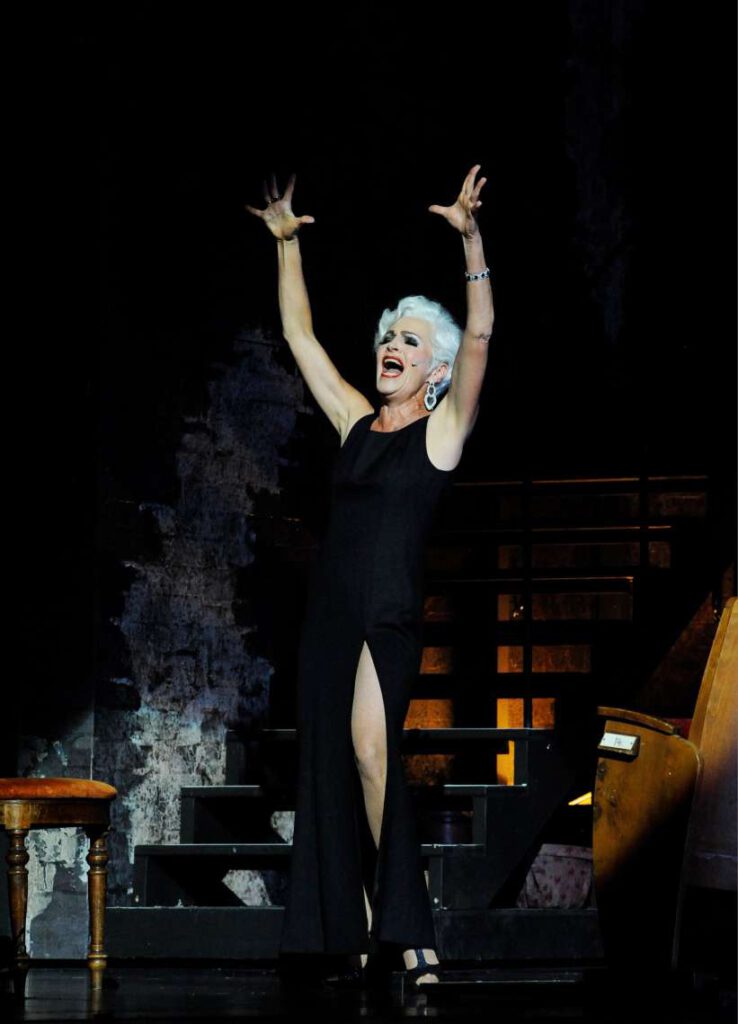
Tom Gerbers Inszenierung von Follies am Staatstheater Wiesbaden ist ein visuell üppiges und atmosphärisch dichtes Theatererlebnis, das sich mit Hingabe der bittersüßen Nostalgie der goldenen Ära des amerikanischen Showbusiness verschreibt. Gerber gelingt dabei ein kunstvoller Balanceakt: Er fängt sowohl die morbide Melancholie des verfallenden Theaters ein – Symbol für geplatzte Träume und vergangene Illusionen – als auch den glitzernden Zauber der einstigen Revuewelt, die in Erinnerungsblitzen wieder zum Leben erwacht.
Das Bühnenbild changiert zwischen bröckelndem Putz, verstaubten Kulissenteilen und verspiegelten Wänden, in denen sich Vergangenheit und Gegenwart überlagern. Gerber nutzt dabei geschickt Projektionen und Lichtstimmungen, um den fließenden Übergang zwischen Realzeit und Erinnerungstheater zu markieren – nie plakativ, sondern stets elegant angedeutet. Die Idee, dass die Figuren sich buchstäblich ihren jüngeren Ichs gegenübersehen, wird theatral überzeugend umgesetzt und verleiht dem Abend eine fast geisterhafte, träumerische Qualität.
Einen wesentlichen Beitrag zur atmosphärischen Dichte leistet Jannik Kurz mit seinen prächtigen, detaillierten Kostümen. Für die Gegenwart dominieren gedeckte Töne, elegante Schnitte und ein Hauch von Melancholie in der Kleidung der gealterten Figuren. Ganz anders die Rückblenden: Da funkeln Pailletten, rascheln Federboas, glitzern Seidenstoffe im Licht der Rampe – Glamour pur, inspiriert von den klassischen Ziegfeld-Follies-Shows und dem Broadway der 1920er- bis 50er-Jahre.
Besonders eindrucksvoll sind die Parallelbilder, wenn junge und alte Versionen der Figuren gemeinsam auf der Bühne stehen – mal spiegelbildlich, mal konfrontativ. Die Kostüme helfen dabei, diese Doppelungen nicht nur optisch klar zu machen, sondern auch emotional aufzuladen.
Insgesamt ist Gerbers Inszenierung nicht nur eine Reminiszenz an vergangene Theaterpracht, sondern auch eine liebevolle, manchmal ironische, manchmal herzzerreißende Reflexion über Zeit, Vergänglichkeit und das, was auf der Bühne – und im Leben – bleibt, wenn der Vorhang gefallen ist.
Mit dieser opulenten Produktion von Follies gelingt dem Hessischen Staatstheater Wiesbaden ein ebenso mutiger wie würdiger Schlusspunkt unter der Intendanz von Uwe Eric Laufenberg. Dass ausgerechnet ein Stück von Stephen Sondheim – jenem Meister der musikalischen Ambivalenz, des psychologischen Tiefgangs und der ironisch gebrochenen Showästhetik – den Abschied markiert, ist ein kluger, ja beinahe symbolischer Kunstgriff. Denn Follies ist kein gefälliges Gute-Laune-Musical, sondern ein melancholisches Meisterwerk über das Vergehen der Zeit, über Selbstbetrug, Illusion und das schmerzhafte Ringen um Wahrhaftigkeit.
Diese Wiesbadener Inszenierung besticht durch ihre schiere Theaterwucht: das grandios aufspielende Orchester unter der musikalischen Leitung von Albert Horne (der mit seinem Auftritt als Weismann/Roscoe einen herrlich augenzwinkernden Übergang zwischen Bühne und Graben schafft), das verschwenderisch ausgestattete Bühnenbild, die liebevoll gestalteten Kostüme und nicht zuletzt das hochkarätige Ensemble, das mit unbedingter Hingabe agiert.
Besonders hervorzuheben ist dabei, wie fein das Zusammenspiel zwischen Regie, musikalischer Umsetzung und darstellerischer Tiefe austariert ist. Jeder Charakter bekommt Raum zur Entfaltung, jede Szene ist durchkomponiert bis ins Detail, ohne je steril zu wirken. Das Ensemble schafft es, Sondheims geniale, mitunter fragmentarisch wirkende Partitur lebendig werden zu lassen – in all ihrer Komplexität, Schönheit und Bitterkeit.
Dass man sich für dieses vielschichtige, anspruchsvolle Werk entschieden hat – und es in solch großer Besetzung und orchestraler Opulenz zeigt – ist nicht nur ein kulturpolitisches Statement, sondern auch ein Geschenk an das Publikum. Follies ist ein Musical, das fordert, aber auch reich belohnt. Wer sich auf die komplexe Struktur und die doppelbödigen Figuren einlässt, erlebt einen Theaterabend von außergewöhnlicher emotionaler und künstlerischer Dichte.
Im prachtvollen, historischen Zuschauerraum des Wiesbadener Staatstheaters – mit seiner kaiserzeitlichen Eleganz, dem funkelnden Kronleuchter, den roten Samtlogen und der goldenen Decke – entfaltet Follies eine Aura, die kaum passender sein könnte: Eine rauschhafte, melancholische, manchmal auch ironisch gebrochene Feier des Theaters – als Lebensraum, als Traumfabrik, als Erinnerungsmaschine.
Ein Muss für alle Liebhaber des Musiktheaters – und ein eindrucksvoller, nachhallender Abschiedsgruß eines Intendanten, der immer wieder den Mut hatte, große Geschichten in großer Form zu erzählen.

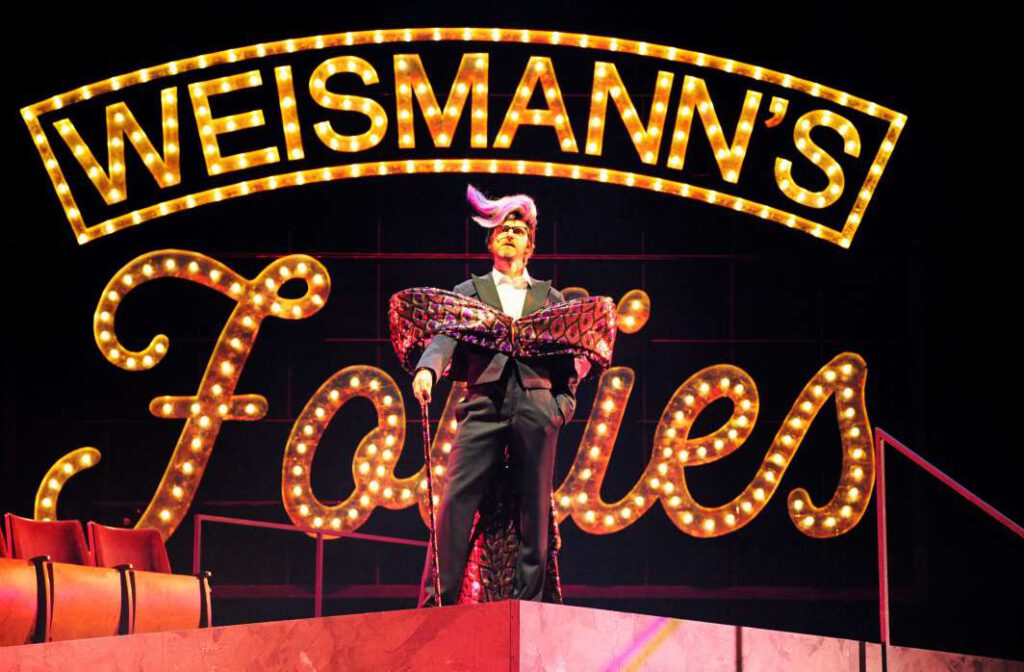

Review: SUNSET BOULEVARD
Savoy Theatre, London


von Marcel Eckerlein-Konrath
Sunset Boulevard war Mitte der 1990er mein erstes West End Musical, dass ich sah. Elaine Paige war meine Norma und diese prägende Erfahrung ihrer herausragenden Performance machte mich zu ihrem Fan und zum Beginn meiner Liebe zu „Sunset Boulevard“. Die Musik beeindruckte mich dabei ebenso sehr wie das ausladende Bühnenbild von John Napier und die prunkvollen, aufwendigen Kostüme von Anthony Powell. So musste sich jahrelang auch zwangsläufig für mich jede neue Inszenierung am Original von Trevor Nunn messen. Im Laufe der Jahre sah ich viele verschiedene Interpretationen und Produktionen. Keine davon konnte so recht ans Original heranreichen. Nun sorgte eine neue Produktion in London für reichlich Wirbel und ich muss gestehen ich war infiziert. Ich wollte und musste mir diese Show unbedingt anschauen. Jamie Lloyd hat mit seiner Inszenierung etwas ganz erstaunliches geschaffen. Er hat die Show nicht nur inszeniert, sondern demontiert, dekonstruiert und vollkommen neu zusammen gefügt. Seine Interpretation ist mutig, einzigartig und hat mit dem Sunset was ich bislang kannte, nichts mehr gemein. Es gibt keine Kostümwechsel (bis auf einen winzigen), alle tragen schwarz weiß und es gibt keinerlei Bühnenbild und Requisiten (Bühne und Kostüme: Soutra Gilmour). Kann das funktionieren? Oder noch anders gefragt: kann dies emotional berühren? Oh ja und wie! Besonders die Musik von Lloyd Webber wird hier zum weiteren Hauptdarsteller. Seine Melodien sind so stark, so treibend dass ich genussvoll wertschätze, welch Meisterwerk er damit geschaffen hat. Das Orchester in London ist überragend. Jeder einzelne Ton, der da aus dem Graben kommt durchströmt den Körper und regt alle Sinne an. Die Musik in „Sunset Boulevard“ von Andrew Lloyd Webber zeichnet sich ganz klar durch ihre dramatische Intensität und emotionale Tiefe aus. Webber ist für mich einer der renommiertesten und besten Musicalkomponisten, der eine Partitur geschaffen hat, die die düstere Atmosphäre des Handlungssettings rund um den ehemaligen Stummfilm Star Norma Desmond und ihre aussichtslose Liebe zum jungen Drehbuchautoren Joe Gillis perfekt einfängt. Die opulenten Orchesterarrangements von Andrew Lloyd Webber und David Cullen erklingen im Savoy Theatre in absoluter Perfektion. Webber nutzt ein reiches Klangspektrum, um die Pracht und den Glanz der Hollywood-Ära, in der die Handlung spielt, widerzuspiegeln. Webber verwendet Leitmotive, um bestimmte Charaktere oder Themen zu repräsentieren. Dies trägt zur Kohärenz der Partitur bei und verknüpft musikalisch verschiedene Szenen und Handlungsstränge meisterhaft miteinander.

Tom Francis beweist von der ersten Sekunde, in der er singt, dass er eine Idealbesetzung für Joe Gillis ist. Für mich der stärkste Joe seit Alexander Hanson. Er ist rau und zärtlich zugleich. Er singt durchdringend brillant und sanft mit einem ehrlichen, naturalistischen Schauspiel. Und dann singt die Frau, die als Hauptdarstellerin so viele Lobeshymnen eingefahren hat. Von der Rolle ihres Lebens ist da die Rede. Selbstverständlich wünsche ich Nicole Scherzinger noch viele Optionen zu glänzen, aber dass was sie auf der Bühne des Savoy Theaters abfeuert ist Weltklasse. Da sitzt nicht nur jeder Ton, nein ihr Schauspiel ist ebenso stark. Ihre Norma ist unglaublich sinnlich und sexy, desillusioniert und geistesgegenwärtig zugleich. Sie beobachtet und wägt ab. She hovered like a hawk. Wobei sie eher wie ein Puma in Gefangenschaft um ihre Beute vorsichtig schleicht und ihre Krallen ausfährt. Wie ein Puma ist ihre Norma ein Einzelgänger und territorial. Sie markiert ihr Revier, um Rivalen aufzulauern und ihre Anwesenheit zu signalisieren. Scherzingers „With One Look“ hat mir buchstäblich den Atem geraubt und ich habe vor Staunen meinen Mund nicht mehr zubekommen. Man könnte meinen Scherzinger sänge um ihr Leben. Was für eine Performance! Nach ihrer Interpretation und ihrem „I’ve come home at last“ während „As If We Never Said Goodbye“ im zweiten Akt, erntet sie zurecht Standing Ovations. Brava!
Eine Entdeckung ist Grace Hodgett Young in ihrem West End Debüt als Betty Schaeffer. Betty wirkt in Jamie Lloyds Version wesentlich aufgeklärter, feministischer und emanzipierter als frühere Auslegungen der Rolle. Mit starker Stimme ist sie ein idealer Counterpart zu Tom Francis als Joe. David Thaxton kann als Max von Mayerling alle Register seines warmen Baritons bedienen und schafft mühelos eine wahre Flut an Gänsehautmomenten. Das Lichtdesign von Jack Knowles gehört zu den besten und stärksten, die jemals in einem Theater zu erleben waren und schafft damit unverwechselbare filom noir Momente. Bemerkenswert punktiert wird in der Inszenierung von Lloyd eine ausgefeilte live Videoprojektion (Design: Nathan Amzi und Joe Ransom) eingesetzt, die alles in den Schatten stellt, was man bisher gesehen hat. Besonders eindrucksvoll gelingt der Beginn des zweiten Aktes, der Backstage in der Garderobe von Tom Francis beginnt und durch die Kamera festgehalten wird. Als er dann das Titellied singt, streift er dabei auch durch die Umkleidezimmer seiner Costars (inklusive einer Nicole Scherzinger, die mit Lippenstift „mad about the boy“ an ihren Garderobenspiegel schreibt) hinaus auf den Strand im West End, und vor das Savoy Hotel und Savoy Theater, mit den letzten Tönen erreicht Francis dann centre stage und wird doch einen frenetischen, berechtigt euphorischen Applaus den Publikums begleitet.


Jamie Lloyd hat mit seiner Inszenierung das Stück komplett neu erfunden, er hat die schwarz weiß Optik des Original Billy Wilder Films adäquat eingefangen und genial auf die Bühne übertragen. Dabei hat er auch einige Kürzungen vorgenommen. So entfallen die beiden Songs „The Lady’s Paying“ und „Eternal Youth Is Worth A Little Suffering“ in seiner Version. Dazu gibt es hier und da ein paar behutsame Änderungen in den Lyrics von Don Black und Christopher Hampton. Lloyds Stil schwankt zwischen Thomas Ostermeier und Ivo van Hove, ist brutal und zärtlich, peitschend und sanft, irritierend und eindrücklich.
Die Inszenierung und Neuerfindung von „Sunset Boulevard“ von Jamie Lloyd ist herausfordernd, provokativ, meisterhaft und setzt damit neue Maßstäbe für die Interpretation klassischer Musical Werke. Es ist eine Regiearbeit, über die ganz London und die Musicalwelt zurecht reden und diskutieren. Sie ist ein orgastischer Hochgenuss über den ich jetzt und zukünftig sagen kann: „Ja, bei diesem musikalischen Ereignis war ich tatsächlich dabei … und es war magisch!“
Review: TITANIC
Theater Erfurt

von Marcel Eckerlein-Konrath
1985 wurde das Wrack der RMS Titanic etwa 370 Meilen (600 km) südsüdöstlich vor der Küste Neufundlands in einer Tiefe von rund 12.500 Fuß im Atlantik entdeckt. Für den Komponisten Maury Yeston war dies der Auslöser, sich intensiver mit dem Schicksal der Titanic auseinanderzusetzen. Yeston, der mit Musicals wie Nine und Grand Hotel vor allem Kritiker begeisterte, entschied sich für eine klassisch inspirierte Herangehensweise an die Musik seines Stücks.
„Ich wusste, dass ich eine ähnliche Klangfarbe finden musste wie bei den großen Komponisten jener Zeit – etwa Elgar oder Vaughan Williams. Für mich war das eine Gelegenheit, ein Element der symphonischen Tradition ins Musiktheater zu bringen, das wir vorher in dieser Form nicht hatten. Das war sehr aufregend“, so Yeston über seinen kompositorischen Ansatz.
Das Musical wurde für fünf Tony Awards nominiert – und gewann sie alle, darunter auch die Auszeichnungen für das beste Musical und die beste Originalkomposition. Mit insgesamt 804 Vorstellungen konnte sich die Produktion am Broadway beachtlich behaupten.
Nach zahlreichen internationalen Produktionen entschied sich das Theater Erfurt, Titanic für die Spielzeit 2023/24 auf den Spielplan zu setzen – ein ambitioniertes und mutiges Vorhaben. Was Erfurt hier auf die Bühne bringt, ist beeindruckend – nicht nur aufgrund der Größe des Ensembles. Neben einem starken Cast, der überwiegend aus Gästen besteht, überzeugt insbesondere der gewaltige Opernchor (Choreinstudierung: Markus Baisch) in der klugen und detailreichen Inszenierung von Stephan Witzlinger.
Schon mit den ersten Tönen der Ouvertüre wird klar: Der eigentliche Star des Abends ist das philharmonische Orchester unter der exquisiten Leitung von Clemens Fieguth. Die Entscheidung, die Musiker sichtbar auf der Bühne zu platzieren – als integralen Bestandteil des Schiffs – ist ein Geniestreich. Das Orchester wird so nicht nur musikalisch, sondern auch szenisch zum Herzstück der Produktion und fügt sich elegant in das Bühnenbild von Lena Scheerer ein.
Scheerer gelingt es mit wenigen, aber wirkungsvollen Mitteln, den Luxusdampfer zum Leben zu erwecken. Besonders im letzten Akt, beim dramatischen Untergang der Titanic, entfaltet ihre Ausstattung eine beeindruckende Wucht. Hier entstehen große Theatermomente, die im Gedächtnis bleiben und noch lange nachwirken.

Titanic legt den Fokus vor allem auf historische Figuren wie Kapitän Smith, souverän gespielt von Martin Sommerlatte, und Schiffskonstrukteur Thomas Andrews (eindringlich: Dennis Weissert). Da ist zum Beispiel der hoffnungsvolle, naive Heizer Frederic Barrett, überzeugend verkörpert von Daniel Eckert, und die junge Kate McGowan (gut: Johanna Spanzel), die ihr Glück in Amerika finden will.
Auch wenn Autor Peter Stone bemüht ist, die Vielfalt der Menschen an Bord und ihre unterschiedlichen Hintergründe sichtbar zu machen, wirkt die Handlung stellenweise zu episodenhaft. Vor allem einige Dialoge (in der deutschen Übersetzung von Wolfgang Adenberg) klingen mitunter hölzern und konstruiert.
Das Musical verfolgt die Ereignisse vor, während und nach dem Untergang der Titanic – in Sachen Emotionalität gelingt das mal mehr, mal weniger überzeugend. Zu bruchstückhaft werden die Geschichten der Charaktere aus den drei sozialen Klassen – darunter Passagiere, Crewmitglieder und Offiziere – präsentiert. Zwar liegt der Fokus auf den individuellen Lebenswegen, Hoffnungen und Träumen, doch die Tiefe bleibt oft an der Oberfläche hängen.
Ein Beispiel: Das Ehepaar Beane reist als Passagiere der dritten Klasse. Alice, großartig gespielt und gesungen von Katja Bildt, träumt davon, zur ersten Klasse zu gehören, und klammert sich an diese Illusion mit kindlicher Inbrunst. Ihr Ehemann Edgar hingegen, wenig überzeugend und merkwürdig deplatziert von Benjamin Ebeling dargestellt, versucht sie immer wieder zurück in die Realität zu holen – als gehöre er eigentlich in ein anderes Stück.

Als Passagiere der ersten Klasse beeindrucken Kerstin Ibald und Martin Berger als Isidor und Ida Straus: Ihre Darstellung ist herzzerreißend rührend, ihr Duett „Wie vor aller Zeit“ zählt zu den emotionalen Höhepunkten der Inszenierung – still, anrührend und nachhaltig bewegend.
Mit „Titanic“ gelingt Regisseur Stephan Witzlinger und seinem glänzenden Team eine beeindruckende Gesamtleistung (Choreografie: Kerstin Ried), wäre da nicht ein ganz unwesentlich wichtiger Faktor für ein Musical, der hier etwas unangenehm aufstößt: die Musik. Die Komposition von Yeston bewegt sich häufig zwischen Oper und Symphonie und ist zwar durchaus schöpferisch wertvoll, mitunter aber schwer antizipierbar. Mit Ausnahme der Eröffnungsnummer, die beeindruckend inszenatorisch und musikalisch gelingt, gibt es kaum Songs die ins Ohr gehen. Yeston versucht mit seiner Musik emotionale Resonanz zu erzeugen, verliert sich aber zu häufig darin. Die Idee mit seiner Komposition die Handlung voranzutreiben und die Erzählung zu unterstützen, gelingt ihm oft nur grobflächig, denn zu sperrig und verklausuliert geraten die teilweise atonalen Melodien. Intervallsprünge und unkonventionelle Klangfarben gestalten es häufig schwierig seiner Musik zu folgen, wirken schon beinahe avantgardistisch und erinnern an Werke von Arnold Schönberg oder Alban Berg.
Sehenswert ist das Stück am Theater Erfurt aber allemal und das liegt vor allem an der fantastischen Symbiose aus Orchester, Regie, Bühne, Licht (Florian Hahn) und Ensemble. Diese Titanic ist definitiv nicht dem Untergang geweiht.

Review: SOMETHING ROTTEN!
English Theatre Frankfurt

von Marcel Eckerlein-Konrath
„What the hell are musicals?! „It appears to be a play where the dialogue stops and the plot is conveyed through song.“ Klingt doch nach einer vortrefflichen Idee. Gut seien wir ehrlich, Menschen die sich gegenseitig ansingen, in musikalische Monologe abdriften oder eine Eleven o‘ clock belten, sind vollkommen unrealistische Utopien. Gleichzeitig sind Musicals nicht nur ein Garant für volle Häuser, sondern machen viel Spaß, berühren und entführen in andere Welten. Wir befinden uns bei „Something Rotten!“ in der Renaissance „with poets, painters, and bon vivants and merry minstrels who strolled the streets of London.“ Es ist die Zeit von Dürer und Michelangelo, Dante Alighieris Göttlicher Komödie, der Venus von Botticelli und der Blütezeit von William Shakespeare.
Welcome to the Renaissance!
So spielt die die Handlung von Something Rotten! im London des 16. Jahrhunderts und dreht sich um die zwei rivalisierenden Brüder, Nick und Nigel Bottom, die versuchen, endlich einen Hit für das Theater zu schreiben. Dabei geraten sie in Konkurrenz mit dem Rockstar-ähnlichen Shakespeare (Matt Beveridge), der im Stückeschreiben wesentlich erfolgreicher ist als die beiden Brüder. Wobei sich Shakespeare teilweise etwas unorthodoxer Methoden bedient um an sein Ziel zu kommen. In ihrer Verzweiflung wenden sie sich an einen Wahrsager, der ihnen prophezeit, dass die Zukunft des Theaters im Musical liegt. Dies bringt sie auf die Idee, das allererste Musical zu schreiben.

Mit Something Rotten! sicherte sich das English Theatre Frankfurt, die deutsche Uraufführung in des für 10 Tony Awards nominierten Musicals aus der Feder der Brüder Karey und Wayne Kirkpatrick. Was das großartig auftrumpfende Ensemble unter der Regie von Ewan Jones in der deutschen Premiere der Show auf die Bühne (Set und Kostüme: Stewart J. Charlesworth) zaubert ist eine wunderbare, herrlich absurd alberne Farce. Auch wenn das Buch von John O’Farrell und Karey Kirkpatrick stark überzeichnet ist und die Gagdichte gut funktioniert, werden die Charakter nie der Lächerlichkeit preisgegeben und sind mehr als bloße funktionierende Schablonen. Greg Miller Burns ist als Nick mit einem guten Gespür für comic timing gesegnet, singt fantastisch und stattet seine Figur aber mit ebenso viel Tiefe wie Herz aus. Als sein Bruder Nigel steht ihm mit Sami Kedar ein ebenbürtiger Partner zur Seite, der genussvoll sämtliche Nuancen auf seiner künstlerischen Partitur spielt. Mit dem waschechten Showstopper „It’s A Musical“ gelingt Tom Watson als Nostradamus eine echte tour-de-force performance. In dem Song, in dem sämtliche Musicals von Les Miserables, Rent, Chicago, The Music Man, Seussical, South Pacific, Evita, Annie über Guys & Dolls, A Chorus Line, Sweet Charity, Hello Dolly, Cats und Sweeney Todd rezitiert werden, gehört zu den vielen Highlights des Abends. Hier stimmt einfach alles und insbesondere für Musical Liebhaber*innen ist sowohl der Song, wie auch die gesamte Show ein süffisant, nerdiges Vergnügen. Die Kirkpatrick Brüder spielen dabei mit gängigen Klischees (Wait, so an actor is saying his lines and then, out of nowhere, he just starts singing?) und hinterfragen dabei scharf: It’s absurd. Who on Earth is going to sit there while an actor breaks into song? What possible thought could the audience think other than ‚this is horribly wrong‘? Dabei ist die Herangehensweise der Autoren und Komponisten immer liebevoll überspitzt und dabei beißend witzig. Auch aktuelle Bezüge werden immer wieder augenzwinkernd eingeflochten. Selbstverständlich wird das Patriarchat dabei konsequent auf die Schippe genommen. Hierarchische Geschlechterstrukturen werden grandios ad absurdum geführt, wenn Nigels Frau Bea (großartig und stimmstark: Rachael Archer) ihrem Gatten offeriert Think of me as your sidekick, helping you whenever I can. I’m more than just a woman. When the pressure’s coming, let me be your right-hand man. Als Running gag taucht Bea dann immer wieder in männlichen Rollen auf, da sie beweisen will, dass Frauen ohne Frage fähig sind, Männerjobs auszuführen. Bea, eine klare Anspielung auf die scharfzüngige und emanzipierte Beatrice in Much Ado About Nothing reiht sich in die Namen vieler Protagonist*innen ein, die aus Shakespeare Stücken adaptiert wurden. So verliebt sich Nigel in die, von Briana Kelly quirlig gespielte Portia (The Merchant of Venice) Jonathan Norman ist als Investor Shylock (The Merchant of Venice) zu sehen und der Nachname der Brüder Button bezieht sich ohne Zweifel auf eine der denkwürdigsten Figuren Shakespeares in A Midsummer Night’s Dream. Die Parallelen zum Shakespeare Gesamtwerk werden immer wieder humorvoll eingewoben und garantieren für einen genussvoll amüsanten Abend (Bottom’s Gonna Be on Top).


Mit viel Charme und Drive schafft es Regisseur Ewan Jones, der auch gleichzeitig für die Choreografie verantwortlich zeichnet das Maximum aus seinem Ensemble herauszuholen. Dazu eigenen sich die Kompositionen (Musical Director: Mal Hall) auch hervorragend, denn die bieten alles was ein gutes Musical baucht: echte Showstopper (It’s A Musical und Welcome to the Renaissance), dramatisch anmutende Balladen (I Love The Way) und steppende Ensemblenummern (We See The Light). What could be more amazing than a musical? With song and dance and sweet romance.
Aber noch einmal zurück zum multitalentierten Ensemble, denn die müssen an dieser Stelle alle unbedingt und ausdrücklich namentlich genannt werden: Bradley Adams, Bethany Amber-Wilde, William Beckerleg, Estelle Denison-French, Liam Huband, Jonathan Norman, Chris Tarsey und Myles Waby leisten großartiges. Oft bleiben ihnen nur wenige, hauchdünne Sekunden für Kostümwechsel, dabei spielen und singen alle mit solcher Passion, Hingabe und Präsenz ihre unterschiedlichen und zahlreichen Rollen, dass es eine wahre Freude ist, diese überschäumende Spielfreude mitverfolgen zu dürfen.
Dem English Theatre gelingt mit Something Rotten! ein waschechter Hit, von dem man sich erhofft, das er zukünftig den Weg auf viele weitere deutsche Bühnen finden wird. Take it from me they’ll be flocking to see your star-lit, won’t quit big hit, musical und das wünscht man dem English Theatre für die Weitsicht dieses Stück endlich nach Deutschland zu bringen, von Herzen.

Review: THE PRODUCERS
Musikalische Komödie Leipzig

von Marcel Eckerlein-Konrath
Broadway Flops gehören zum Great White Way In New York ebenso dazu, wie die gigantischen Erfolge. Nur sind Flops Szenarien, die jeder Broadway und Musical Produzent tunlichst vermeiden möchte. Eine Horror Nouvelle von Stephen King als abendfüllendes Musical? Gute Idee? Dass dachten sich zumindest die damaligen Produzenten, mussten jedoch nach dem Horror der auf der Bühne stattfand, gleichzeitig mit den horrenden, vernichtenden Kritiken umgehen und das Stück musste nach nur 5 Vorstellungen schließen. 8 Millionen Dollar waren so auf einmal komplett in den Sand gesetzt und „Carrie“ ging als einer der größten Flops in die Broadway Geschichte ein. Jedoch, könnte man damit nicht sogar mehr Profit machen als mit einem Erfolg? Der Ansicht sind zumindest Max Bialystock, ein windiger, aber zuletzt glückloser Theaterproduzent und sein neurotisch-verklemmter Buchhalter Leo Bloom. Sie haben den scheinbar perfekten Plan. Sie wollen die schlechteste Show aller Zeiten auf die Bühne bringen und einen vorprogrammierten Flop landen. Mit dem schauderhaften Machwerk „Frühling für Hitler“, verfasst von Franz Liebkind, einem vertrottelten Altnazi, glauben sie, das schlechteste Stück aller Zeiten gefunden zu haben. Als Regisseur engagieren sie den aufgeblasenen, aber gänzlich unbegabten Roger de Bris und sein offensichtlich talentloses Team.

Bialystock und Bloom sind siegessicher – das wird die unmöglichste Show, die der Broadway je gesehen hat, so unerträglich peinlich und geschmacklos, dass die Zuschauer noch vor dem letzten Vorhang das Theater verlassen werden. Zu einer zweiten Vorstellung soll es gar nicht erst kommen. Doch die beiden Produzenten haben die Rechnung ohne das Publikum gemacht: Ihre Show wird als geniale Farce verstanden und gerät zu einem gefeierten Hit. Damit stehen Bialystock und Bloom vor handfesten Problemen…
„The Producers“ aus der Feder von Comedy Titan Mel Brooks ist bereits selbst längst Broadway Legende geworden. Das Stück gewann stolze 12 Tony Awards und lief über 2.500 Vorstellungen. Die Melodien gehen direkt ins Ohr und reihen Ohrwurm an Ohrwurm. „The King Of Broadway“, „I Wanna Be A Producer“, „Keep It Gay“ oder „Springtime For Hitler“ sind nur einige von Brooks denkwürdigen Kreationen. Das Musical kam damals zur rechten Zeit, war die Uraufführung doch im 9/11 Jahr, in der das Publikum nach dieser fürchterlichen Tragödie nach leichter Unterhaltung gierte. Den Kopf abzuschalten und kurzerhand alles um einen herum zu vergessen, gelingt in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden nur bedingt. In einer kriegsgeprägten Ära, in der eine rechtsradikale, homophobe Partei Höchststimmen erzielt und in der braunes Gedankengut verbreitet wird, hält die Inszenierung von Dominik Wilgenbus an der Musikalischen Komödie Leipzig den Finger in die Wunde. Das gelingt dem Regisseur allerdings vortrefflich. Auch wenn sicher der ein oder andere Gag etwas plakativ und überstrapaziert wirkt, ist seine Interpretation von Brooks Show erstaunlich aktuell und erschreckend zeitkritisch. Dass bei allen aktuellen, politischen Eskalationen die Stimmung nicht kippt, ist Wilgenbus sehr zu Gute zu erhalten. Er findet eine gute Balance aus hemmungsloser, alberner Komik und sozialkritischen Tönen. Auf dieser Partitur spielt sein glänzend auftrumpfendes Ensemble fast durchgehend hervorragend. Nur hier und da sind ein paar Dissonanzen zu vernehmen.
Nick Körber kann als Leo Bloom leider nicht überzeugen. Er hatte vor der Premiere das obligatorische break a leg / Hals und Beinbruch etwas zu wörtlich genommen und seinen großen Zeh gebrochen. In den Tanzszenen wird er so kongenial mit geschmeidiger Leichtigkeit von Tänzer Pietro Pelleri vertreten. Auch wenn es Körber anzurechnen ist, dass er das Showbusiness Mantra „the Show must go on“ sehr ernst nimmt, kann er schauspielerisch wie gesanglich der Figur des Leo nicht genügend Überzeugung einhauchen. Seine Panikattacken im Stück sind wenig glaubhaft, sein Spiel zu forciert und unglaubwürdig. Besonders im direkten vergleich zu seinem Bühnenpartner Patrick Rohbeck fällt er deutlich ab.

Als Max Bialystock ist Rohbeck nämlich all dass, was die Rolle des schleimigen, nach Erfolg gierenden Produzenten ausmacht: schauspielerisch auf den Punkt, mit einem guten Gespür für Komik, gepaart mit einer solider Stimme. Besonders seine Nummer „Verrat“ im zweiten Akt, gehört zu seinen glänzenden Highlights. Rohbeck ist eine Idealbesetzung als Max. Echtes Broadway Feeling bringt Olivia Delauré als Ulla auf die Leipziger Bühne. Als Triple Threat kann sie gesanglich, schauspielerisch und vor allem tänzerisch überzeugen. In der Choreo von Mirko Mahr (Step-Choreographie Illia Bukharov) gibt Delauré buchstäblich alles und landet mit ihrer herrlich schwedisch säuselnden Interpretation der Ulla einen absoluten Volltreffer. Franz Liebkind wird von Michael Raschle zwar als hohler, aber auch gefährlicher Alt Nazi dargestellt. Mit seinen Auftritten hat er alle Lacher auf seiner Seite und hat dazu mit seinen Tauben noch eine mit sehr „speziellem“ Namen im Verschlag beherbergt. Dem larger than life Regisseur Roger deBris gibt Andreas Rainer Gesicht und Stimme. Zwischen Slapstick, gnadenloser Komik und guten gesanglichen Qualitäten ist Rainer als Hitler eine echte Wucht und löst beim Premierenpublikum wahre Beifallsstürme aus. Darf man über Hitler lachen? Die Antwort ist eindeutig: auf jeden Fall, wenn er so großartig überspitzt, zum Brüllen komisch und knallhart der Lächerlichkeit preisgegeben wird, wie hier. Jeffery Krueger ist eine herrliche doppelzüngige Carmen Ghia und erstaunliche nahe an Originalübersetzung Roger Bart. Angela Mehling lässt als Grabsch-mich-tatsch-mich keine Wünsche übrig und begeistert gleich in mehreren Rollen. Jedoch wirkt der Chor der Musikalischen Komödie etwas hölzern und kann es hier nicht ganz mit einem Musicalensemble aufnehmen. So sind einige Interaktionen nicht immer poliert pointiert und lassen etwas Agilität vermissen.Das Bühnenbild von Peter Engel ist doch etwas sehr karg und rudimentär geraten. Das Büro von Max sieht eher aus wie eine Spelunke in Harlem und Roger de Bris hat lediglich ein Sofa in Kussform zur Verfügung. Auch wenn das dem vergnüglichen Abend keinen Abbruch verschafft, hätte man hier oder da doch etwas phantasievoll ausladender arbeiten dürfen und monetär investieren können. Die Kostüme von Uschi Haug sind stückdeckend passend designt und interpretiert und können vor allem bei der Nummer „Frühling für Hitler“ visuell imponieren.
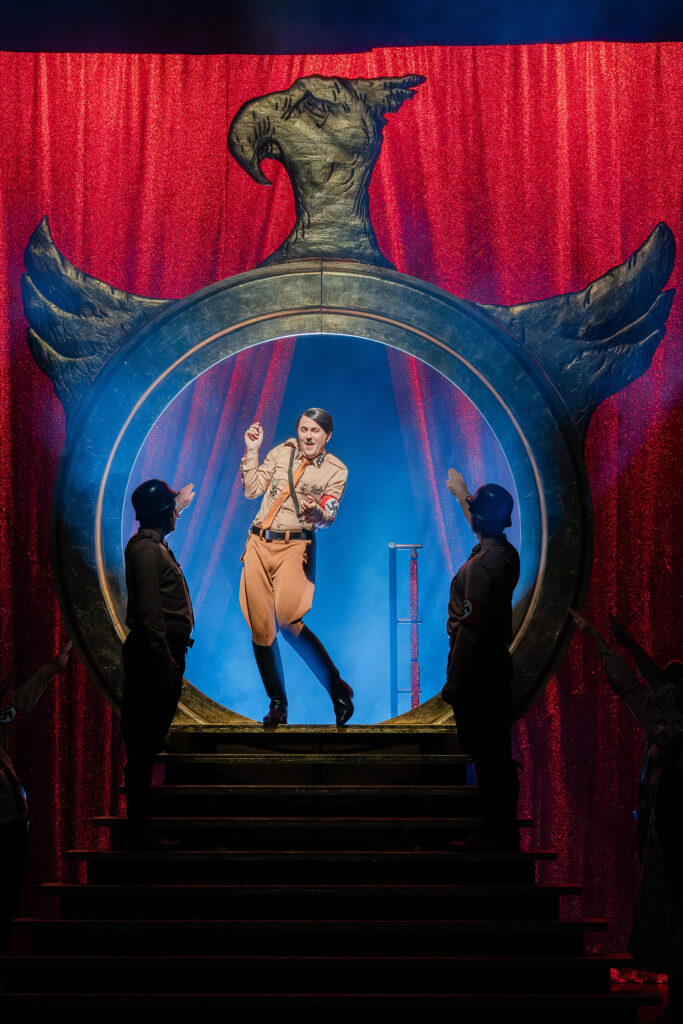
Unter der musikalischen Leitung von Michael Nündel könnte das Orchester der Musikalischen Komödie manchmal etwas mehr Drive und Tempo vertragen, sorgt aber für einen souveränen Gesamteindruck. Regisseur Dominik Wilgenbus macht mit seinen klugen politischen Einfällen vieles richtig, manchmal fehlt es allerdings an Timing und Drive. Einige Anschlüsse wirken etwas behäbig und schleppend. Die deutsche Übersetzung von Nina Schneider funktioniert gut, auch wenn natürlich einige Originalwitze unübersetzbar sind, macht Schneider einen sehr guten Job. „The Producers“ ist in Leipzig ein überaus gelungener Abend mit marginalen Abstrichen, der vor allem wegen dem viel zu selten gespielten Stück lohnt. Leipzig zeigt hier wieder einmal den Mut, auch selten gespielten Shows eine Chance zu geben.
Max und Leo hätte es sicher nicht gefreut, aber diese Show ist ein Hit!
Review: TOOTSIE
Staatstheater am Gärtnerplatz, München

von Marcel Eckerlein-Konrath
Ein neues Musical zur Uraufführung zu bringen, ist wie Kinder bekommen: nicht jeder sollte eins haben sagt Bettina Mönch in der Rolle der Julie im Musical Tootsie. Wenn das stimmt, dann sind die Eltern im vorliegenden Fallbeispiel äußerst zufriedene, denn dieses Kind erfreut sich bester Gesundheit und Agilität. Tootsie kann als Musical in der europäischen Uraufführung am Theater am Gärtnerplatz überzeugen. Die Geschichte von Michael Dorsey, der als Schauspieler keine Anstellung findet und kurzerhand in Frauenkleider schlüpft, um als Dorothy Michaels Karriere zu machen, wurde von Sidney Pollack 1982 erfolgreich mit Dustin Hoffman und Jessica Lange verfilmt. Hoffman wurde für einen Oscar nominiert und Lange bekam ihren erster Oscar als beste Nebendarstellerin. Gut 45 Jahre später gelang am Broadway der Musicaladaption ein Achtungserfolg, die Auszeichnung mit 2 Tony Awards und eine Show, die seitdem erfolgreich durch die Staaten tourt. Einiges grundliegendes hat sich seit den 80ern (zum Glück) geändert und so entstand ein neues Buch von Robert Horn und damit eine zeitgemäße, genderfluid Adaption des Stoffes. Auch wenn Tootsie als Film nichts von seinem Charme eingebüßt hat und Dustin Hoffman ein sehr sensibles, fernab von Hollywood Klischees geprägtes, sehr differenziertes Portrait liefert, ist der Film doch etwas in die Jahre gekommen und teilweise nicht gut gealtert.

Dass in der Inszenierung von Regie- und Musical Veteran Gil Mehmert, alles frisch, mitunter aber auch eine gewisse Antiquiertheit spürbar ist, macht vielleicht auch den Reiz der Produktion aus. Es gibt sehr viel zu lachen und viele schöne Ideen, die Mehmert phantasievoll umsetzt und geschickt einflechtet. Ein Highlight ist dabei eine entworfene Utopie in der Dorothy der Star gleich mehrerer weiblicher Musicalrollen in diversen Produktionen ist. Es ist also ein äußerst stimmiges Gesamtpaket was das Theater am Gärtnerplatz auf die Bretter schickt. Die einzige Frage die sich mir stellt, ist tatsächlich nur, ob das Stück als Schauspiel nicht noch besser funktioniert hätte? Die Songs sind alle ok bis gut, aber eine richtig zündende musikalische Nummer gibt es nicht und ein Ohrwurm, mit dem man das Theater verlässt bleibt leider aus. Es gibt die obligatorischen Betroffenheit- und Erkenntnissongs, gepaart mit repetitiven Ensembletracks und Pattern-Nummern, doch nichts davon bleibt dauerhaft und klingt zu austauschbar. Auf meine persönliche Musical Spotify Liste, würde ich keine der Songs hinzufügen. Komponist David Yazebeck bedient sich hier stellenweise etwas bei seinem Musical Dirty Rotten Scoundrels, doch da gab es mehr Nummern die nachhaltig überzeugen konnten. Bezeichnenderweise gewann „Tootsie“ zwar einen Tony Award für das beste Buch, ging aber im Musikapartment komplett leer aus. Eine in vielerlei Hinsicht nachvollziehbare Entscheidung. Tatsächlich hatte ich sogar eher die Songs Tootsie und It Might BeYou von Stephen Bishop aus dem Film im Kopf. Dass das Musical dennoch so hervorragend funktioniert, ist vor allem der grandiosen Besetzung und dem guten Buch zu verdanken.
Allen voran Armin Kahl als Michael / Dorothy der so gut wie durchgängig auf der Bühne ist und rasant überzeugend in den Geschlechterrollen wechselt. Das beherrscht Kahl auf großartige Weise mit viel Charme, Fleiß und Esprit. Als Ekel Regisseur mit Wedelesken Locken brilliert Alexander Franzen, während Julia Sturzlbaum als Sandy zum heimlichen Publikumsliebling avanciert. Gunnar Frietsch gibt herrlich nonchalant und deftig den Mitbewohner Jeff, während Dagmar Hellberg als kodderschnauzige Produzentin Rita alle Register zieht. Bettina Mönch ist als Julie wieder einmal sehr wandlungsfähig, charmant und berührend in ihrer Interpretation. Dabei gibt sie auch stimmgewaltig Einblicke in das Seelenleben einer Schauspielerin und welchen Kampf Frauen im Showbusiness immer noch dem Patriarchat ausgesetzt sind. Im Film wird Dorothy in einer Telenovlea als neue Hauptrolle besetzt, in der Bühnenadaption spielt sie die Amme in einer Fortsetzung von Romeo und Julia. Was im Film so hervorragend funktioniert und von Dustin Hoffman so exzellent gespielt wird, überträgt sich auf die Bühne zwar auch noch sehr amüsant, ist aber nicht ganz so zum Schreien witzig und grotesk wie im Film. Der alternde, lüsterne Soap Opera Schauspieler John Van Horn, wurde für die Bühne mit dem (fast) talentfreien Reality Star Max van Horn (stimmgewaltig: Daniel Gutmann) ausgetauscht, was gut funktioniert. So wird Dorothy auch als etwas ältere Schauspielerin von einem jüngeren Kollegen begehrt und verehrt: eine willkommene Loslösung von bestehenden Klischees und Vorurteilen. Die Musicaladaption bietet etwas, was mitunter Mangelware auf deutschen Stadttheaterbühnen ist: eine exzellente Inszenierung und die Möglichkeit für gut zwei Stunden den eigenen Alltag komplett auszublenden. So kann Tootsie mit marginalen Abstrichen überzeugen und ist ein Musical mit viel Witz, einem großen Herzen und guter Laune Garantie. Go Tootsie. Go!

Review: ROCK OF AGES (Tour)
Meistersingerhalle Nürnberg

von Marcel Eckerlein-Konrath
We’re not gonna take it / No, we ain’t gonna take it / We’re not gonna take it anymore / We’ve got the right to choose, and / There ain’t no way we’ll lose it / This is our life, this is our song / We’ll fight the powers that be, just / Don’t pick on our destiny, cause / You don’t know us, you don’t belong.
Dieser Song könnte exemplarisch für den übersättigten Markt und übermäßigen Konsum der Compilation Musicals stehen. Hinter diesem Begriff verbergen sich Musicals, die aus einer Zusammenstellung oder einer Auswahl verschiedener Songs bestehen, basierend meistens aus bereits vorhandenen Musikstücken bekannter Künstler*innen oder Bands. Von richtig gut (& Juliet), über mäßig (Mamma Mia) bis katastrophal (Bat auf Of Hell) reicht hier die Palette. Mit Rock Of Ages kommt nun eins dieser Compilation Musicals auf Tour nach Deutschland, welches den Fokus auf die Musik der 80er und den Classic Rock legt. Dass die Musik zeitlos ist und nach wie vor Spaß macht steht für jeden außer Frage, und auch wenn die Songs überzeugen, so kann es dieses Musical bedauerlicherweise nicht. Allein dieses Wrack als Musical zu bezeichnen entbehrt jeder Logik und kommt einer Blasphemie gleich.
Mit der wohl belanglostesten Story, den unwitzigsten Dialogen und schlechtesten Klischees schafft Rock Of Ages es mühelos den Inhalt einer Telenovela oder der Gebrauchsanweisung gegen Vomitus zu unterbieten. Die Dialoge sind uninspirierte, unterirdisch schlechte Versuche den Hauch einer Handlung rund um die Songs der 80er zu stricken. Das was als Hommage gedacht ist gerät zu einer frivolen Demütigung. Die „Geschichte“ von Rock of Ages spielt in Los Angeles und dreht sich um das Schicksal des Rock’n’Roll Clubs „The Bourbon Room“. Dort treffen verschiedene Charaktere aufeinander, darunter der aufstrebende Rockstar Drew und die angehende Schauspielerin Sherrie. Die beiden verlieben sich ineinander und versuchen, ihre Träume in der Musikindustrie zu verwirklichen. So weit so uninteressant. Die Autoren probieren aus diesem dürftigen Konstrukt eine, ihrer Meinung nach, Parodie des Sujet Musicals zu basteln. Eine Parodie lässt sich allerdings für mich nicht erkennen, es ist eher ein Faustschlag ins Gesicht und eine Beleidigung für jeden der Musicals liebt oder auch nur ansatzweise mag.
Die „Gags“ bedienen sich sämtlicher Klischees, machen sich lustig über Homosexualität, sind rassistisch und chauvinistisch. Deswegen klage ich getreu dem Song von Twisted Sister an und rufe frei heraus: We’re not gonna take it anymore! Schluss damit aus jedem Auffahrunfall ein Musical zu zimmern. Liebe Autor*innen, wenn ihr nichts zu erzählen habt dann lasst es doch bitte direkt bleiben und verschwendet nicht die kostbare Zeit, das Geld und die Geduld eures Publikums. Denn schon dr große Anton Tschechow wusste: An der miserablen Qualität unserer Theater ist nicht das Publikum schuld. Wer diese Gags lustig findet, lacht wahrscheinlich auch über Verstopfungen und hält Richterin Barbara Salesch für intellektuelle Fernsehkunst. Ich habe schon Besuche beim Zahnarzt erlebt die lustiger waren und würde mich freiwillig einer Wurzelbehandlung unterziehen als mir Rock Of Ages noch einmal anschauen zu müssen. Nicht dass wir uns falsch verstehen. Ich finde es auch toll mich auf leicht bekömmliche Unterhaltung einzulassen und abzuschalten, ich möchte als Zuschauer allerdings nicht an der Nase herumgeführt werden. Von den Darstellern ist einzig die großartige Amanda Whitford zu nennen, die stimmlich so richtig rocken und punkten kann und die der einzige Lichtblick dieser traurigen Produktion bleibt. Kevin Thiel spielt als Lonny so sehr auf Witz, dass es schon fast körperliche Schmerzen auslöst. Wenn er unumwunden zugibt diese Show sei keine Andrew Lloyd Sondheim Show ist das ein kläglicher Versuch einen Hauch von Ironie in dieses Opus des Grauens zu hauchen. Und irgendwo auf einer Wolke sitzt Sondheim und vergießt bittere Tränen für diesen Affront. Die fünfköpfige Live Band versucht ihr Bestes aus den Songs das maximale heraus zu kitzeln, ist aber leider aufgrund des dürftigen Sounddesigns häufig übersteuert und übertönt die Darsteller weitestgehend.


Rock-Hymnen der 80er, wie Here I Go Again von Whitesnake, The Final Countdown von Europe, Can’t Fight This Feeling von Reo Speedwagon, I Want To Know What Love Is von Foreigner sind einige der Songs die Nostalgie heraufbeschwören sollen, es aber nicht so richtig transportieren können. Richtig gut klingt das tatsächlich dann, wenn das gesamte Ensemble gemeinsam singt. Einige der Songs wie z.B. We Built This City werden allerdings nur als Rezitative verwendet und erklingen leider nicht in voller Länge. Dies ist insofern enttäuschend, dass selbst die Songs so verstümmelt werden um sie der nicht vorhandenen Handlung zum Fraß vorzuwerfen. Felix Freund als Drew schreit sich unangenehm durch die Show, während Julia Tschler als Sherrie mit einigen Tönen meilenweit daneben liegt. Die Sparte Schauspiel scheint bei der lieblosen Inszenierung von Alex Balga und Natalie Holtom, überhaupt keine Rolle zu spielen und ist damit non-existent und ausgeklammert. Das was die Akteure bieten kommt über das Niveau „Amateurtheatergruppe“ nie hinaus. Die Bühne ist statisch und verändert sich im Laufe des Abends nur marginal. Dies ist allerdings auch von keiner großer Bedeutung, da Rock Of Ages auch mit einem aufwändigeren Bühnenbild nicht an Tiefe und Substanz gewönnen hätte. Wer hier seine Erfüllung findet, dem sei es gegönnt und ist mit diesem Autocrash einer Show bestens bedient. Für alle anderen die meinen We’re not gonna take it anymore sei hier eine 80er Jahre Party oder ein Konzert Tribute ans Herz gelegt. Oh, you’re so condescending / Your call is never ending / We don’t want nothin‘, not a thing from you / Your life is trite and jaded / Boring and confiscated /If that’s your best, your best won’t do.
Review: SCHOLL – DIE KNOSPE DER WEISSEN ROSE
Stadttheater Fürth
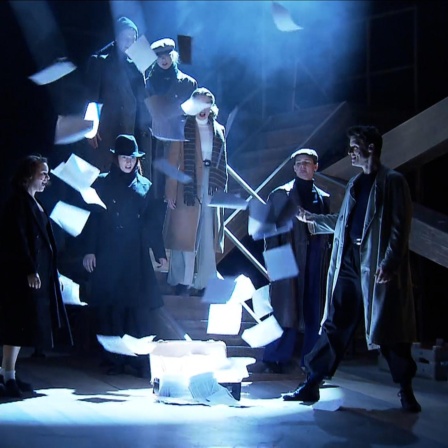

von Marcel Eckerlein-Konrath
Die Geschichte rund um die Geschwister Sophie und Hans Scholl ist eine tragische und wurde bereits in Opern, Theaterstücken und Filmen erfolgreich adaptiert. „Die weiße Rose“ war die Widerstandsgruppe in der die Geschwister mit anderen jungen Student*innen aktiv waren und die sich gegen die nationalsozialistische Regierung und ihre Ideologie des Rassismus und Antisemitismus wandten. Sophie und Hans Scholl spielten eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Flugblättern und anderen Materialien, die den Nationalsozialismus und den Krieg kritisierten. Sie wurden im Februar 1943 von der Gestapo verhaftet, nachdem sie Flugblätter an der Universität von München verteilt hatten. Sophie und Hans wurden zum Tode verurteilt und am 22. Februar 1943 hingerichtet. In dem Musical von Thomas Borchert und Titus Hoffmann wird nun die Geschichte vor dem Zusammenschluss der weißen Rose beleuchtet, der titelgebenden Knospe, dem Ursprung der Bewegung. Tirol, 1941/42: Die Geschwister Hans, Sophie und Inge Scholl verbringen zusammen mit ihren Freund*innen Traute, Ulla und Freddy den Jahreswechsel in der einsam gelegenen Coburger Hütte in den Tiroler Bergen. Politisch und weltanschaulich sind diese jungen Erwachsenen sehr unterschiedlich – sie eint aber ein breites literarisches Interesse und das Bedürfnis nach einer Auszeit von Reichsarbeitsdienst und Fronteinsatz im nationalsozialistischen Kriegsdeutschland. Sie vertreiben sich die Zeit mit Skifahren und lesen gemeinsam (politisch verbotene) Werke der Weltliteratur. Inge hat – wie immer – alles im Griff, Sophie freut sich auf ihr bevorstehendes Studium, und Traute hofft auf eine Wiederbelebung ihrer Sommerromanze mit Hans. Im letzten Moment zu Hause geblieben ist Hans‘ Freund und Vertrauter Shurik. Was Hans nicht daran hindert, in seinen Gedanken und in Erinnerung in ständigem Zwiegespräch mit Shurik zu stehen. Denn die Notwendigkeit politisch und privat zu seinen Überzeugungen zu stehen, beschäftigt Hans sehr. Denn da gibt es eine versteckte Seite seiner Persönlichkeit, die so gar nicht recht zu dem Wehrmachtssoldaten und Frauenschwarm passen will, den die anderen so gut kennen …
Ein sehr sensibles Thema also, dem sich das Kreativ Team in dieser Uraufführung auf behutsame Art und Weise nähert. Die jugendliche Naivität der Freund*innen kollidiert mit dem Hass und der Ignoranz des Nationalsozialismus in der klaustrophobischen Enge der Skihütte, die hier kongenial von Stephan Prattes schwebenden Holzbalken konstruiert wird. Wie ein Damoklesschwert schweben die Holzbalken über den Protagonist*innen und deuten bereits offensiv, teils versteckt ein Hakenkreuz und drohendes Unheil an: die Katastrophe naht. Doch das gut durchdachte Bühnenbild ist Segen und Fluch zugleich, denn durch das immer gleichbleibende Setting wirkt die Handlung oft sehr statisch und steril.
Bewegung gibt es zwar in Form der Choreografie von Andrea Danae Kingston (und im Song „Am Sonntag kommt zum Kaffeeklatsch..“) doch über die gut 2.5 Stunden ändert sich wenig am Bühnenbild. Das Stück wäre in seinem Kammerspiel und Sensibilität in einem intimeren Rahmen sicherlich besser aufgehoben, als auf der großen Bühne des Stadttheaters Fürth. So wird es schier unmöglich eine mentale, affektive Bindung mit den Figuren herzustellen.

Musikalisch gelingt Thomas Borchert in seinem Debüt als Musical Komponist nicht immer der Spagat zwischen Pop, Schlager und Kitsch. Borchert versucht sondheimesk Referenzen an den amerikanischen Komponisten einzustreuen, doch wirken die Melodien oft zu austauschbar und generisch. Es gibt wenig Titel die ins Ohr gehen und hängen bleiben. Ausnahme bildet hier „Das Leben ist anderswo“ das von Aufbau und Struktur an Sincerley, Me aus „Dear Evan Hansen“ erinnert und sich mehrere Male innerhalb des Abends wiederholt. Anrührend gelingen die Balladen „Diese Worte bleiben“ und „Schweigen“ jeweils mit den Original Texten von Hans Scholl. Für die restlichen Songs steuert Titus Hoffmann die Texte bei, der auch die Regie übernahm. Die als Hymne angelegte Nummer „Widerstand“ wirkt streckenweise unangenehm atonal. „Gemeinsam“ hingegen könnte problemlos im Schlagerradio laufen. Und „Entartet“ bemüht sich krampfhaft, an den Stil von „Hamilton“ anzuknüpfen – scheitert dabei aber auf ganzer Linie.
Die Besetzung ist durchweg erstklassig und die Darsteller*innen bilden ein homogenes Ensemble, aus dem vor allen Sandra Leitner (mit einer frappierenden Ähnlichkeit zu ihrem historischen Vorbild) als Sophie Scholl und Judith Caspari als Traute herausstehen. Leitner überzeugt stimmlich beim anspruchsvollen „Gott ist fern“ und ist auch schauspielerisch großartig, während Caspari mit „Der Doppelgänger“ punkten und auftrumpfen kann.
Warum gelingt es der Show trotzdem nicht, emotional wirklich zu berühren? An der exzellenten Besetzung liegt es nicht – im Gegenteil: Alle holen aus dem vorhandenen Material, was nur geht. Alexander Auler überzeugt als Hans mit viel Empathie und beeindruckender Stimme. Dennis Hupka bringt als naiver, aber liebenswerter Freddy charmanten Witz ins Spiel, und Fin Holzwart setzt mit „Propaganda“ zu Beginn des zweiten Aktes ein starkes Solo, das entfernt an „Kitsch“ aus Elisabeth erinnert. Eine echte Entdeckung ist Karolin Kohnert, deren intensive Inge nachhaltig im Gedächtnis bleibt. Und auch Lina Gerlitz liefert als Ulla eine durchweg überzeugende Leistung.

Der Zuschauer wird über weite Strecken mit einer wahren Flut an Informationen, Fakten und historischen Details konfrontiert – und dabei weitgehend allein gelassen. Genau hier liegt das zentrale Problem. Man fühlt sich oft weniger als Teil eines emotionalen Erlebnisses, sondern eher wie ein Schüler im Leistungskurs Geschichte, der mit erhobenem Zeigefinger belehrt wird. Mehrfach wird betont, dass „Die weiße Rose“ lediglich die Überschrift der ersten vier Flugblätter war – nicht der eigentliche Name der Gruppe. Solche Wiederholungen wirken eher belehrend als erhellend. Zu oft verliert man als Zuschauer*in den Anschluss: Zu viele Zeitsprünge, Traumsequenzen und Vorgriffe auf zukünftige Ereignisse erschweren das Verständnis und vernebeln den Blick auf das Wesentliche. Ohne Vorkenntnisse der historischen Hintergründe wird es zunehmend schwierig, der Handlung durchgängig zu folgen. Besonders die Rückblenden zu Hans und seinem Freund Shurik geraten unnötig verworren – und auch die angedeutete, aber nie wirklich entwickelte homosexuelle Spannung zwischen beiden bleibt seltsam blass und spannungslos. Es fehlt an dramaturgischer Klarheit und an einem feinen Händchen für Struktur, was sich letztlich auch im überlangen und stellenweise schleppenden Erzähltempo niederschlägt. Und doch gelingt dem Regisseur Titus Hoffmann an einigen Stellen Überraschendes. Einzelne Inszenierungsideen sind durchaus originell, aber sie können die dramaturgischen Schwächen des Stücks als Ganzes nicht auffangen. Das Musical bleibt fragmentarisch – wie eine Skizze, der es an Reife und Tiefe mangelt.
„Scholl – Die Knospe der weißen Rose“ hat ein starkes Ensemble, das engagiert und eindrucksvoll agiert. Aber der zündende Funke fehlt – ebenso wie die innere Kraft, aus dieser Knospe tatsächlich eine Blüte entstehen zu lassen.
Review: ROMEO UND JULIA
Theater des Westens, Berlin

von Marcel Eckerlein-Konrath
Das Theater des Westens ist zweifellos eine der bedeutendsten Bühnen der Hauptstadt – ein Haus, das gleichermaßen für große Namen wie Maria Callas und für generationsprägende Musicals steht. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1896 hat es unzählige künstlerische Spuren hinterlassen. Wer diesen Saal betritt, betritt ein Stück lebendige Theatergeschichte: Callas sang hier unter Karajan, Helmut Baumann brachte in den 1980ern „La Cage aux Folles“ mit durchschlagendem Erfolg auf die Bühne. Später folgten Großproduktionen wie „Chicago“, „Tanz der Vampire“ oder „Die drei Musketiere“. Der Ort hat Atmosphäre – ein Prunkbau, der Charme ausstrahlt und dessen Wände Geschichten zu erzählen scheinen. Wer das Theater betritt, spürt sofort, dass hier nicht bloß Shows stattfinden, sondern echte Theaterkunst gepflegt wird.
In diese ehrwürdige Kulisse zieht nun ein neues Stück ein: „Romeo und Julia – Liebe ist alles“ von Peter Plate und Ulf Sommer. Nach dem Erfolg von „Ku’damm 56“ kehren die beiden mit einer Uraufführung zurück. Eine neue Musicalversion von Shakespeares berühmtester Tragödie – das ist eine Ansage. Zumal das Thema bereits so oft variiert, übersetzt, verfilmt und weitergedacht wurde, dass man sich zwangsläufig fragt: Muss das wirklich noch einmal sein? Die Antwort lautet überraschenderweise: ja. Und das aus gutem Grund. In der Regie von Christoph Drewitz entsteht ein knapp dreistündiger Abend, der sich mutig auf einen spannenden Kontrast einlässt: Plate und Sommer lassen die berühmte Schlegel-Übersetzung der Shakespeare-Dialoge im Originalton stehen – elegant, klassisch, poetisch –, während die musikalische Ebene poppig-modern daherkommt. Diese Reibung zwischen Sprachwelten erzeugt Reiz und Energie. Es ist ein gelungener Balanceakt zwischen historischer Würde und popkulturellem Zeitgeist.
Die Songs fügen sich erstaunlich gut in die Handlung ein. Titel wie „Wir sind Verona“, „Es lebe der Tod“ oder „Es tut mir leid“ bleiben im Ohr – manche mit der Wucht von Popsongs, andere mit stiller Emotionalität. Mit „Liebe ist alles“ erklingt sogar ein Rosenstolz-Hit, der überraschend gut in die Dramaturgie integriert ist. „Halt dich an die Reichen“ wiederum wirkt wie ein augenzwinkernder Kommentar zur Gesellschaft und trägt deutlich die Handschrift früher Rosenstolz-Stücke.
Das junge Ensemble bringt frischen Wind auf die Bühne, auch wenn nicht alle durchgängig schauspielerisch überzeugen können. Die gesangliche Leistung ist solide bis stark, aber in den Dialogen fehlt es mancherorts an Tiefe und Natürlichkeit. Besonders im zweiten Akt, der stark textbasiert ist, wünscht man sich manchmal mehr Feinarbeit und emotionale Nuancen. Dennoch: Das Ensemble trägt den Abend mit Energie, Spielfreude und einem hohen Maß an Engagement.
Yasmina Hempel und Paul Csitkovics verkörpern das titelgebende Liebespaar glaubwürdig – auch wenn gesanglich nicht jede Passage ganz homogen gelingt. Was fehlt, ist stellenweise eine stärkere individuelle Auseinandersetzung mit ihren Figuren und mehr psychologische Klarheit. Umso stärker sind einige Nebenrollen: Joël Zupan als Todesengel ist ein echter Coup – mit seiner Countertenor-Stimme verleiht er der Figur eine fast übernatürliche Präsenz. Nico Went als Mercutio bringt Sensibilität in eine Rolle, die schnell zur Karikatur verkommen kann. Seine Nummer „Kopf sei still“ ist eindringlich und stark. Philipp Nowicki als Pater Lorenzo überzeugt mit warmer Bühnenpräsenz und klarer Stimme – besonders in „Kein Wort tut so weh wie vorbei“ und dem fast sakralen „Mutter Natur“. Steffi Irmen liefert mit der Amme eine mitreißende, manchmal berührende, manchmal urkomische Performance und wird mit „Will nicht mehr jung sein“ zum Publikumsliebling. Linda Rietdorff als Lady Capulet gibt den perfekt abgestimmten Kontrast: überdreht, selbstbezogen und brillant in ihrer Oberflächlichkeit. Das Bühnenbild bleibt bewusst zurückhaltend, setzt aber gezielt Akzente – etwa mit dem klassischen Balkon, der hier fast zum Symbol gerinnt. Besonders hervorzuheben ist die Choreografie von Jonathan Huor, die mit Präzision, Eleganz und Ausdruckskraft beeindruckt. Seine Handschrift hebt die Inszenierung auf ein deutlich höheres Niveau.


Tim Deilings Lichtdesign ergänzt das Bild wirkungsvoll – atmosphärisch, sinnlich, punktgenau. Der Epilog „Der Krieg ist aus“ rundet den Abend emotional aufgeladen ab und wartet mit einem effektvollen Schlussmoment auf, der nicht nur dramaturgisch clever, sondern auch atmosphärisch tief berührend ist.
Christoph Drewitz gelingt mit dieser Inszenierung etwas Seltenes: Er schafft eine Brücke zwischen Shakespeare und Pop, zwischen Tradition und Gegenwart, zwischen Kunst und Unterhaltung. „Romeo und Julia – Liebe ist alles“ ist keine bloße Neuerzählung, sondern eine eigenständige Interpretation für das Musiktheater von heute. Dass dabei Anklänge an Musicals wie „Hamilton“, „Spring Awakening“ oder „Elisabeth“ spürbar sind, macht den Abend umso interessanter.
Es ist zu hoffen, dass diese Produktion im Theater des Westens nicht nur das junge Publikum begeistert, sondern auch den Weg für weitere musikalische Experimente dieser Art bereitet. Denn: Wer Shakespeare mit Popmusik kombiniert, braucht Mut, Stilgefühl und – wie in diesem Fall – ein gutes Gespür für Timing.
Und das ist allen Beteiligten gelungen.
Review: EIN AMERIKANER IN PARIS, Tour
Stadttheater Fürth

von Marcel Eckerlein-Konrath
„An was denken Sie, wenn Sie an Paris denken?“ fragt Loïc Damien Schlentz in der Rolle des Adam Hochberg und adressiert dabei direkt das Publikum, noch bevor ein Ton des Krzysztof Klima Festival Orchester, Krakau erklingt. Mit dem Durchbrechen der vierten Wand kommen natürlich die obligatorischen, zu erwartenden Antworten: Eiffelturm und Champs Elysees. Dabei ist Paris soviel mehr als eine Reduzierung auf seine Sehenswürdigkeiten und L’amour. Ich selber habe einige Zeit in der französischen Hauptstadt gelebt und geliebt. Und meine Erinnerungen an die Metropole an der Seine sind durchweg positiv, wenn auch das verklärte, romantisierende Bild der Stadt sich nicht ganz bestätigt je länger man dort wohnt. Allerdings habe ich Paris auch so richtig erst während der Pandemie kennengelernt. Da waren die Möglichkeiten sich in einem größeren Radius zu bewegen extrem marginal und äußerst eingeschränkt.
Aber Paris ist eben auch ein Lebensgefühl: wunderschön, atemberaubend, beklemmend und einschüchternd zugleich. Das Essen ist so großartig wie alle Welt schwärmt, die Sprache melodisch aber voller gemeiner Stolperfallen und wenn die Stadt im Frühling erblüht und erstrahlt ist sie noch wundervoller, attraktiver und einladender denn je. Paris ist Baguette, Confit de canard und Pain au chocolat, Paris ist Marais, Père Lachaise, Parc des Buttes-Chaumont und die Opéra Garnier. Magnolien die sich im Wind bewegen und „wenn Du das Glück hattest […] in Paris zu leben, dann bleibt die Stadt bei Dir, einerlei wohin Du in Deinen Leben noch gehen wirst, denn Paris ist ein Fest fürs Leben.“ wusste schon Ernest Hemingway und ja, er hat vollkommen recht. Ich denke immer gerne an Paris, den Charme und Esprit und die einzigartige Architektur der Stadt zurück. Paris ist eben auch ein Gefühl. Umso enttäuschender ist es, dass bei der Inszenierung von Christopher Tölle sich dieses Gefühl so gar nicht manifestiert.
„Ein Amerikaner in Paris“ spielt im Jahr 1945, wo der angehende amerikanische Maler Jerry dem Charme der Pariserin Lise erliegt. Doch Jerry ist nicht ihr einziger Verehrer. Es gibt da noch den Revuestar Henry Baurel, dem sich Lise verpflichtet fühlt. Für zusätzliche Verwicklungen sorgen Jerrys Freunde, der Komponist Adam Cook, und die ebenso attraktive wie reiche Milo Roberts, eine Amerikanerin mit einem Faible für Künstler. Soweit, so unspektakulär die Handlung wären nicht die wundervollen Melodien von George Gershwin. Die Songs wurden leider ins deutsche übertragen, was der Übersetzung von Kevin Schröder etwas arg schlagerhaftes verleiht.
Das Bühnenbild (Robert Pflanz) der Tournee Produktion besteht im wesentlich aus einer Leinwand, auf die Animationen projiziert werden. Dies sind teilweise sehr verpixelt und von unzureichender Qualität. Immer wieder wird der Eiffelturm in allen nur denkbaren Perspektiven gezeigt, von der Ferne, von unten, von der Seite, von oben. Stellenweise erinnern die Projektionen etwas (mit ganz viel Phantasie) an die Poster von Jules Cheret. Es ist aber eine vertane Chance, dass, wenn man schon auf Projektionen zurückgreift, nicht die Möglichkeit nutzt und den Protagonisten selber „sein“ Paris malen lässt. In fast jeder Szene in der er auftaucht, wird erwähnt wie begabt und talentiert Jerry Mulligan als Maler ist. Bis auf eine kurze Skizze sehen wir allerdings als Zuschauer nichts, was sehr bedauerlich ist. Wenn er doch so toll malen kann, warum dies nicht auch zeigen als nur behaupten? Die Idee die Szenen wie eine Art Filmsequenz im Hintergrund zu zeigen, geht nur teilweise auf, weil dies nie zu Ende gedacht wird und die Inszenierung hindurch nicht konsequent verfolgt wird. Als Jerry ist Andrew Chadwick ein passabler Tänzer und Schauspieler, aber leider mit keiner großen Stimme gesegnet. Sein Zusammenspiel mit Mariana Hidemi als Lise hat keinerlei Chemie und das Liebespaar nehme ich den beiden zu keiner Sekunde ab. Zu haptisch und mechanisch ist ihre Beziehung, zu leidenschaftslos der Tanz.

Hidemi ist als Lise überall und nirgendwo. Dafür, dass sie eine der Hauptprotagonistinnen ist, macht sie sich recht rar, was natürlich am Original Buch von Craig Lucas liegt. Loïc Damien Schlentz (Adam Hochberg), Tilmann von Blomberg (Henri Baurel) bleiben stimmlich etwas flach und schauspielerisch sehr ausbaufähig. Lichtpunkt ist Kira Primke als Milo Davenport, die aus ihren wenig substanziellen Szenen das Beste macht. Mit guter Stimme und starker Präsenz gehört sie zu den Highlights des Abends. Es gibt storybedingt sehr viele Szenenwechsel, die vom Ensemble oft tänzerisch charmant gelöst und erledigt werden. In der Choreografie von Christopher Tölle und Nigel Watson haben die Tänzer*innen viel zu tun, denn hier wird, wie schon wie im Original Film, ein großes Hauptaugenmerk auf die Bewegung gelegt. „Ein Amerikaner in Paris“ ist eher als Ballett zu verstehen, mit mehr tänzerischen Etüden als Musical Songs. Auch wenn die bekannten Gershwin Hits „I Got Rhythm“, „The Man I Love“, „’S Wonderful“, „They Can’t Take That Away From Me” mit dabei sind, ist der Tanz hier extrem dominierend. So mag auch das Stück nicht jeden Geschmack treffen und daher auch wenig mit dem Sujet Musical gemein haben. Das französische Flair kann diese Inszenierung leider nicht elaborat transportieren. Ein paar Bistrotische oder Beret reichen da nicht aus. Damit schöpft Regisseur Tölle das volle Potential des Stückes nicht aus und versprüht damit nicht mehr als ein laues Sommerlüftchen. Die französische Kultur und Paris insbesondere sind aber noch so viel mehr. Oder wie die Amerikanerin und Autorin MJ Rose schrieb: „Paris riecht nicht nur süß, sondern melancholisch und neugierig, manchmal traurig, aber immer verführerisch. Sie ist eine Stadt für alle Sinne, für Künstler und Autoren und Musiker und Träumer, für Fantasien, lange Spaziergänge, guten Wein, für Verliebte und Geheimnisse.“
Review: CABARET
Theater Dortmund

von Marcel Eckerlein-Konrath
Es gibt Zeiten, da sitze ich vor einer Rezension und muss in Ermangelung an Quellen erfinderisch werden und tief in die Recherche eintauchen. Dies kann sich auf englischsprachige Texte beziehen, auf eigene Erinnerungen selbst besuchter Vorstellungen oder externe Fach Literatur spezialisieren. Bei einem Musical wie „Cabaret“ ist dies nicht erforderlich. Es gibt soviel Material zum Lesen, anhören und ansehen das einem schwindelig wird. Wo also beginnen? „Let’s start at the very beginning, a very good way to start.“ Ok … das ist nicht aus „Cabaret“, sondern aus „The Sound Of Music“, passt aber in diesem Fall besonders gut.
Meine erste Erfahrung mit „Cabaret“ hatte ich noch vor dem Film mit Liza Minnelli. Denn wie es für einen Theaterliebhaber wie mich vorbestimmt war, fand die erste Berührung und Begegnung mit „Cabaret“ im Theater statt. Michael Wedekind inszenierte das Stück in Aachen mit Ursula Vincent als Sally und Karl Walter Sprungala als Conférencier. Eine Inszenierung die mich in meiner Haltung und Zuneigung zu „Cabaret“ stark geprägt hat und an der sich zwangsläufig jede weitere Produktion messen musste. Auch wenn es schon einige Jahre zurückliegt, sind meine Erinnerungen an diese Produktion immer noch sehr präsent.
Mir und jedem anderen im Publikum stockte damals der Atem als der Conférencier in der finalen Szene und seiner Reprise von „Willkommen“ mit „Auf Wiedersehen“ und seinem letzten Goodbye in die Gaskammer eines namentlich nicht genannten Konzentrationslager sich für immer verabschiedete. Hier lag nicht nur die große Brisanz, sondern auch die Genialität und Kraft von Wedekinds Inszenierung.
Gerade diese Entscheidung polarisierte, aber genau das muss Theater und auch die Sektion Musical sollte dies nicht ausklammern. Auch wenn Musical manchmal leider immer noch als die leichte Muse belächelt wird.
Doch „Cabaret“ ist so viel mehr als reine Unterhaltung und die großartigen Melodien von John Kander. Es ist nicht nur eine Zeitreise in das Berlin der späten 20er Jahren, sondern eine treffsichere Charakterstudie und zeitgleich eine tiefgründige, zeitgeschichtliche Retrospektive. Vor allem ist „Cabaret“ zutiefst menschlich und emotional vor dem Hintergrund der politischen Instabilität und des sozialen Wandels der Weimarer Republik.
Musical Veteran Gil Mehmert inszeniert „Cabaret“ nun, nach dem Erfolg an der Wiener Volksoper, für die Oper Dortmund. Angesiedelt im Berliner Kit Kat Club folgt das Stück der Beziehung zwischen dem amerikanischen Schriftsteller Cliff Bradshaw (Jörn-Felix Alt) und der britischen Sängerin Sally Bowles (Bettina Mönch).
Während die beiden versuchen, ihre Beziehung aufrechtzuerhalten, verschärft sich die politische Situation in Deutschland und die Nationalsozialisten beginnen, ihre Kontrolle zu festigen. Der Club und seine Künstler*innen werden zunehmend bedroht und diskriminiert wie auch der Conférencier des Kit Kat Clubs (Rob Petzer). Er ist eine schillernde Figur, diabolisch, sarkastisch und der Master of Ceremonies. Auch die Pensionswirtin Fräulein Schneider (Angelika Milster) und ihr Freund und Nachbar Herr Schultz (Tom Zahner) werden zu Opfern ihrer Zeit.
Obwohl „Cabaret“ in der Vergangenheit eher auf kleineren Bühnen Einzug fand und vom Konzept auch ideal in ein kleines Clubtheater passt, inszeniert Gil Mehmert das Musical nun episch für die große Bühne. Hier kann er opulent und dekadent zeigen und alles aufgefahren was eine aufwendige Inszenierung ausmacht. Die Drehbühne wird hier äußerst effektiv zum Einsatz gebracht und bietet einen Blick in den KitKat Club während auf der Rückseite intime Einblicke in die Pension von Fräulein Schneider preisgegeben werden. Heike Meixner hat hier großartiges geleistet mit ihrem Design. Das gigantisch anmutende Klavier, auf dem der Conférencier die Partitur des Lebens spielt, ist dabei effektiv wie genial erdacht. So bietet die Bühne eine überdimensionale Spielwiese für die Protagonisten. Und was für eine!
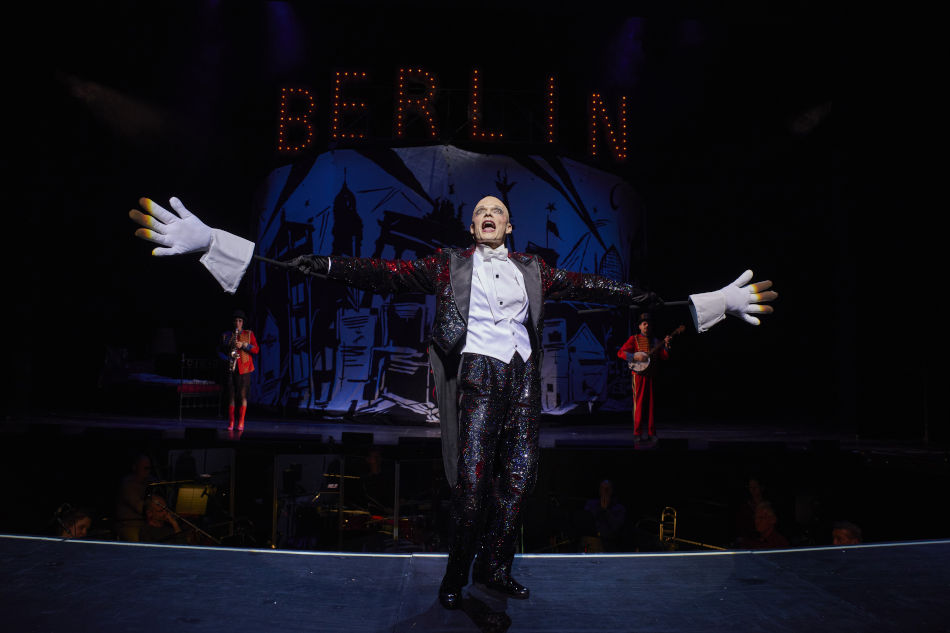
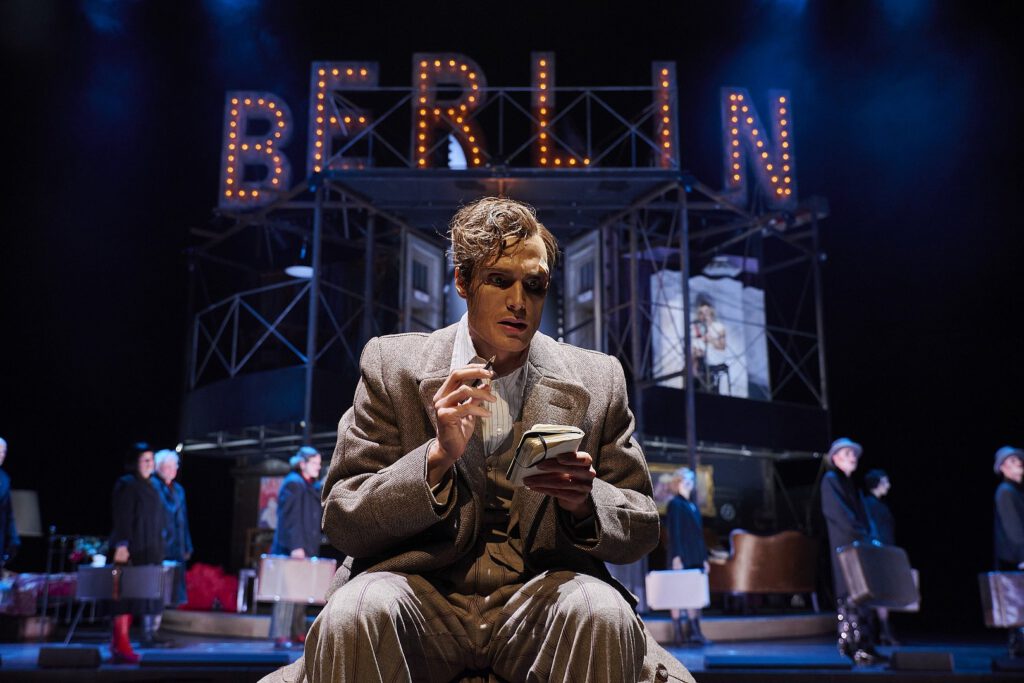
Jörn-Felix Alt ist ein extrem starker Cliff. Er ist emotional und zart, dann wieder leidenschaftlich und zurücknehmend. Selten habe ich einen so guten Schauspieler wie Sänger in dieser Rolle gesehen. Eine rundherum großartige Leistung. Bettina Mönch stattet ihre Sally mit einer großen Belt Stimme aus und ihre Hit Songs „Cabaret“ und „Maybe This Time“ sitzen und sorgen daher zu Recht für fulminante Beifallsstürme des Publikums. Ihre Sally liebt und lebt bedingungslos, ist manipulativ, verrucht und herzzerreißend. Der Conférencier von Rob Pelzer führt nicht nur zynisch und provokant durch den Inhalt des Stückes, er ist zu dem lakonischen Begleiter, Beobachter und zeitgleich ein Provokateur sexueller und politischer Anspielungen. Zudem setzt Mehmert ihn auch immer wieder in anderen Momenten des Abends ein. So fungiert er mal als Kontrolleur, mal als Taxifahrer. Er ist zudem ein Symbol für den moralischen Verfall der Gesellschaft und auch die zunehmende Gewalt und Radikalität. Pelzer ist facettenreich, herrlich ironisch, singt und spielt grandios und wickelt so das Publikum sofort um den kleinen Finger. „Do you feel good?“ Doch bei der Replik bleibt einem schnell die Antwort im Halse stecken. Pelzer fungiert in seiner Rolle als Beobachter und Kommentator. Gleichzeitig ist er Teil der Geschichte, fungiert als Verbindungselement zwischen den Szenen und zwischen den Welten. Er durchbricht damit die vierte Wand und spricht das Publikum direkt an. Pelzer gibt seiner Figur ein bedrohliches und berechnendes Kalkül, das ihn unnahbar und zeitgleich sehr zugänglich macht. Sein Charakter bleibt distanziert in seinem Kosmos und ist unberechenbar in seiner Dynamik. Eine exzellente Leistung!
Sehr berührend und wunderbar fein inszeniert ist das Kammerspiel von Angelika Milster und Tom Zahner als verliebtes Paar, welches sich leider früher als später der Realität stellen muss. Wie die beiden Schauspieler dies herausarbeiten und so einfühlsam, echt und empathisch darstellen ist ein großer Gewinn für die Produktion und so avancieren die beiden zu den heimlichen Stars des Abends. Milster singt, nicht anders als zu erwarten, hervorragend und Tom Zahner rührt mit seiner nuancierten, intelligenten Darstellung zu Tränen. Überzeugend Samuel Türksoy als schleimiger Ernst Ludwig und wunderbar polternd und berlinernd die Fräulein Kost von Maja Dickmann. In der fulminanten Choreografie von Melissa King tanzen die Kit Kat Boys und Girls („each and everyone a virgin“) virtuos. Die Kostüme von Falk Bauer unterstreichen dazu perfekt die 20er Jahre in Berlin.
Die Songs von Kander und Ebb sind, hier unter dem kraftvollen Dirigat von Damian Omansen, neben den bekannten Hits, kritisch und politisch motiviert. „If You Could See Her With My Eyes“ sticht dabei besonders hervor. Eisige Gänsehaut gibt es zum Finale des ersten Aktes mit „Der morgige Tag ist mein“. Hier wird die Stimmungsmache der Nationalsozialisten besonders schmerzlich deutlich. Mehmert inszeniert dies als einen überdeutlichen, eindringlichen Fingerzeig und Weckruf. Leider ist dieser Teil aktueller denn je.

Als Jens Schmidl „Cabaret“ am Theater Freiburg inszenierte gelang ihm ein ganz spezieller Coup: der Regisseur platzierte vor Beginn jeder Vorstellung Mitglieder des Opernchores im Publikum, die während „Der morgige Tag ist mein“ sukzessive aufstanden und den rechten Arm emporstreckten. Das habe einiges an Überzeugungskraft gekostet, verrät Schmidl in einem Telefonat mit mir. Hatten doch die Sänger*innen Angst vor einer möglichen Attacke der Zuschauer. Ich sah die Produktion während meines Studiums und kann mich noch gut daran erinnern wie schockiert, paralysiert und ungläubig ich aus dem Augenwickel sah, wie mein potentieller „Sitznachbar“ sich erhob. Ja, es war Teil der Inszenierung aber ein Moment, so intensiv und eindringlich, dass ich ihn nie vergessen werde. Schmidl hatte damit den Keim des Bösen freigelegt und eindringlich demonstriert, dass Mitläufer und Anhänger rechtsradikaler Gruppierungen mitten unter uns sind. Niemand kann sicher sein.
Musikalisch hat die Show einiges zu bieten. Neben den bekannten Nummern gehen vor allem „Heirat“, „Don’t Tell Mama“ und „Two Ladies“ ins Ohr. Schön das mit „I Don’t Care Much“, eine Nummer die in der Original Broadway Inszenierung 1966 nicht mit dabei war und 1987 zum ersten Mal eingefügt wurde, mit dabei ist und vom Conférencier gesungen wird. Mehmert schafft es, das intime Kammerspiel von „Cabaret“ kongenial auf die große Bühne zu transportieren. „Cabaret“ ist eine Parabel aus Versuchung, Verführung, Hedonismus und politischen Aspekten, die uns sehr deutlich zeigt wieviel Aktualität das Musical immer noch hat. Mit einem stark aufspielenden, erstklassigen Ensemble ist diese „Cabaret“ Inszenierung eine für die Ewigkeit, so „come to the cabaret“.
Review: WEST SIDE STORY (Tour) Capitol Theater Düsseldorf


von Marcel Eckerlein-Konrath
Lonny Price hat eine lange Vergangenheit mit dem Werk von Stephen Sondheim. Angefangen hat für ihn alles nicht als Regisseur, sondern als Schauspieler in der Hal Prince Inszenierung von „Merrily We Roll Along“. Das Musical das rückwärts erzählt wird, wurde bei seiner Uraufführung zum desaströsen Flop, entwickelte im Laufe der Jahre aber eine treue Schar an Bewunderern und wird Ende 2023 mit Jonathan Groff, Daniel Radcliffe und Lindsay Mendez an den Broadway, nach einer ausverkauften off-Broadway Reihe transferiert. Die Entstehungsgeschichte von „Merrily“ ist auch Thematik der äußerst interessanten und sehr sehenswerten Dokumentation „Best Worst Thing That Ever Could Have Happened“, doch um diese soll es an dieser Stelle nicht gehen. Vielmehr zeichnet Price nun verantwortlich für ein Musical, das mit Superlativen der internationalen Presse nicht spart, die Times schrieb: „No.1 Greatest musical of all time“ und zu dem Sondheim die Lyrics beisteuerte. Sondheim war damals 25 Jahre jung, als er mit seiner Arbeit begann und noch ganz am Anfang seiner Karriere.
Zusammen mit dem großen Leonard Bernstein zu arbeiten war für ihn Ehre und Herausforderung zugleich. Sondheim arbeitete lieber allein, während Bernstein den gemeinsamen kreativen Prozess von Komponisten und Texter bevorzugte. Also fanden beide einen ungewöhnlichen Kompromiss: sie kommunizierten über das Telefon. So fand eine der wohl bedeutendsten Arbeiten der amerikanischen Musicalgeschichte auf recht unkonventionelle Art statt. Die Symbiose der beiden Jahrhundert Künstler resultierte in einem Musical, das Geschichte schrieb. Die kürzliche Neuverfilmung durch Oscar Preisträger Steven Spielberg macht deutlich, wieviel Kraft immer noch in der Musik von Bernstein steckt und wie unsterblich diese ist. Umso erstaunlicher ist es, dass in der neuen Inszenierung von Lonny Price die Show merkwürdig kalt und generisch daherkommt. Alles ist zwar makellos getimt, doch die initiale, emotionale Zündung bleibt aus. Woran liegt es also, dass diese „West Side Story“ nur marginal berührt? An dem exzellenten Dirigat von Grant Sturiale liegt es sicher nicht. Mit ganz viel Drive und Gusto führt der Maestro sein Orchester durch die Partitur Bernsteins: Jazz, lateinamerikanische Elemente und auch klassische Oper erfüllen immer noch ihre Bestimmung und zeigen die formvollendete, tiefe Schönheit und satte Qualität der Musik. Songs wie „Something’s Coming“, „Tonight“ und „Somewhere“ haben auch nach über 60 Jahren nichts von ihrer Strahlkraft eingebüßt. Gesungen und gesprochen wird bei der internationalen Tour auf Englisch. Übertitel gibt es zwar keine, dies dürfte aber aufgrund der Bekannt- und Beliebtheit des Stückes wenig problematisch sein. Überhaupt ist eine Aufführung in der Originalsprache in der Oper, bis auf sehr wenige Ausnahmen, Pflicht. Im Musical wird eine Aufführung in der Originalsprache hierzulande allerdings eher selten gezeigt und auf deutsche Übersetzungen zurückgegriffen.

Lose basiert das Musical auf Shakespeares „Romeo & Julia“ und spielt im New York der 1950er Jahre. Im Mittelpunkt der Handlung stehen die zwei rivalisierenden Straßengangs, die „Jets“ (weiße Amerikaner) und die „Sharks“ (Puerto-Ricaner) und natürlich Tony und Maria, die sich unsterblich ineinander verlieben und aus den jeweils revoltierenden Gangs kommen. Und wir alle als Zuschauer wissen: diese Verbindung endet tragisch. Als Tony ist Jadon Webster rein optisch eine Idealbesetzung für Tony. Auch wenn seine Singstimme im konträren Gegensatz zu seiner Sprechstimme steht, kann er gesanglich überzeugen, schauspielerisch aber wenig punkten. Zu aufgesetzt und wenig elaboriert ist sein Spiel, als dass es wirklich emotional berührt. Bei ihm sieht man auch gut den Knackpunkt der Inszenierung und die fehlende, mangelnde emotionale Bindung zu den Protagonisten. Ja man fühlt förmlich die Regieanweisungen von Lonny Price. „Geh jetzt hier hin – dann dort hin und verweile hier.“ Das mag zwar grundsolide sein und auch für einige Rezipienten ausreichen, mir war das allerdings zu wenig und zu statisch und vor allem fehlt das Feuer und essentielle Hingabe. Eine wirkliche Haltung und tiefe Diskrepanz fühlt man bei Websters Tony bedauerlicherweise nicht. Michel Vasquez als Maria ist da schon etwas positiver hervorzuheben. Ihr Sopran ist anrührend schön anzuhören und ihr Schauspiel etwas akzentuierter als das ihres Bühnenpartners. Allerdings fehlt ihr die jugendliche Unbekümmertheit und eine richtige Chemie mit Webster ist eher abstinent als richtig spürbar.
Ein Highlight hingegen, in der ohnehin sehr dankbaren Rolle ist tänzerisch, gesanglich und schauspielerisch Kyra Sorce als Anita. Bei ihr spürt man den Drive, die Passion und Hingabe für ihre Rolle. Ihre Anita ist leidenschaftlich, liebt und hasst bedingungslos. Etwas mehr von dieser Präsenz und Ausdruckskraft hätte der gesamten Produktion gutgetan. Anthony Sanchez bleibt als Bernardo eher blass und unscheinbar – ein Auftritt, der wenig Nachhall erzeugt. Taylor Harley überzeugt als Riff mit einer soliden, rollendeckenden Darstellung. Besonders hervor sticht Anthony J. Gasbarre III als Action: Mit beeindruckender Bühnenpräsenz und spürbarer Leidenschaft füllt er jede seiner Szenen, tänzerisch wie schauspielerisch. Man fragt sich unweigerlich, wie er wohl in der Rolle des Tony gewirkt hätte – das hätte durchaus Potenzial gehabt. Starke Nebenrollenbesetzungen runden das Bild ab: Laura Leo Kelly bringt als Anybodys angenehme Energie auf die Bühne, und auch Christopher Alvarado hinterlässt als Chino einen stimmigen Eindruck.
Tänzerisch bleiben keine Wünsche offen, orientiert sich die Choreo von Julio Monge doch stark an der legendären Original Choreografie von Jerome Robbins. Das bei einer Tourneeproduktion keine Hydraulik und fahrende Bühnenelemente zum Einsatz kommen liegt auf der Hand, doch die teilweise sehr lauten Bühnenumbauten der einzelnen Elemente und Fassaden von Anna Louizos, katapultierte mich als Zuschauer immer mal wieder aus dem Bühnenzauber zurück in die Realität des Theatersaals und meinen Sitz.

Dennoch sind die typischen New Yorker Feuertreppen, die auch maßgeblich im Original Artwork der Produktion zu finden sind, gut umgesetzt und erfüllen funktional ihren Zweck. Auch die Häuser als aufklappbare Puppenhäuser zu nutzen, geht (buchstäblich) auf. Schön und feinfühlig gelingt Price die Traumsequenz zu „Somewhere“: ein starkes Plädoyer für Liebe und eine deutliche, strikte Ablehnung von Rassismus, Homo- und Transphobie und Hass aller Art. Unterm Strich bleibt und bestätigt mit der neuen Inszenierung dieser „West Side Story“ die Erinnerung daran, wie großartig das Musical immer noch ist und wie elementar wichtig Toleranz, Akzeptanz und Empathie für jeden von uns sind.
Der letzte Funke, in dieser Neu-Inszenierung will dann am Ende aber leider nicht überspringen.
