Review: CHICAGO
Komische Oper Berlin


von Marcel Eckerlein-Konrath
Manchmal blitzt es auf in der Theaterlandschaft: Ein Moment, in dem alles stimmt – Timing, Talent, Tanz und Temperament. Barrie Koskys Neuinszenierung des Musicals Chicago ist ein solches Funkeln. Mit über 6.500 Glühlampen im Bühnenbild, das Michael Levine mit ebenso viel Eleganz wie kalkulierter Finesse gestaltet hat, wird nicht nur das Spotlight auf die Protagonist*innen gerichtet, sondern ein elektrisierendes Spektakel entfacht – Broadway-Flair, raffiniert ins Berliner Jetzt transponiert.
Chicago basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von 1926, das von der Journalistin Maurine Dallas Watkins geschrieben wurde – inspiriert von realen Mordprozessen zweier Frauen, die sich in den 1920ern in der amerikanischen Boulevardpresse in glamouröse Antiheldinnen verwandelten. Die Musicalfassung von John Kander (Musik), Fred Ebb (Texte) und Bob Fosse (Regie & Choreografie) wurde 1975 uraufgeführt. Doch der große internationale Durchbruch kam mit dem minimalistischen, düster-raffinierten Broadway-Revival von 1996, das seither ungebrochen gespielt wird.
Unvergessen ist die gefeierte Londoner Produktion von 1997 mit Ute Lemper und Ruthie Henshall – eine Besetzung, die Maßstäbe setzte. Das dazugehörige Cast-Album – eine Studioaufnahme, kein Live-Mitschnitt – ist bis heute ein Referenzwerk. Selten klang ein Cast Album derart lebendig, virtuos und stimmlich präzise und voller vokaler Raffinesse. Henry Goodman als Billy Flynn glänzte darin mit geschmeidiger Arroganz als Meister der subtilen Manipulation.
Koskys Version ist opulenter und größer als die Broadway und West End Revial Inszenierung. Sie ist ein Fest des Überflusses – doch nie plakativ. Er holt das amerikanische Vaudeville auf die Bühne der Komischen Oper, durchdringt es mit Witz, Tempo und einem Gespür für groteske Schönheit. Wie er selbst sagt: „Chicago ist ein Stück über witzige, charmante Monster.“ Genau dieses Wechselspiel zwischen Anziehung und Abscheu macht seine Vision so faszinierend.

Katharine Mehrling als Roxie Hart und Ruth Brauer-Kvam als Velma Kelly erfüllen die Bühne zu jedem Zeitpunkt mit Energie und Präsenz. Beide verwandeln ihre Charaktere in lebendige, pulsierende Wesen, die den Zuschauer mit jeder Geste und jedem Blick fesseln.
Katharine Mehrling, als Roxie Hart, überzeugt nicht nur mit einer bemerkenswerten stimmlichen Vielfalt, sondern auch mit einer unglaublichen Bühnenpräsenz. Sie schafft es, die anfängliche Unschuld und Naivität ihrer Figur zu bewahren, während sie gleichzeitig die immer komplexer werdende Dunkelheit von Roxies Charakter entfaltet. Mehrling spielt mit den vielen Facetten ihrer Figur, die zwischen Manipulation, Charme und eiskalter Berechnung schwankt. Dabei bleibt sie jederzeit glaubwürdig, was die Tragik und den Humor ihrer Roxie verstärkt.
Ruth Brauer-Kvam, als Velma Kelly, bringt ebenfalls eine beeindruckende Vielseitigkeit mit. Ihre Velma ist keine einfache Femme Fatale, sondern eine vielschichtige Frau, die hinter der glamourösen Fassade ihre eigenen Dämonen bekämpft. Brauer-Kvam spielt mit einer Mischung aus Wut, Verletzlichkeit und einer unerschütterlichen Selbstsicherheit, die ihre Figur auf faszinierende Weise ambivalent macht. Besonders bemerkenswert ist die Art, wie sie die chaotische, aber zugleich kontrollierte Energie von Velma auf die Bühne bringt. Ihre Tanz- und Gesangsnummern sind präzise und kraftvoll, wobei ihre Körperbeherrschung und ihr Timing in perfekter Harmonie mit der Choreografie von Otto Pichler steht.
Die Chemie zwischen den beiden Schauspielerinnen ist elektrisierend. Ihre Interaktionen sind ein Balanceakt zwischen Konkurrenz und Kameradschaft, Liebe und Hass – ein Spiel, das von harter Rivalität und gleichzeitiger Bewunderung geprägt ist. Es ist faszinierend zu sehen, wie sie sich im Laufe der Aufführung immer wieder an den Rand des Chaos bewegen, dabei aber nie aus dem Gleichgewicht geraten. Diese explosive Dynamik zwischen Roxie und Velma – zwei Frauen, die sowohl miteinander als auch gegeneinander kämpfen – ist das Herzstück der Inszenierung und zieht das Publikum von Anfang bis Ende in ihren Bann.
Jörn-Felix Alt durchdringt als Billy Flynn mit Perfektion das gesamte Geschehen. Mit markanter Bühnenpräsenz und messerscharfem Schauspiel verkörpert er den schillernden Star-Anwalt als eleganten Marionettenspieler – ein Mann, der stets die Fäden in der Hand hält, während seine Klientinnen ahnungslos an den Strippen tanzen.
Alt spielt Flynn nicht als bloßen Zyniker, sondern als kalkulierenden Verführer, dessen Lächeln nie ganz die Augen erreicht – ein Mann, der das System nicht nur durchschaut, sondern es in jedem Moment zu seinem Vorteil choreografiert. Seine beiden großen Nummern „Ich bin nur für Liebe da“ und Hokuspokus“ serviert er mit perfektem Understatement und sind Showstopper voller Raffinesse und rhythmischer Präzision.
Er bringt das Kunststück fertig, gleichzeitig zu glänzen und zu kontrollieren, zu verführen und zu manipulieren – ein Charmeur mit Skalpell. Kein Laut zu viel, kein Blick zu wenig. Ein souveräner Strippenzieher, der das Ensemble wie ein Varieté-Dompteur durch das Spektakel lenkt. Eins von vielen Highlights der Produktion.

Andreja Schneider verleiht Mama Morton eine wunderbar ironische Autorität und bringt mit warmer Stimme und pointiertem Spiel genau die Ambivalenz dieser Figur auf den Punkt. Das Ensemble von Chicago unter der Choreografie von Otto Pichler ist in seiner Ausführung eine wahre ästhetische Wucht. Es ist ein Hochgenuss für die Augen, ein visuelles Spektakel, das die Sinne auf eine unverwechselbare Weise berauscht. Jeder Schritt, jede Bewegung, jedes noch so kleine Detail ist bis ins Letzte durchdacht und präzise in Szene gesetzt. Pichlers Choreografie fängt die Essenz des Chicago der 1920er Jahre auf brillante Weise ein – das vibrierende, energiegeladene, von Glamour und Verführung durchzogene Chicago, wo jede Bewegung, jeder Tanzschritt gleichzeitig ein Spiel mit Macht, Begierde und Gefahr ist. Und trotz des Vergleichs mit Bob Fosse schafft Pichler es, eine eigene Handschrift zu entwickeln, die Chicago frisch und aufregend wirken lässt, ohne dabei die Wurzeln der klassischen Inszenierung aus den Augen zu verlieren.
Barrie Koskys Inszenierung von Chicago ist eine brillante Mischung aus kluger Regie, visuellem Hedonismus und subtiler Ironie, die das Original von 1975 in eine neue, überhöhte Dimension katapultiert. Koskys Werk lebt von einer lasziven Eleganz, die durch die intelligent eingesetzten Zwischentöne von Ironie besticht. Er versteht es meisterhaft, das Spiel mit den Genres zu nutzen, wobei er einerseits dem klassischen Charme der 1996er Revival-Version huldigt, aber gleichzeitig eine eigene, tiefgründige Handschrift einbringt, die das Stück mit einer bis ins Detail durchdachten Interpretation neu erfindet. Das Stück selbst über Egoismus, Täuschung und die Verwertbarkeit von Verbrechen im Showbusiness, wird unter Koskys Leitung zu einer furiosen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und ihrer Faszination für Skandale, Ruhm und die dunklen Seiten des menschlichen Begehrens.
Am Ende bleibt Chicago in Koskys Inszenierung nicht nur ein Musical über Skandale und Verbrechen im Showbiz – es wird zu einem rauschenden Fest, in dem das Publikum von der Kunst der Verführung in den Bann gezogen wird. Und wenn in dieser Welt von Gier und Egoismus wirklich jede*r nur an sich selbst denkt, dann kann sich das Publikum immerhin glücklich schätzen, an diesem fulminaten Exzess teilhaben zu dürfen.



Review: & JULIA
Operettenhaus Hamburg

von Marcel Eckerlein-Konrath
In Hamburg, wo die Elbe fließt und die Reeperbahn ihren nächtlichen Glanz verströmt, steht das Operettenhaus seit Jahrzehnten für große musikalische Momente. Dieses traditionsreiche Theater, 1986 zur Musicalbühne umgewandelt, hat mit Produktionen wie Cats, Mamma Mia! oder Tanz der Vampire Meilensteine der deutschen Musicalgeschichte gesetzt. Nun beherbergt es ein Stück, das ebenso frech wie tiefgründig, ebenso bunt wie berührend ist: & JULIA – eine popmusikalische Revolution des klassischen Shakespeare-Stoffes.
Was wäre, wenn Julia nicht gestorben wäre? Wenn sie sich nicht in den Tod gestürzt hätte aus jugendlicher Verzweiflung, sondern beschlossen hätte: Das Leben beginnt jetzt erst recht?
Genau diese Frage stellt sich Anne Hathaway – nicht die Schauspielerin, sondern die Ehefrau Shakespeares. In dieser clever gebrochenen Metaebene beginnt die Geschichte von & JULIA: Anne schreibt ihrem Mann das Ende seiner berühmtesten Tragödie kurzerhand um. Ihre Julia lehnt sich gegen das vorgezeichnete Schicksal auf, zieht nach Paris, begegnet neuen Lieben, alten Illusionen und der Frage, wer sie jenseits von Romeo eigentlich ist.
Es ist ein brillanter Kunstgriff: Die klassische Tragödie wird mit popkultureller Selbstermächtigung versetzt, und was entsteht, ist kein bloßes Spektakel, sondern ein subversiv intelligentes, musikalisch mitreißendes Theatererlebnis.
Im Zentrum des Musicals steht das imposante Songbook von Max Martin, dem schwedischen Superproduzenten, der die Popwelt der letzten drei Jahrzehnte geprägt hat wie kaum ein anderer. Ob Britney Spears‘ ...Baby One More Time, Katy Perrys Roar, Céline Dions That’s The Way It Is, Kelly Clarksons Since U Been Gone oder die Backstreet Boys mit I Want It That Way – die Songs sind vertraut, aber ihre Wirkung in diesem neuen erzählerischen Kontext ist überraschend emotional, oft humorvoll und stets klug inszeniert.
Was schnell zur Jukebox-Falle hätte werden können, wird hier zu einem herausragenden Beispiel für musikalisches Storytelling. Die Hits sind nicht bloße Einschübe, sie treiben Handlung und Figurenentwicklung aktiv voran.

Willemijn Verkaik als Anne ist das unbestrittene Kraftzentrum des Abends. Ihre Bühnenpräsenz ist ebenso eindrucksvoll wie ihre stimmliche Ausnahmeklasse. In der Ballade That’s The Way It Is erschafft sie einen Moment purer musikalischer Magie – getragen von technischer Brillanz, tiefer Emotionalität und einer Bühne, die kurz den Atem anhält. Die stehenden Ovationen, die ihr folgen, sind nicht weniger als verdient.
Chiara Fuhrmann in der Rolle der Julia ist eine wunderbare Besetzung: jugendlich-frisch, mit klarem, durchsetzungsfähigem Gesang und großem spielerischen Charme. Sie balanciert mühelos zwischen rebellischem Trotz und innerer Verletzlichkeit – eine moderne Heldin, der man gerne folgt.
Jacqueline Braun jedoch ist der heimliche Showstealer des Abends. Als Julias Amme bringt sie nicht nur großartige komödiantische Momente, sondern auch eine gesangliche Wucht auf die Bühne, die ihresgleichen sucht. Ihre Szenen sind geprägt von Witz, Timing und einer Stimme, die im besten Sinne überwältigt. Man wünscht sich tatsächlich, sie würde die Bühne nie verlassen.
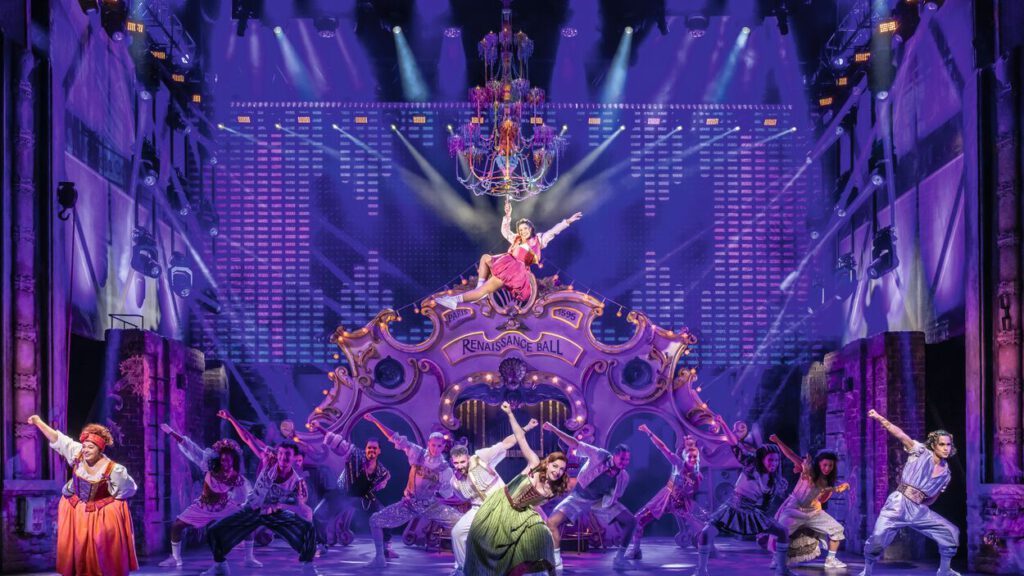
Andreas Bongard als Shakespeare selbst bleibt solide, angenehm präsent, humorvoll. Stimmlich kann er mit der Wucht Verkaiks zwar nicht mithalten – doch in seiner charmanten Unsicherheit und ironischen Selbstreflexion liegt eine Rolle, die er klug ausfüllt.
Zwischen popkultureller Explosion, Shakespeare’scher Ironie und queerer Selbstermächtigung entfaltet sich im zweiten Handlungsstrang von & JULIA eine Geschichte, die leiser beginnt – und umso nachhaltiger wirkt: die Erzählung von May und François, zwei Figuren, die einander inmitten des schrillen Trubels begegnen – und in ihrer Zartheit herausragen.
May, gespielt mit bemerkenswerter Sensibilität und natürlicher Bühnenpräsenz von Bram Tahamata, ist nicht-binär – und bringt damit eine Identität ins Musical, die bislang viel zu selten auf großen Bühnen in den Mittelpunkt gerückt wird. Es ist das Verdienst der Inszenierung, dass Mays Geschichte nicht mit Pathos oder Belehrung erzählt wird, sondern mit Empathie, Humor und Mut. Die Figur ist stolz, verletzlich, selbstironisch – und damit durch und durch menschlich.
In der zögerlich-ungeschickten Annäherung an François Dubois, den liebenswert unbeholfenen jungen Adligen, gespielt von Oliver Edward, findet & JULIA zu Momenten echter Emotionalität. Edwards verleiht François eine warmherzige Unsicherheit, einen leichten, spitzbübigen Charme – und wenn beide gemeinsam auf der Bühne stehen, spürt man: Hier treffen sich zwei Seelen, nicht zwei Rollenklischees.
Der Song I’m Not A Girl, Not Yet A Woman, interpretiert von May, ist einer der großen Gänsehautmomente des Abends. Was bei Britney Spears einst eine Coming-of-Age-Hymne für Teenager war, wird hier zu einer zutiefst persönlichen, authentischen Selbstverortung – zart, ehrlich, mutig und von Herzen kommend.
Die Chemie zwischen Tahamata und Edward ist fein gezeichnet, niemals aufgesetzt. Ihr Duett Perfect (im Original von Pink) ist ein weiterer Höhepunkt: ein Liebeslied, das weniger auf große Gesten, als auf stille Akzeptanz setzt. Das macht es umso kraftvoller.

Während viele Figuren in & JULIA durch Tiefe, Wandlung und Witz glänzen, bleibt Raphael Groß in der Rolle des Romeo etwas hinter dem strahlenden Ensemble zurück. Sicher, er erfüllt das Bild des überromantischen Schönlings mit Charme und einem gewissen Bühnenflair – doch leider bleibt seine Darstellung insgesamt recht eindimensional.
Vielleicht liegt es zum Teil am Rollenprofil, das Romeo bewusst als überzeichnete Karikatur seiner eigenen literarischen Tragik anlegt – ein Mann, der nicht über Julia, sondern vor allem über sich selbst hinwegkommen muss. Doch wo die Inszenierung Raum ließe für ironische Brechung oder emotionale Tiefe, bleibt Großs Spiel oft an der Oberfläche.
Besonders hervorzuheben ist das Ensemble: eine brillante Mischung aus tänzerischer Präzision, stimmlicher Stärke und mitreißender Spielfreude. Die Choreografien sind energetisch, die Szenenübergänge fließend, und das Timing sitzt auf den Punkt. Hier wird mit Lust und Liebe zum Detail gearbeitet – das spürt man in jeder Bewegung.

Ein wahres Geschenk ist auch die deutsche Übersetzung der Dialoge. Sie sind unverschämt witzig, clever konstruiert, anspielungsreich und dennoch zugänglich. Der Humor ist temporeich, manchmal frech, oft überraschend – und trifft durchweg ins Schwarze.
& JULIA ist weit mehr als eine moderne Shakespeare-Variation. Es ist ein Musical, das mit Erwartungen spielt, sie übertrifft, das Genre feiert und dabei etwas Eigenes schafft. Es bringt Feminismus, queere Perspektiven, Humor und Herz auf eine Bühne, die bebt vor Energie – und das alles mit dem Glitzer eines popmusikalischen Welttheaters.
Ein Abend, der leicht beginnt, laut lacht – und doch mit leisen Fragen endet: Was will ich selbst vom Leben? Was ist mein eigener Text?
Ein Muss für Musical-Fans, ein Geschenk für alle, die Theater mit einer Explosion aus Witz, Pop und Empowerment lieben.


Review: DEAR EVAN HANSEN
Stadttheater Fürth


von Marcel Eckerlein-Konrath
Mit Spannung wurde die deutsche Erstaufführung des preisgekrönten Broadway-Musicals Dear Evan Hansen erwartet – einem Stück, das mit ungewöhnlicher Ehrlichkeit Themen wie soziale Angststörung, Suizid, Depression, Trauer und die Sehnsucht nach Zugehörigkeit behandelt. Nun hat es den Sprung auf die deutschsprachige Bühne geschafft – in einer Inszenierung, die sich visuell und atmosphärisch eng am amerikanischen Original orientiert, zugleich aber mit ihrer eigenen visuellen Handschrift punktet.
Allen voran der gekonnte Einsatz von Live-Kameras, eingeblendeten Nachrichten, Reels und Social-Media-Kommentaren: Diese Elemente sind nicht bloße Gimmicks, sondern formen den Raum, in dem sich die fragile Identitätssuche der Jugendlichen abspielt. Das Digitale wird zur Bühne für Sehnsucht, Schmerz und Projektion – und in dieser deutschen Fassung klug und effektiv eingesetzt.
Im Mittelpunkt steht Evan Hansen, ein verunsicherter, sozial isolierter Teenager mit ausgeprägten Angststörungen. Durch eine Verkettung tragischer Umstände wird ein an ihn selbst adressierter Brief als Abschiedsbrief eines verstorbenen Mitschülers – Connor – fehlinterpretiert. Aus einer kleinen Notlüge entsteht ein komplexes Netz aus Erfindungen, das Evan plötzlich Aufmerksamkeit, Nähe und Zugehörigkeit verschafft – aber auf einem tragischen Missverständnis beruht.
Das Musical wirft auf berührende Weise die Frage auf, wie wir in einer zunehmend digitalen Welt noch echte Verbindungen knüpfen – und was geschieht, wenn wir Menschen vorschnell in Schubladen stecken, ohne wirklich hinzusehen. Wer bleibt ungesehen, obwohl er längst da ist?

Was dieses Musical über seinen bewegenden Inhalt hinaus so besonders macht, ist die mitreißende und zugleich tief berührende Musik von Benj Pasek & Justin Paul. Das Komponisten-Duo, das auch für Filme wie La La Land und The Greatest Showman gefeiert wurde, liefert hier ein Score, das unter die Haut geht – und im Ohr bleibt.
Stücke wie „Waving Through a Window“, „You Will Be Found“ oder „For Forever“ haben längst den Sprung aus dem Theatersaal in Playlists und Herzen geschafft. Es sind keine reinen Musical-Nummern – sie tragen das moderne Singer-Songwriter-Gen in sich, sind emotional aufgeladen, melodisch eingängig, aber nie banal.
Eine deutschsprachige Einspielung existiert bislang noch nicht, doch das Original Broadway Cast Album ist ein Must-have für Musical-Liebhaber. Es wurde zu Recht mit dem Grammy Award für das beste Musical-Album ausgezeichnet. Das Musical selbst gewann sechs Tony Awards im Jahr 2017, darunter Best Musical, Best Score (Pasek & Paul), Best Book (Steven Levenson) und Best Actor (Ben Platt in der Titelrolle).
Die Uraufführung von Dear Evan Hansen fand im Dezember 2016 am Broadway statt, unter der Regie von Michael Greif. Schon bald entwickelte sich das Stück zu einem kulturellen Phänomen, das über die Theaterwelt hinaus Wirkung zeigte. Die Geschichte eines einsamen Jungen, der plötzlich sichtbar wird – wenn auch unter falschen Vorzeichen – sprach eine ganze Generation an, die zwischen Social Media, Leistungsdruck und Selbstzweifeln navigiert.
Mittlerweile wurde das Musical weltweit aufgeführt, u.a. in London (West End), Kanada, Israel, Mexiko und Japan. Es folgte eine – kritisch umstrittene – Filmadaption mit Ben Platt in der Hauptrolle. Der emotionale Kern des Musicals aber bleibt universell.

In der deutschen Produktion, die insgesamt eine solide Umsetzung bietet, bleibt die Darstellung des Evan Hansen jedoch zwiespältig. Denis Riffel bemüht sich spürbar, die inneren Kämpfe seiner Figur zu erfassen, doch überzeichnet er den Charakter stellenweise so stark, dass sich ein glaubwürdiges Bild nicht recht einstellen will. Die vielen nervösen Laute, das Stottern, das unentwegte Pressen von Geräuschen – all das lässt ihn weniger wie einen jungen Menschen mit Angststörung, sondern eher wie jemanden mit autistischen Zügen (speziell Asperger-Syndrom) erscheinen.
Hier ist eine Differenzierung wichtig: Während sich soziale Angststörungen durch extreme Furcht vor Bewertung und Ablehnung äußern – oft verbunden mit Rückzugsverhalten, Herzrasen, Vermeidungsverhalten –, handelt es sich beim Asperger-Syndrom um eine neurobiologische Entwicklungsstörung des Autismus-Spektrums. Menschen mit Asperger zeigen häufig Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion, ein eingeschränktes Empathievermögen, stereotype Verhaltensmuster – aber nicht zwangsläufig Angst im sozialen Kontakt. Dass der deutsche Evan teils wie eine Verschmelzung beider Krankheitsbilder wirkt, schwächt die emotionale Kohärenz der Figur und erschwert die Identifikation. Diese beiden Krankheitsbilder sind keineswegs austauschbar – ihre Überlagerung in dieser Darstellung verwässert die emotionale Klarheit der Figur.
Yngve Gasoy-Romdal, in der Rolle des Larry Murphy, bleibt leider etwas blass. Sein Gesangsstil, der stets leicht weinerlich gefärbt wirkt, nimmt seinen wenigen Szenen etwas von ihrer emotionalen Wirkung. Dennoch fügt er sich solide ins Ensemble ein und hält sich dabei angenehm zurück. Ein echtes Highlight hingegen ist das Terzett „Requiem“, das mit feiner Abstimmung und bewegender Präsenz zu einem der stärksten Momente des Abends wird.
Michaela Thurner als Zoe Murphy liefert eine sehr überzeugende, nuancierte Performance: Sie trifft die Zerrissenheit zwischen Wut, Schuld und der Suche nach Nähe punktgenau. Ihre Darstellung ist durchweg glaubwürdig und emotional zugänglich – ein klarer Höhepunkt der Inszenierung.
Vanessa Heinz begeistert als Alana Beck mit klarer Stimme, großer Bühnenpräsenz und emotionaler Tiefe – sie verleiht einer Figur, die leicht zur Randerscheinung werden könnte, echtes Gewicht. Ebenfalls stark: Savio Byrczak als Jared. Er sorgt mit trockenem Humor und pointierten Einsätzen für die notwendige Portion Leichtigkeit.
Etwas hölzern und textlich oft schwer verständlich bleibt leider Jelle Wijgergangs als Connor. Seine Szenen, insbesondere in den „Geisterdialogen“ mit Evan, verlieren dadurch an Wirkung und Tiefe.


Besonders hervorzuheben ist Anna Thorén als Heidi Hansen, Evans alleinerziehende Mutter. Ihre Darstellung ist von großer Wärme, Kraft und Verletzlichkeit – sie verleiht der Figur Tiefe und Würde, ohne je ins Sentimentale zu kippen. Heidi ist eine Frau, die alles gibt, oft über ihre Grenzen geht und dennoch immer das Gefühl hat, nicht zu genügen. Thorén macht diesen inneren Zwiespalt spürbar: die erschöpfte Fürsorge, der Stolz auf ihren Sohn, die Angst, ihn zu verlieren. Ihr Solo „So groß, so klein “ gehört zu den emotionalen Höhepunkten des Abends – bewegend und ehrlich.
Ein starkes Gegengewicht bildet Monika Maria Staszak als Cynthia Murphy, die Mutter des verstorbenen Connor. Im Gegensatz zu Heidi ist Cynthia Teil einer wohlhabenderen, aber innerlich zerfallenen Familie – und sucht Halt in der Vorstellung, ihr Sohn habe in seinen letzten Tagen doch noch einen Freund gefunden. Staszak spielt diese Mischung aus Verdrängung, Trauer und Hoffnung mit großer Zurückhaltung und berührender Verletzlichkeit. Während Heidi kämpft, ringt Cynthia – beide Mütter lieben, aber auf ganz unterschiedliche Weise.
Diese beiden Frauenfiguren – so verschieden sie auch sind – zeigen, wie vielschichtig und schmerzhaft Elternliebe sein kann, wenn sie an Grenzen stößt. Und sie sind es letztlich, die dem Stück seinen leisen, aber anhaltenden Nachhall verleihen.
Die deutsche Übersetzung der Lieder und Dialoge durch Nina Schneider gelingt bemerkenswert gut. Sie wahrt den Rhythmus und die Poesie der Originaltexte und punktet dabei auch inhaltlich – vor allem in den Songs, die oft emotional aufgeladen und sprachlich komplex sind. Die Übersetzung der Songtexte ins Deutsche ist insgesamt gelungen, wenngleich manche Nuancen der Originalsprache auf der Strecke bleiben – doch das ist bei derart idiomatisch dichten Stücken fast unvermeidlich. Was jedoch bleibt, ist eine Geschichte, die sehr berührt.
Die Regie und das Bühnenbild von Markus Olzinger schaffen ein klares, fokussiertes Setting, das zwischen Intimität und medialer Überwältigung changiert. Die flexible, minimalistische Bühne lässt Raum für die Figuren – und für die digitalen Projektionen, die nie zum Selbstzweck werden, sondern stets dem Innenleben der Figuren dienen.
Diese deutsche Erstinszenierung von Dear Evan Hansen überzeugt in vielen Bereichen: mit ihrer starken Musik, ihrer emotionalen Thematik und einer visuell überzeugenden Umsetzung. Schwächen in der darstellerischen Feinzeichnung – vor allem bei der Hauptfigur – trüben das Gesamtbild zwar leicht, doch bleibt der Abend lohnenswert und bewegend. Gerade in Zeiten, in denen psychische Gesundheit noch immer zu wenig thematisiert wird, ist Dear Evan Hansen auf der Bühne ein wichtiges Zeichen.
Review: Disneys HERCULES
Neue Flora, Hamburg


von Marcel Eckerlein-Konrath
Was genau Disney sich dabei gedacht hat, ausgerechnet Hercules als abendfüllendes Musical auf die Bühne zu bringen, bleibt ein Rätsel von mythologischen Ausmaßen. Vielleicht war es eine Laune der Götter. Vielleicht ein Versehen. Wahrscheinlicher aber: eine Entscheidung in einem fensterlosen Konferenzraum, fernab jeglichen Theaterverstands. Was dabei herauskam, ist eine Produktion, die selbst in der Unterwelt noch als Foltermethode durchgehen würde. Götter müssen offenbar einen sehr, sehr bösen Sinn für Humor haben. Es beginnt eigentlich vielversprechend: Die Musen (Leslie Beehann, Virginia Vass, Venolia Manale, UZOH und Jessica Reese) – gesanglich toll und mitreißend – sind das musikalische Herzstück der Show. Sie kämpfen sich textlich durch ein Libretto, das klingt, als hätte jemand die Lyrics des Openers auf „Repeat“ gestellt. Gefühlte zwanzig Varianten desselben Songs („Genauso war’s“), aber keine Idee, wie man daraus dramaturgisch Spannung erzeugt. Gospel-Energie trifft auf kreativen Stillstand. Und so ist der erste Akt ein zäher, klebriger Kaugummi der Langeweile – man kaut und kaut, aber der Geschmack bleibt aus. Was auf der Bühne der Neuen Flora Hamburg als Musical-Event angekündigt wurde, entpuppte sich als zweieinhalbstündiger Beweis dafür, dass nicht jede Disney-Vorlage für die Bühne taugt. Hercules – Das Musical ist schlimmer als ein Autounfall: Man will wegsehen, aber schafft es einfach nicht, weil man sich fragt, ob es noch schlimmer werden kann. Spoiler: Ja, es kann.
Gespickt mit peinlichen Kalauern wie „Ich bin ein Gott, deswegen mag ich Götterspeise“ dümpelt die Geschichte leblos vor sich hin. Die Witze funktionieren alle nicht als Witz, weil sie keinerlei Mehrwert bieten – weder inhaltlich, noch charakterbezogen, noch sind sie ansatzweise komisch.
Hades, gespielt von Detlef Leistenschneider, hätte durchaus das Potenzial, der strahlende Gegenpol zum Heldentum des Hercules zu sein – eine Figur voller Feuer, Hinterlist, dämonischer Eleganz. Doch was auf der Bühne erscheint, ist das genaue Gegenteil: eine Karikatur, irgendwo zwischen Kindertheater-Sidekick und Schurken Imitation gone wrong. Leistenschneiders Hades scheint nicht zu wissen, was er sein will – oder sein darf. Diabolisch? Fehlanzeige. Ironisch? Wenn überhaupt, unfreiwillig. Stattdessen erleben wir eine jammernde, grimassierende Witzfigur, der nicht ansatzweise an den Gott der Unterwelt erinnert. Die Inszenierung gibt ihm einen skurrilen Psycho-Unterton mit – inklusive eines Ödipus-Komplexes, der nur ungläubiges Kopfschütteln auslöst. Die Figur wirkt unfertig, halbherzig, fehlgeleitet. Was wohl als moderne Idee gedacht war, gerät zur Farce. Der Versuch, ihn als durchgeknallten diabolischen Antagonisten zu inszenieren, scheitert grandios. Sein Kostüm? Ein einziger modischer Amoklauf. Die blaue Perücke – eine Art Halloween-Relikt zwischen Anime-Con und Karneval. Hades ist kein ernstzunehmender Gegenspieler, kein düsterer Gegentwurf zur leuchtenden Heldenreise – sondern eine dramaturgische Fehlzündung, die den mythologischen Unterbau der Geschichte zur unfreiwilligen Persiflage verkommen lässt.

Die Choreografien von Casey Nicholaw und Tanisha Scott erinnern streckenweise an das, was man auf einem Sommerfest eines Berufskollegs der 1980er-Jahre erwarten würde – dargeboten von der wenig ambitionierten B-Gruppe, die beim Vortanzen für die eigentliche Aufführung durchgefallen ist. Bewegungsfolgen ohne Dynamik oder szenische Einbettung reihen sich aneinander. Was als dynamischer Showdown, als kraftvolle Bewegungssprache gedacht war, entfaltet sich auf der Bühne in einer bizarren Mischung aus Schulaufführung, volkshochschultauglichem Ausdruckstanz und rhythmisch entgleistem Aufwärmprogramm. Kein Takt sitzt und keine Bewegung folgt einer klaren Linie oder gar einer choreografischen Intention.
Besonders schmerzhaft kulminiert dieser choreografische Offenbarungseid im „epischen“ Kampf gegen das riesige Wurm-Monster. Ein Moment, der eigentlich Suspense und Spektakel versprechen sollte – und stattdessen unbeabsichtigte Komik der schlimmsten Sorte liefert. Die Puppe selbst – ein Hybridwesen aus Thermomatte, Staubsaugerschlauch und leeren Poolnudeln – wird gelangweilt vom gut sichtbaren Puppenspieler gesteuert, der vermutlich denkt: Was genau ist hier schiefgelaufen in meinem Leben?
Während Hercules und Meg mit übertriebenem Ernst gegen das Latex-Gebilde ankämpfen, als hätten sie es mit einem Superschurken zu tun, flüchtet sich das Publikum kollektiv in die innere Emigration. Einige versuchen, das Geschehen durch intensives Blinzeln verschwimmen zu lassen, andere scheinen innerlich Einkaufslisten durchzugehen oder seelisch bereits beim nächsten Theaterstück. Der Rest? Lacht leise. Aus Verzweiflung. Oder weil alles so tragisch ist, dass es nur noch komisch sein kann.
Schauspielerisch bleibt vieles blass. Philipp Büttner als Hercules hat die physische Präsenz, aber sein Charakter bleibt ein naiver Hohlkörper. Mehr Kraft als Köpfchen – was zum Konzept durchaus passt, aber wenig Charme entfaltet. Ein seltener Lichtblick in diesem ansonsten musikalisch blassen Abend ist Büttners Interpretation von „Endlich angekommen“. Mit kraftvoller Stimme, emotionaler Tiefe und einem feinen Gespür für phrasiertes Erzählen gelingt ihm ein Moment echter musikalischer Präsenz. Es ist einer der wenigen Augenblicke, in denen man für einen Moment vergisst, wie schwach der Rest des Scores ist. Mae Ann Jorolan als Meg verleiht ihrer Figur eine moderne Note, ist stimmlich überzeugend („Nein, ich bin nicht verliebt“), bleibt aber in einer Inszenierung gefangen, die keine Tiefe zulässt. Ihre Emanzipation wirkt wie eine Fußnote im Skript, ihr Potenzial verschenkt.
Und dann wären da noch Karl und Heinz – zwei Figuren, die wirken, als hätte man sie versehentlich aus einem RTL-II-Comedy-Format der frühen 2000er in dieses Musical teleportiert. Johnny Galeandro und André Haedicke sollen offensichtlich als Comic Relief fungieren, doch statt Erleichterung bringen sie vor allem eines: Fremdscham gespickt mit Boomer Humor. Karl und Heinz tragen dramaturgisch nichts bei – sie sind nicht einmal sinnvoll eingegliedert. Ihre Szenen fühlen sich an wie Pausenfüller, die die Handlung nicht nur unterbrechen, sondern ihr aktiv im Weg stehen.

Musikalisch bleibt Hercules ebenso blutleer. Die neuen Songs von Alan Menken sind belanglos, melodisch austauschbar, dramaturgisch wirkungslos. Kein einziger Ohrwurm, kein einziger Moment musikalischer Erhebung. Die neuen Songs sind so generisch, dass man sich schon während des Hörens fragt, ob sie überhaupt stattfinden. Keine Melodie bleibt hängen, kein Moment brennt sich ein.
Dass Casey Nicholaw hier Regie geführt haben soll, glaubt man nur, wenn man es schwarz auf weiß liest. Zwischen The Book of Mormon und Hercules liegen Welten – Welten, in denen jedes Gespür für Tempo, Timing und Witz verloren gegangen ist. Diese Inszenierung hat keinen Drive, keine Spannung, keinen Rhythmus. Die Inszenierung? Ein Trauerspiel, das durch nichts geadelt wird – außer durch das Mitleid, das man mit den Darsteller:innen empfindet, die alles geben, obwohl es nichts zu retten gibt.
Wer je gedacht hat, Hercules sei ein unterschätzter Disney-Film mit Potenzial für die große Bühne – wird hier eines Besseren belehrt. Es funktioniert nicht. Und das auf so vielen Ebenen. Die Vorlage – ein durchaus cleverer, musikalisch origineller und visuell starker Animationsfilm von 1997 – bietet eigentlich alles, was ein moderner Musical-Hit braucht: starke Archetypen, eine Prise antike Dramatik, eine Coming-of-Age-Geschichte und jede Menge Spielraum für Humor und Emotion. Doch was in der Disney-Version charmant, rhythmisch pointiert und ironisch durchkomponiert ist, wird in dieser Bühnenumsetzung auf frappierende Weise entkernt. Statt Götterglanz und Heldenreise gibt’s hier zähe Dialoge, plakative Effekte, bemühten Slapstick und eine erstaunliche kreative Leere, die selbst die schönsten mythologischen Stoffe in pure Langeweile verwandelt.
Was als potenziell frischer, antiker Pop-Mythos hätte auftrumpfen können, verkommt hier zur griechischen Tragödie im schlechtesten Sinne: überlang, überflüssig, und in seiner schlimmsten Form – langweilig.

Review: LA CAGE AUX FOLLES
Komische Oper Berlin


von Marcel Eckerlein-Konrath
Subtil taucht im Wortschatz von Regisseur Barrie Kosky nur sehr sporadisch auf, zumindest wenn es um seine Inszenierung von Jerry Hermans Musical „La Cage Aux Folles“ geht. Mit seiner Arbeit für die Komische Oper Berlin demonstriert der beliebte australische Regisseur eine kurzweilig, opulent bunte Symphonie aus Farben und Formen, umschmeichelt von exorbitant aufwändigen Kostümen von Klaus Bruns. Jeder der weiß, was sich hinter Tom of Finland und seiner homoerotischen Kunst verbirgt, wird sich ein Schmunzeln beim Bühnenbild von Rufus Didwiszus nicht verkneifen können. Da wir uns aber weder bei Strindberg, noch bei Ibsen befinden und auch die Dialoge eher „Golden Girls“ als „Totentanz“ sind, ist eine gewisse erfrischende Spitzfindigkeit uneingeschränkt willkommen. Als das Musical von Hermann, mit dem Buch von Harvey Fierstein am 21. August 1983 uraufgeführt wurde, war die Welt noch eine andere. Motorola brachte das erste kommerzielle Mobiltelefon auf den Markt, es war das Ende des Kalten Krieges, Michael Jacksons „Thriller“ erschien und in der Filmwelt feierten Filme wie „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ und „Scarface“ Erfolge. Nelson Mandela und Oliver Tambo erhielten den UNESCO-Preis für ihre Arbeit im Kampf gegen die Apartheid in Südafrika. Und es war der Beginn der AIDS Krise, die verheerende Auswirkungen auf Millionen von Menschen weltweit hatte. Als das Musical debütierte, war die Diskussion über gleichgeschlechtliche Beziehungen und Transgender-Themen noch relativ neu und oft von Vorurteilen und Tabus geprägt.

La Cage Aux Folles brachte diese Themen jedoch selbstbewusst, wie selbstverständlich auf die Bühne und leistete einen wichtigen Beitrag zur zunehmenden Akzeptanz und Sichtbarkeit der LGBTQ+ Community. So wurde ein schwules, sich liebendes Paar auf der Bühne zu einem gigantischen Broadway Erfolg. Es gewann mehrere Tony Awards, darunter den für das beste Musical, und lief über 1.700 Vorstellungen. Die Premiere im Berliner Theater des Westens, wurde damals bei der deutschsprachigen Uraufführung zu einem Triumph für Intendant Helmut Baumann und „Ich bin, was ich bin“ zu einer Hymne und genießt seitdem Kultstatus. Für die Komische Oper verwendet Kosky die neue Übersetzung von Martin G. Berger, der „La Cage“ bereits an der Oper Basel mit Stefan Kurt inszenierte. Kurt ist auch in Berlin als Zaza zu sehen. „La Cage Aux Folles“ dreht sich um das Leben des schwulen Paares Georges, dem Besitzer eines Nachtclubs, und Albin, der als Drag Queen namens Zaza in Georges‘ Club auftritt. Probleme entstehen, als Georges‘ Sohn Jean-Michel ankündigt, dass er heiraten möchte. Jean-Michel ist der Sohn von Georges aus einer früheren heterosexuellen Beziehung und ist besorgt darüber, wie seine konservativen zukünftigen Schwiegereltern auf seine unkonventionelle Familie reagieren würden. Um den Eltern seiner Verlobten einen traditionelleren Eindruck zu vermitteln, bittet Jean-Michel Georges und Albin, ihre wahre Identität zu verbergen, was zu wunderbar komischen Verwicklungen führt. Stefan Kurt kann als Zaza sämtliche Register seines Schauspielportfolio ziehen und ist als Revuestar absolut überragend. Seine gesanglichen Qualitäten erinnern leicht an eine Marlene Dietrich oder Hildegard Knef mit einem Schuss Georgette Dee und reichen zwar nicht an einen ausgebildeten Musicalsänger heran, können aber dennoch überzeugen und treffen direkt ins Herz. Das was Kurt gesanglich nur andeutet, macht er schauspielerisch umso eindringlicher und eindrucksvoller in einer rundherum überzeugenden und starken Charakterisierung wett. Als sein Mann Georges ist Kammersänger Peter Renz ein guter Gegenpart zu Stefan Kurt, wenngleich der ausgebildete Tenor erwartungsgemäß auf dem musikalischen Sektor besser punkten kann als sein Kollege. Auch wenn die beiden gut harmonieren und die Chemie stimmt, glaubt man ihnen das verliebte, seit langer Zeit zusammenlebende Paar nicht so ganz. Daniel Daniela Ojeda Yrureta ist als Zofe Jacob mit stetig wechselnden Kostümen (auch hier zieht Klaus Bruns wieder alle Register seines Könnens) mit Akrobatik und einem Feuerwerk der Exzentrik ein echter Scene Stealer, der mit vulkanartigem Temperament für reichlich Lachsalven sorgt. Nicky Wuchinger und Maria-Danaé Bansen als Jean-Michel und Ann bleiben etwas farblos und austauschbar im Hintergrund, während Angelika Milster einen leicht desolaten Gastauftritt als Clubbesitzerin Jaqueline hinlegt. Auch wenn die große Diva nur wenige Zeilen singt, wirken ihre wenigen Dialoge stark unterprobt und etwas fahrig. Sie tritt bei der Wiederaufnahme in die Stilettos von Helmut Baumann, der Zaza der deutschen Uraufführung, der Jacqueline vor Milster spielte.
Grandios sind die Cagelles, die mit tänzerischer Finesse (Choreographie: Otto Pichler und Stepp-Choreographie: Mariana Souza) und überdrehter Slapstick zu einer weiteren, wertvollen Bereicherung für die Show werden. Dezenz ist auch hier eher Schwäche, denn der Humor ist streckenweise derb, besonders im ersten Akt stark, im zweiten hingegen etwas schleppender. Unter der hervorragenden musikalischen Leitung von Maestro Koen Schoots versprüht das Orchester der Komischen Oper einen satten Sound, der in der aktuellen Ausweichstätte im Schillertheater formvollendet ins Parkett brandet. „Ich bin was ich bin“ ist nach wie vor eine Hymne an die Individualität und ein Manifest für die Akzeptanz, trotz möglicher Ablehnung oder Verurteilung durch andere. Der Song ist, wie das Musical selbst, eine Feier der Individualität und ermutigt dazu, sich selbst treu zu bleiben und sich nicht von gesellschaftlichen Normen oder Vorurteilen einschränken zu lassen. „Es wird kein zurück, kein Fangnetz geben, einmal, also outet euch und raus ins Leben! Man lebt ohne Sinn, bis man dann sagt: Hey Welt, ich bin, was ich bin!“ Harvey Fierstein schrieb das zentrale Lied zunächst als Monolog und wurde dann von Jerry Herman in den prägnanten Song übersetzt, den wir alle kennen und lieben. So feiert Kosky mit seiner Inszenierung das Leben und die Liebe in jeder Form und Farbe. Und wenn dann am Ende „Die schönste Zeit ist jetzt“ ertönt, wissen wir alle, vielleicht etwas geblendet von Pailletten und Federn, das alles gut werden wird. Dazu sagt Kosky: „Die Aufführung von ‚La Cage Aux Folles‘ sollte für die Leute wie eine Batterie sein! Nach dem Besuch sollten sich alle viel, viel besser fühlen als davor. Die Vorstellung sollte sie befreien! […] Es ist so wichtig, das Musiktheater als einen Ort zu haben, wo man drei Stunden den Alltag vergessen kann, um neue Energie zu tanken.“


Review: LES MISÉRABLES
Gärtnerplatztheater München


von Marcel Eckerlein-Konrath
Als die Musicalversion von Victor Hugos Roman „Les Misérables“ 1985 im Londoner Barbican Theatre Premiere feierte, waren die Kritiken der Presse vernichtend. Von „geistlos“, „synthetisch“ und „schrecklich“ war da die Rede. Kaum jemand konnte sich vorstellen, dass dieses Werk die Zeit überstehen würde, geschweige denn Musicalgeschichte schreiben könnte. Nach über 15.000 Vorstellungen im Londoner West End, zahlreichen Tony Awards, einem Grammy, einer starbesetzten, Oscar prämierten Verfilmung und unzähligen internationalen Produktionen, kann man getrost behaupten, dass sich das Werk als astreiner Welthit entpuppt hat. Im Laufe der Zeit verstummten die negativen Kritiken, einige Vertreter unserer Zunft betrachteten das Werk sogar nach Jahren noch einmal neu und weitaus wohlwollender. Denn eins muss sich jeder Kritiker zugestehen: „Les Misérables“ hat es verdient, als musikalisches Meisterwerk betrachtet zu werden. Das nun das Staatstheater am Gärtnerplatz den Zuschlag für eine neue Produktion unter dem wachsamen Auge von Original Produzent Cameron Mackintosh erhalten hat, gleicht einer Sensation. Als Rechteinhaber wählt Mackintosh sehr sorgfältig die Produktionen aus und vergibt nur äußerst selten Lizenzen. Umso erfreulicher ist es, dass „Les Misérables“ nun endlich in München zu sehen ist, nachdem sich Intendant Josef E. Köpplinger mehrere Jahre vergeblich darum bemühte die Rechte zu ergattern. Es ist eine Freude die üppige, gewaltige Musik von Claude-Michel Schönberg in solch großer orchestraler Besetzung unter der Leitung von Maestro Koen Schoots zu erleben. Für seine Inszenierung hat Regisseur und Gärtnerplatz Intendant Josef E. Köpplinger behutsam die Original Inszenierung von Trevor Nunn und John Caird adaptiert und beeindruckend auf die die Münchner Bühne gebracht. Wie im Original Konzept gibt es eine Drehbühne, die funktional arbeitet und so schnelle Szenenwechsel ermöglicht. Dazu gibt es eine Treppe und verschiedene Versatzstücke aus beweglichen Podesten und natürlich die große Barrikade im zweiten Akt (Bühnenbild: Rainer Sinell).

An diesem Premierenabend liegt ein ganz besonderes Knistern in der Luft. Als das Orchester die ersten Töne des Prologs anstimmt wird schnell klar, hier geschieht etwas monumentales. Kraftvoll strömen die Töne den Zuschauern entgegen und geben den Blick auf die Bühne und das Gefangenenlager frei, in dem Jean Valjean festgehalten wird und zur Zwangsarbeit verdammt ist. Schon bei den ersten Tönen durch Hauptdarsteller Armin Kahl ist eine merkliche stimmliche Restriktion zu hören. Und ja Kahl ist so angeschlagen, dass er im zweiten Teil durch die alternierende Besetzung Filippo Strocchi ersetzt wird. Live Theater ist wahrlich eine grausame Geliebte: so schön, wie auch unberechenbar zugleich. So liefert Strocchi eine solide Darstellung des Jean Valjean und eine eindringlich gefühlvolle Version von „Bring ihn heim“. Doch der Star des Abends ist in jedem seiner Auftritte mit gewaltiger, bebender Stimme Daniel Gutmann als Inspektor Javert, der Valjean über Jahre verfolgt und ihn nicht loslassen kann. Er repräsentiert eindringlich einen Charakter, in einem Konflikt mit dem Prinzip der menschlichen Gnade und Vergebung. Gutmanns starker Bariton malt eine breite Palette von Klangfarben und Ausdrucksmöglichkeiten und ist dabei kraftvoll und omnipräsent, gleichzeitig aber auch sehr nuanciert und sanft. Javert ist in Gutmanns Charakterisierung eine tragische Figur, die die Komplexität des menschlichen Geistes und die Nuancen von Recht und Gerechtigkeit im Verlauf des Musicals in Frage stellt. Seine Version von „Stern“ gehört zu einem eindrucksvollen Gänsehaut Moment und dem Highlight des Abends. Eine bessere, tiefgreifendere Darstellung ist derzeit kaum auf deutschsprachigen Bühnen zu erleben. Zu recht erhält Gutmann dafür frenetischen, lang anhaltenden Applaus. Somit reiht sich sein Javert in die A Liga eines Philip Quast, Jeremy Secomb und Norm Lewis ein. Bravo!
Wietske van Tongeren gibt eine stimmgewaltige Fantine, eine tragische Figur, die die harte Realität des Lebens in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts widerspiegelt. Ihr Charakter symbolisiert sehr gut die Opferbereitschaft und den unermüdlichen Kampf gegen Armut und Ungerechtigkeit. Das alles schafft van Tongeren herzzerreißend und mit warmer, schöner Stimmfärbung einzufangen. Als gieriges Ehepaar Thénardier, die skrupellos bereit sind eiskalt über Leichen zu gehen, überzeugen Alexander Franzen und Dagmar Hellberg. Die beiden liefern ein wahres Kabinettstück der Komik, gepaart mit beißendem Zynismus und derben Klamauk. Die Thénardiers sind nicht nur Antagonisten für die anderen Charaktere des Musicals, sondern auch Symbole für die Korruption und Verderbtheit, die in einer Gesellschaft grassieren können, in der Armut und Ungerechtigkeit herrschen. Franzen und Hellberg liefern solch ein großartiges Portrait dieser durch und durch unsympathischen Figuren und stehlen so manche Szene am Premierenabend, das es eine wahre Freude ist. Mit unbändiger Leidenschaft und fantastischer Stimme berührt Katia Bischoff als Eponine und ihrem „Nur für mich“. Eponines Liebe zu Marius (gut: Florian Peters) ist ein wichtiger Teil des Musicals. Obwohl Marius sie nur als gute Freundin betrachtet und seine Gefühle ausschließlich für Cosette (der glockenhelle Sopran von Julia Sturzlbaum erfreut) reserviert sind, bleibt Eponine ihm treu ergeben. Ihre unerwiderte Liebe zu Marius bringt sie dazu, heroische Taten zu vollbringen, um ihn zu beschützen und glücklich zu sehen, auch wenn dies bedeutet, ihre eigenen Gefühle zu unterdrücken und für ihn zu leiden. Obwohl die deutsche Übersetzung von Heinz Rudolf Kunze sehr stimmig ist und grobflächig sehr gut funktioniert, gibt es beim Duett von Eponine und Marius mit „Der Regen“ einige Textzeilen, die den Terminus Kitsch in eine ganz neue Sphäre katapultiert: „Ich bin nicht mehr in Not // Der Regen färbt mich rot,// doch tut er mir nicht weh.// Ihr helft – ich könnt‘ vor Glück verglüh’n. // Ihr schützt mich vor der Nacht,// Ihr haltet mich ganz sacht // und Regen läßt die Blumen blüh’n.“


Unbedingte Erwähnung muss das wahrlich große, wie großartige Ensemble finden. Jeder einzelne Darsteller, jede einzelne Darstellerin spielt mit einer solcher Hingabe und Leidenschaft, das die beklemmende Atmosphäre vor der französischen Revolution eindrucksvoll eingefangen wird. Dazu ist die Diktion hervorragend und perfekt abgestimmt. Merlin Fargel ist ein glühender, stimmlich beeindruckender Enjolras, während Florian Peters als Marius mit „Dunkles Schweigen an den Tischen“ überzeugen kann.
Boubil und Schönberg haben mit „Les Misérables“ ein eindrucksvolles Meisterwerk und Gesamtkunstwerk für die Ewigkeit geschaffen. Die emotionalen Balladen funktionieren dabei ebenso hervorragend, wie die hymnischen Ensemble Nummern „Am Ende des Tags“, „Morgen schon“ oder „Hört ihr wie das Volk erklingt?“ Themen wie Liebe, Vergebung, soziale Gerechtigkeit und den Kampf um Freiheit sind zeitlos und berühren auch so viele Jahre nach der Uraufführung. Das Musical hat einen weiten Weg hinter sich, von einer französischen Konzertproduktion im Jahr 1980 zur gefeierten West End Show und später zum Broadway Erfolg und ganze 43 Jahre später endlich als Premiere in München. Das Warten hat sich gelohnt. „Les Misérables“ gibt als komplett durchkomponiertes Musical all das, was der geneigte Zuschauer erwartet und noch so viel mehr. Ein Abend, der sicher in die Chroniken des Gärtnerplatztheaters eingehen wird, als Erfolg auf ganzer Linie. Zurecht sind alle Vorstellungen bereits ausverkauft, doch die Glücklichen, die ein Ticket besitzen, können sich auf ein perfekt abgestimmtes Theaterereignis freuen. „Les Misérables“ wird somit in München zu einem uneingeschränkten Triumph für Köpplinger und seinem hervorragenden Ensemble und Kreativ Team. Der Siegeszug eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten geht unangefochten weiter.
Review: JESUS CHRIST SUPERSTAR
Staatstheater Nürnberg


von Marcel Eckerlein-Konrath
Ende 2023 fällte ich eine für mich eine wichtige Wahl: ich trat aus der römisch katholischen Kirche aus. Eine wahrlich nicht leichte Entscheidung gegen eine Gemeinschaft, der ich über mehrere Jahrzehnte angehörte. Ich war als Ministrant und Lektor zudem auch jahrelang aktiv in das Gemeindeleben einbezogen. Obwohl meine persönlichen Erfahrungen zum Glück positiver Natur waren, konnte ich als homosexueller Mann nicht länger mit ansehen, wie sehr die Kirche ihr eigenes Unternehmen gegen die Wand fährt, wie Werte verkauft werden und vor allem wie mit Opfern von sexuellem Missbrauch verabscheuungswürdig schlecht umgegangen wird. Die Kombination aus Machtstrukturen, durch die Täter geschützt werden und Opfern denen kein Gehör geschenkt wird, soll angeblich durch eine Kommission aufgearbeitet werden. Diese Kirche ist schon seit Jahren nicht mehr meine Kirche. Die Kirchenoberen haben immer noch nicht verstanden, dass Kindesmissbrauchs ein Verbrechen, und nicht etwa Beiwerk des kirchlichen Daseins ist. Seit Jahren gibt die katholische Kirche nur das zu, was man ihr lückenlos nachweisen kann und schützt ansonsten auch heute noch überführte und verurteilte Sexualstraftäter in ihren Reihen. Und dabei wundert sie sich, dass immer mehr Gläubige der katholischen Kirche enttäuscht den Rücken kehren. Das Problem der katholischen Kirche ist das Bodenpersonal, doch auch die evangelische Kirche zieht mit dieser These nach. Laut einer Studie sind zwischen 1946 und 2020 geschätzt 9.355 Kinder und Jugendliche in evangelischer Kirche und Diakonie sexuell missbraucht worden. Die Studie geht von knapp 3.500 Beschuldigten aus, davon gut ein Drittel Pfarrer oder Vikare. Gleich zu Beginn von „Jesus Christ Superstar“ am Staatstheater Nürnberg, wirft Regisseur Andreas Gergen durch Videoeinspielungen (Momme Hinrichs) rotierende Headlines dem Zuschauer entgegen. Schlagzeilen fordern Missbrauchsfälle in der Kirche aufzuarbeiten, thematisieren die gleichgeschlechtliche Ehe (oder etwas reißerischer „Homo Ehe“) und sprechen die Rolle der Frau in der Kirche an. Hier startet Gergen direkt stark und am Puls der Zeit in den Abend. Wir befinden uns in der Vatikanstadt inmitten kopulierenden Würdenträgern der katholischen Kirche.

Dann richtet sich der Fokus auf Judas. Til Ormeloh ist ein eindringlicher und charismatischer Judas, der mit „Heaven on Their Minds“ auch direkt einen der stärksten Nummern der Rock Oper hat. Jesus lebt mit Maria Magdalena und ihrem gemeinsamen Sohn in einer himmelblauen Einraum Butze mit Mahatma Ghandi Bild, Pace Flagge und einem Einrichtungsstil, der irgendwo zwischen Pseudo Yuppie, Ikea und Prenzlauer Berg liegt. Als Jesus scheint Lukas Mayer, besonders im ersten Akt, wie eine wandelnde Baldrianimplosion. Wie im Delirium singt er gleichgültig seine Songs wie Schlager herunter und schafft keine Persönlichkeit und Struktur der Figur Jesus einzuhauchen. Ohne markante Merkmale oder Charakterzüge zeichnet Mayer so einen teilnahmslosen, faden und langweiligen Jesus. Kaum glaubhaft vermittelbar, dass er eine so hypnotische Wirkung auf seine Jünger (hier heißen sie Jesus People und leben in einer Art Hippie Kommune zusammen) hat. Maria Magdalena wird mit souliger Stimme von Dorina Garuci interpretiert. Gesanglich weiß Garuci durchaus zu überzeugen, kratzt mit ihrer Darstellung aber leider nur sehr blass an der Oberfläche einer Charakterzeichnung ihrer Figur und bleibt dadurch etwas farblos. Ihre innere Zerrissenheit wird lediglich bei „I Don’t Know How To Love Him“ etwas nachvollziehbarer deutlich. Wesentlich stärker schauspielerisch, wie gesanglich ist Marc Clear als „Ich wasche meine Hände in Unschuld“ Pontius Pilatus. Mit sehr viel Tiefe und Farbe schafft er es aus seiner verhältnismäßig überschaubaren Rolle das Maximum herauszuholen. Sein Pilatus ist zweifelnd und heuchlerisch, gebrochen und feige. Eine starke Leistung!
In jeder „Jesus Christ“ Inszenierung gibt es diese eine Nummer, die Lloyd Webber als Revuenummer geschrieben hat und in anderem Kontext und mit anderem Text sicher auch als Vaudeville Gassenhauer funktionieren würde: „King Herod’s Song“, bei dem Tim Rice einen seiner denkwürdigsten Reime konzipiert hat: „Prove to me that you’re no fool / Walk across my swimming pool“. Ensemble Mitglied Hans Kittelmann kann als Herodes nicht so recht punkten und schafft nicht den Spagat zwischen der derben Komik und der zugleich düsteren Darstellung der Begegnung zwischen Jesus und seiner Figur kurz vor der Kreuzigung. Was aber auch daran liegen kann, das Gergen die Nummer als platte Revuegroteske inszeniert. Ministranten tanzen um Herodes teilweise kopulierend herum, während Herodes seine Unterwäsche samt Strapsen und Kreuz entblößt. Das Lied steht stark im Kontrast zur restlichen komplexen Musik von Andrew Lloyd Webber und fällt daher etwas aus dem musikalischen Rahmen. Applaus gibt es dennoch danach, was aber mehr dem Song, als dem Darsteller zuzuschreiben ist (Musikalische Leitung: Jürgen Grimm). Einen guten Eindruck hinterlassen Alexander Alves de Paula als Kaiphas, der mit starkem Bass punkten kann und Samuel Türksoy als Petrus. Er hat gemeinsam mit Dorina Garuci das wunderschöne Duett „Could We Start Again Please“ im zweiten Akt und weiß stimmlich zu überzeugen.

Andrew Lloyd Webber und Tim Rice begannen ihre Zusammenarbeit in den späten 1960er Jahren. Sie waren inspiriert von der Idee, die Geschichte von Jesus Christus als zeitgenössisches Rock-Musical zu erzählen, und begannen, Songs und Texte zu entwickeln. Ursprünglich als Konzeptalbum konzipiert, wurde Jesus Christ Superstar in den 1970ern zu einem sofortigen Erfolg. Die Musik, die eine breite Palette von Rock- und Pop-Einflüssen zeigt, gepaart mit den scharfsinnigen Texten von Tim Rice, fand schnell Anklang bei einem jungen Publikum. Das Album verkaufte sich weltweit millionenfach und erreichte hohe Chartplatzierungen. Der Übergang von der Konzeptalbum-Bühnenshow zum Musical erfolgte dann schnell. Jesus Christ Superstar debütierte 1971 am Broadway und wurde ein sofortiger Erfolg. Die Show revolutionierte das Musical-Genre, indem sie Rockmusik in das traditionelle Theater einführte und eine neue Ära des musikalischen Theaters einläutete. 1972 erfolgte dann die Premiere am Londoner West End, wo das Stück stolze acht Jahre lang lief. Damals gab es zahlreiche Proteste und Menschen, die gegen das Musical demonstrierten, weil es angebliche Blasphemie und die Verherrlichung von Judas als zu sympathischen Charakter darstelle. Eine solche Unterstellung würde heute sicher niemand mehr der Show oder der Inszenierung von Gergen ankreiden. Auch wenn dieser als Regisseur oft zum Rundumschlag auf die Institution Kirche ansetzt und ausholt, sind einige Statements nur behauptet, aber nicht konsequent genug ausgeführt. Das Bodenpersonal der Kirche wird zwar als heuchlerisch und manipulativ dargestellt, der letzte elektrisierende und zünde Funke bleibt aber aus, der die Kirche eiskalt entlarvt.

Die große Nummer von Jesus im zweiten Akt „Gethsemane (I Only Want To Say)“ habe ich schon viel viel stärker gehört (Michael Ball, Drew Sarich). Der Song sollte Jesus vor allem als einen Mann, der mit seinen eigenen menschlichen Schwächen und Emotionen zu kämpfen hat, zeigen. Die Texte von Tim Rice reflektieren sehr gut die inneren Kämpfe und Zweifel von Jesus und stellen gleichzeitig existenzielle Fragen nach dem Sinn seines Opfers und seiner Beziehung zu Gott. Dies transportiert sich durch Lukas Mayers Darstellung und Gesang nur sehr marginal. Punkten kann er aber in der entscheidenden und grausamen Kreuzigung, die durch Video eindringlich intensiv, fast schon abnorm festgehalten wird. Auch wenn die Einbindung von Videoelementen nichts neues ist, gelingt es Gergen hier perfide die Perversität dieser Massakrierung aufzuzeigen. Til Ormeloh kann mit seiner Nummer „Jesus Christ Superstar“ erneut zeigen was er kann, wenn er als Todesengel hereinschwebt und den blutüberströmten Jesus für ein letztes geiferndes Interview zur Effekthascherei ausschlachtet.
Andreas Gergen schafft mit seiner Inszenierung ein Bewusstsein für die vielen Fehlentscheidungen des Klerus, legt den Finger letztendlich aber zu oberflächlich in die Wunde. Die Vehemenz hätte durchaus noch etwas intensiver die Kirche an den Pranger stellen dürfen, weswegen seine Version von „Jesus Christ Superstar“ etwas an emotionaler Resonanz und Individualität vermissen lässt.
Fotos Pedro Malinowski
Review: FOLLIES
Staatstheater Wiesbaden


von Marcel Eckerlein-Konrath
In seiner letzten Spielzeit als Intendant des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden wagt Uwe Eric Laufenberg ein außergewöhnliches Unterfangen: Stephen Sondheims Musical Follies kehrt auf die deutsche Bühne zurück. Unter der Regie von Tom Gerber entfaltet sich ein opulentes Spektakel, das mit einem herausragenden Ensemble, prächtigen Kostümen und einem eindrucksvollen Orchester einen unvergesslichen Theaterabend bietet.
Follies spielt im Jahr 1970 in einem zum Abriss bestimmten Theater, dem ehemaligen Schauplatz der glanzvollen Weismann-Revue. Der Impresario Dimitri Weismann lädt seine ehemaligen Showgirls zu einem letzten Treffen ein. Im Mittelpunkt stehen Sally Durant Plummer (Pia Douwes) und Phyllis Rogers Stone (Jacqueline Macaulay), die mit ihren Ehemännern Buddy (Dirk Weiler) und Ben (Thomas Maria Peters) erscheinen. Während die Gäste in Erinnerungen schwelgen, treten die jüngeren Versionen der Hauptfiguren auf und konfrontieren sie mit verpassten Chancen und unerfüllten Träumen. Die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen, und die Charaktere müssen sich ihren Lebensentscheidungen stellen.

Pia Douwes haucht der Figur der Sally Durant Plummer eine überwältigende emotionale Tiefe ein, die weit über bloße Sentimentalität hinausgeht. Ihre Darstellung changiert mit faszinierender Leichtigkeit zwischen bittersüßer Nostalgie, aufgestauter Lebensenttäuschung und einer nahezu schmerzhaften, inneren Fragilität. In jedem Blick, in jeder Geste liegt das Ringen um ein Leben, das anders hätte verlaufen können. Besonders in ihrem Solo „Ich verlier’ den Verstand“ entfaltet sie eine gesangliche Ausdruckskraft, die in ihrer klanglichen Klarheit und emotionalen Wucht schlichtweg atemberaubend ist. Douwes gelingt es, das fragile Innenleben Sallys mit so viel Wahrhaftigkeit zu zeichnen, dass der Zuschauer nicht nur Anteil nimmt, sondern regelrecht mitfühlt – als würde das Herz dieser Figur für einen Moment auf offener Bühne schlagen. Ein glanzvoller, tief berührender Höhepunkt des Abends.
Jacqueline Macaulay verkörpert Phyllis Rogers Stone mit einer faszinierenden Mischung aus kühler Eleganz, messerscharfer Ironie und verletzlicher Tiefe. Ihre Darstellung lebt von einer geradezu filmischen Präzision – jeder Satz ist pointiert, jeder Blick kalkuliert, jede Geste sitzt. Macaulay spielt Phyllis nicht einfach als zynische High-Society-Frau, sondern als vielschichtige, emotional erschöpfte Frau, die sich im goldenen Käfig ihres Lebens eingerichtet hat – und dabei langsam erstickt.
Ihr Zusammenspiel mit Thomas Maria Peters als Ehemann Ben offenbart auf subtile Weise die Erosion einer Ehe, die längst nur noch aus Fassaden besteht. Und doch ist da unter der Oberfläche eine explosive Wut, eine aufgestaute Sehnsucht nach Authentizität, die in Macaulays Interpretation jederzeit spürbar bleibt.
Besonders eindrucksvoll gelingt ihr dies in dem Solo „Könnt’ ich dich verlassen?“ – ein sarkastisch brillanter, musikalischer Monolog, in dem sie mit funkelndem Spott und schneidender Präzision die Trümmer einer gescheiterten Beziehung ausleuchtet. Ihre Stimme ist dabei zugleich kraftvoll, geschmeidig und von einer kontrollierten Intensität, die jedes Wort auflädt.
Macaulay gelingt mit dieser Phyllis das Kunststück, sowohl Diva als auch tief verletzlicher Mensch zu sein – eine Frau, die durch die Jahrzehnte hinweg Haltung bewahrt hat und nun beginnt, Risse zu zeigen. Ein ebenso intelligenter wie berührender Auftritt.
April Hailer setzt als Carlotta Campion ein fulminantes Ausrufezeichen in dieser Wiesbadener Follies-Inszenierung – ein einziger, großer Moment, der den Saal zum Beben bringt. Ihr Auftritt mit dem legendären Song „Bin noch hier“ („I’m Still Here“), einem der wohl ikonischsten Stücke aus Stephen Sondheims Gesamtwerk, ist nicht nur musikalisch brillant, sondern auch schauspielerisch ein kleines Meisterwerk.
Hailer beginnt die Nummer beinahe beiläufig, fast erzählend – wie eine Frau, die in einem Nebensatz ihr gesamtes Leben Revue passieren lässt. Doch mit jedem Vers wächst ihre Präsenz, gewinnt die Figur an Kontur. Sie durchmisst mit großem stimmlichem Facettenreichtum ein ganzes Leben: Aufstieg, Fall, Wiederaufstieg, Glanz, Verrat, Enttäuschung – und Überleben. Dabei changiert sie mühelos zwischen rauer Selbstironie, trotzigem Humor und einer ungebrochenen Stärke, die Carlotta als wahre Überlebenskünstlerin entlarvt.
Stimmlich glänzt Hailer mit sattem Timbre und punktgenauer Phrasierung. Jeder Ton sitzt, jede Silbe ist mit Bedeutung aufgeladen. Sie durchlebt das Lied, anstatt es nur zu singen – als würde sie in diesem Moment tatsächlich jeden einzelnen Lebensabschnitt noch einmal durchleben. Die berühmte Textzeile „I got through all of last year… and I’m here“ wird unter ihren Händen zur kämpferischen Lebensmaxime einer Frau, die nie untergegangen ist, egal wie hoch die Wellen schlugen.
Das Publikum dankt ihr zu Recht mit lang anhaltendem Applaus – ein echter Showstopper, nicht nur wegen der Musik, sondern wegen der schieren Wucht ihrer Bühnenpräsenz. April Hailer zeigt: Carlotta ist nicht nur noch da – sie ist immer noch eine Klasse für sich.
Dirk Weiler als Buddy und Thomas Maria Peters als Ben ergänzen das Hauptquartett mit überzeugenden Darstellungen. Weiler bringt die Zerrissenheit seiner Figur zum Ausdruck, während Peters die innere Leere hinter Bens erfolgreicher Fassade offenbart.

Tom Gerbers Inszenierung von Follies am Staatstheater Wiesbaden ist ein visuell üppiges und atmosphärisch dichtes Theatererlebnis, das sich mit Hingabe der bittersüßen Nostalgie der goldenen Ära des amerikanischen Showbusiness verschreibt. Gerber gelingt dabei ein kunstvoller Balanceakt: Er fängt sowohl die morbide Melancholie des verfallenden Theaters ein – Symbol für geplatzte Träume und vergangene Illusionen – als auch den glitzernden Zauber der einstigen Revuewelt, die in Erinnerungsblitzen wieder zum Leben erwacht.
Das Bühnenbild changiert zwischen bröckelndem Putz, verstaubten Kulissenteilen und verspiegelten Wänden, in denen sich Vergangenheit und Gegenwart überlagern. Gerber nutzt dabei geschickt Projektionen und Lichtstimmungen, um den fließenden Übergang zwischen Realzeit und Erinnerungstheater zu markieren – nie plakativ, sondern stets elegant angedeutet. Die Idee, dass die Figuren sich buchstäblich ihren jüngeren Ichs gegenübersehen, wird theatral überzeugend umgesetzt und verleiht dem Abend eine fast geisterhafte, träumerische Qualität.
Einen wesentlichen Beitrag zur atmosphärischen Dichte leistet Jannik Kurz mit seinen prächtigen, detaillierten Kostümen. Für die Gegenwart dominieren gedeckte Töne, elegante Schnitte und ein Hauch von Melancholie in der Kleidung der gealterten Figuren. Ganz anders die Rückblenden: Da funkeln Pailletten, rascheln Federboas, glitzern Seidenstoffe im Licht der Rampe – Glamour pur, inspiriert von den klassischen Ziegfeld-Follies-Shows und dem Broadway der 1920er- bis 50er-Jahre.
Besonders eindrucksvoll sind die Parallelbilder, wenn junge und alte Versionen der Figuren gemeinsam auf der Bühne stehen – mal spiegelbildlich, mal konfrontativ. Die Kostüme helfen dabei, diese Doppelungen nicht nur optisch klar zu machen, sondern auch emotional aufzuladen.
Insgesamt ist Gerbers Inszenierung nicht nur eine Reminiszenz an vergangene Theaterpracht, sondern auch eine liebevolle, manchmal ironische, manchmal herzzerreißende Reflexion über Zeit, Vergänglichkeit und das, was auf der Bühne – und im Leben – bleibt, wenn der Vorhang gefallen ist.

Mit dieser opulenten Produktion von Follies gelingt dem Hessischen Staatstheater Wiesbaden ein ebenso mutiger wie würdiger Schlusspunkt unter der Intendanz von Uwe Eric Laufenberg. Dass ausgerechnet ein Stück von Stephen Sondheim – jenem Meister der musikalischen Ambivalenz, des psychologischen Tiefgangs und der ironisch gebrochenen Showästhetik – den Abschied markiert, ist ein kluger, ja beinahe symbolischer Kunstgriff. Denn Follies ist kein gefälliges Gute-Laune-Musical, sondern ein melancholisches Meisterwerk über das Vergehen der Zeit, über Selbstbetrug, Illusion und das schmerzhafte Ringen um Wahrhaftigkeit.
Diese Wiesbadener Inszenierung besticht durch ihre schiere Theaterwucht: das grandios aufspielende Orchester unter der musikalischen Leitung von Albert Horne (der mit seinem Auftritt als Weismann/Roscoe einen herrlich augenzwinkernden Übergang zwischen Bühne und Graben schafft), das verschwenderisch ausgestattete Bühnenbild, die liebevoll gestalteten Kostüme und nicht zuletzt das hochkarätige Ensemble, das mit unbedingter Hingabe agiert.
Besonders hervorzuheben ist dabei, wie fein das Zusammenspiel zwischen Regie, musikalischer Umsetzung und darstellerischer Tiefe austariert ist. Jeder Charakter bekommt Raum zur Entfaltung, jede Szene ist durchkomponiert bis ins Detail, ohne je steril zu wirken. Das Ensemble schafft es, Sondheims geniale, mitunter fragmentarisch wirkende Partitur lebendig werden zu lassen – in all ihrer Komplexität, Schönheit und Bitterkeit.

Dass man sich für dieses vielschichtige, anspruchsvolle Werk entschieden hat – und es in solch großer Besetzung und orchestraler Opulenz zeigt – ist nicht nur ein kulturpolitisches Statement, sondern auch ein Geschenk an das Publikum. Follies ist ein Musical, das fordert, aber auch reich belohnt. Wer sich auf die komplexe Struktur und die doppelbödigen Figuren einlässt, erlebt einen Theaterabend von außergewöhnlicher emotionaler und künstlerischer Dichte.
Im prachtvollen, historischen Zuschauerraum des Wiesbadener Staatstheaters – mit seiner kaiserzeitlichen Eleganz, dem funkelnden Kronleuchter, den roten Samtlogen und der goldenen Decke – entfaltet Follies eine Aura, die kaum passender sein könnte: Eine rauschhafte, melancholische, manchmal auch ironisch gebrochene Feier des Theaters – als Lebensraum, als Traumfabrik, als Erinnerungsmaschine.
Ein Muss für alle Liebhaber des Musiktheaters – und ein eindrucksvoller, nachhallender Abschiedsgruß eines Intendanten, der immer wieder den Mut hatte, große Geschichten in großer Form zu erzählen.

Review: SUNSET BOULEVARD
Savoy Theatre, London


von Marcel Eckerlein-Konrath
Sunset Boulevard war Mitte der 1990er mein erstes West End Musical, dass ich sah. Elaine Paige war meine Norma und diese prägende Erfahrung ihrer herausragenden Performance machte mich zu ihrem Fan und zum Beginn meiner Liebe zu „Sunset Boulevard“. Die Musik beeindruckte mich dabei ebenso sehr wie das ausladende Bühnenbild von John Napier und die prunkvollen, aufwendigen Kostüme von Anthony Powell. So musste sich jahrelang auch zwangsläufig für mich jede neue Inszenierung am Original von Trevor Nunn messen. Im Laufe der Jahre sah ich viele verschiedene Interpretationen und Produktionen. Keine davon konnte so recht ans Original heranreichen. Nun sorgte eine neue Produktion in London für reichlich Wirbel und ich muss gestehen ich war infiziert. Ich wollte und musste mir diese Show unbedingt anschauen. Jamie Lloyd hat mit seiner Inszenierung etwas ganz erstaunliches geschaffen. Er hat die Show nicht nur inszeniert, sondern demontiert, dekonstruiert und vollkommen neu zusammen gefügt. Seine Interpretation ist mutig, einzigartig und hat mit dem Sunset was ich bislang kannte, nichts mehr gemein. Es gibt keine Kostümwechsel (bis auf einen winzigen), alle tragen schwarz weiß und es gibt keinerlei Bühnenbild und Requisiten (Bühne und Kostüme: Soutra Gilmour). Kann das funktionieren? Oder noch anders gefragt: kann dies emotional berühren? Oh ja und wie! Besonders die Musik von Lloyd Webber wird hier zum weiteren Hauptdarsteller. Seine Melodien sind so stark, so treibend dass ich genussvoll wertschätze, welch Meisterwerk er damit geschaffen hat. Das Orchester in London ist überragend. Jeder einzelne Ton, der da aus dem Graben kommt durchströmt den Körper und regt alle Sinne an. Die Musik in „Sunset Boulevard“ von Andrew Lloyd Webber zeichnet sich ganz klar durch ihre dramatische Intensität und emotionale Tiefe aus. Webber ist für mich einer der renommiertesten und besten Musicalkomponisten, der eine Partitur geschaffen hat, die die düstere Atmosphäre des Handlungssettings rund um den ehemaligen Stummfilm Star Norma Desmond und ihre aussichtslose Liebe zum jungen Drehbuchautoren Joe Gillis perfekt einfängt. Die opulenten Orchesterarrangements von Andrew Lloyd Webber und David Cullen erklingen im Savoy Theatre in absoluter Perfektion. Webber nutzt ein reiches Klangspektrum, um die Pracht und den Glanz der Hollywood-Ära, in der die Handlung spielt, widerzuspiegeln. Webber verwendet Leitmotive, um bestimmte Charaktere oder Themen zu repräsentieren. Dies trägt zur Kohärenz der Partitur bei und verknüpft musikalisch verschiedene Szenen und Handlungsstränge meisterhaft miteinander.

Tom Francis beweist von der ersten Sekunde, in der er singt, dass er eine Idealbesetzung für Joe Gillis ist. Für mich der stärkste Joe seit Alexander Hanson. Er ist rau und zärtlich zugleich. Er singt durchdringend brillant und sanft mit einem ehrlichen, naturalistischen Schauspiel. Und dann singt die Frau, die als Hauptdarstellerin so viele Lobeshymnen eingefahren hat. Von der Rolle ihres Lebens ist da die Rede. Selbstverständlich wünsche ich Nicole Scherzinger noch viele Optionen zu glänzen, aber dass was sie auf der Bühne des Savoy Theaters abfeuert ist Weltklasse. Da sitzt nicht nur jeder Ton, nein ihr Schauspiel ist ebenso stark. Ihre Norma ist unglaublich sinnlich und sexy, desillusioniert und geistesgegenwärtig zugleich. Sie beobachtet und wägt ab. She hovered like a hawk. Wobei sie eher wie ein Puma in Gefangenschaft um ihre Beute vorsichtig schleicht und ihre Krallen ausfährt. Wie ein Puma ist ihre Norma ein Einzelgänger und territorial. Sie markiert ihr Revier, um Rivalen aufzulauern und ihre Anwesenheit zu signalisieren. Scherzingers „With One Look“ hat mir buchstäblich den Atem geraubt und ich habe vor Staunen meinen Mund nicht mehr zubekommen. Man könnte meinen Scherzinger sänge um ihr Leben. Was für eine Performance! Nach ihrer Interpretation und ihrem „I’ve come home at last“ während „As If We Never Said Goodbye“ im zweiten Akt, erntet sie zurecht Standing Ovations. Brava!
Eine Entdeckung ist Grace Hodgett Young in ihrem West End Debüt als Betty Schaeffer. Betty wirkt in Jamie Lloyds Version wesentlich aufgeklärter, feministischer und emanzipierter als frühere Auslegungen der Rolle. Mit starker Stimme ist sie ein idealer Counterpart zu Tom Francis als Joe. David Thaxton kann als Max von Mayerling alle Register seines warmen Baritons bedienen und schafft mühelos eine wahre Flut an Gänsehautmomenten. Das Lichtdesign von Jack Knowles gehört zu den besten und stärksten, die jemals in einem Theater zu erleben waren und schafft damit unverwechselbare filom noir Momente. Bemerkenswert punktiert wird in der Inszenierung von Lloyd eine ausgefeilte live Videoprojektion (Design: Nathan Amzi und Joe Ransom) eingesetzt, die alles in den Schatten stellt, was man bisher gesehen hat. Besonders eindrucksvoll gelingt der Beginn des zweiten Aktes, der Backstage in der Garderobe von Tom Francis beginnt und durch die Kamera festgehalten wird. Als er dann das Titellied singt, streift er dabei auch durch die Umkleidezimmer seiner Costars (inklusive einer Nicole Scherzinger, die mit Lippenstift „mad about the boy“ an ihren Garderobenspiegel schreibt) hinaus auf den Strand im West End, und vor das Savoy Hotel und Savoy Theater, mit den letzten Tönen erreicht Francis dann centre stage und wird doch einen frenetischen, berechtigt euphorischen Applaus den Publikums begleitet.


Jamie Lloyd hat mit seiner Inszenierung das Stück komplett neu erfunden, er hat die schwarz weiß Optik des Original Billy Wilder Films adäquat eingefangen und genial auf die Bühne übertragen. Dabei hat er auch einige Kürzungen vorgenommen. So entfallen die beiden Songs „The Lady’s Paying“ und „Eternal Youth Is Worth A Little Suffering“ in seiner Version. Dazu gibt es hier und da ein paar behutsame Änderungen in den Lyrics von Don Black und Christopher Hampton. Lloyds Stil schwankt zwischen Thomas Ostermeier und Ivo van Hove, ist brutal und zärtlich, peitschend und sanft, irritierend und eindrücklich.
Die Inszenierung und Neuerfindung von „Sunset Boulevard“ von Jamie Lloyd ist herausfordernd, provokativ, meisterhaft und setzt damit neue Maßstäbe für die Interpretation klassischer Musical Werke. Es ist eine Regiearbeit, über die ganz London und die Musicalwelt zurecht reden und diskutieren. Sie ist ein orgastischer Hochgenuss über den ich jetzt und zukünftig sagen kann: „Ja, bei diesem musikalischen Ereignis war ich tatsächlich dabei … und es war magisch!“
Review: TITANIC
Theater Erfurt

von Marcel Eckerlein-Konrath
1985 wurde das Wrack der RMS Titanic etwa 370 Meilen (600 km) südsüdöstlich vor der Küste Neufundlands in einer Tiefe von rund 12.500 Fuß im Atlantik entdeckt. Für den Komponisten Maury Yeston war dies der Auslöser, sich intensiver mit dem Schicksal der Titanic auseinanderzusetzen. Yeston, der mit Musicals wie Nine und Grand Hotel vor allem Kritiker begeisterte, entschied sich für eine klassisch inspirierte Herangehensweise an die Musik seines Stücks.
„Ich wusste, dass ich eine ähnliche Klangfarbe finden musste wie bei den großen Komponisten jener Zeit – etwa Elgar oder Vaughan Williams. Für mich war das eine Gelegenheit, ein Element der symphonischen Tradition ins Musiktheater zu bringen, das wir vorher in dieser Form nicht hatten. Das war sehr aufregend“, so Yeston über seinen kompositorischen Ansatz.
Das Musical wurde für fünf Tony Awards nominiert – und gewann sie alle, darunter auch die Auszeichnungen für das beste Musical und die beste Originalkomposition. Mit insgesamt 804 Vorstellungen konnte sich die Produktion am Broadway beachtlich behaupten.
Nach zahlreichen internationalen Produktionen entschied sich das Theater Erfurt, Titanic für die Spielzeit 2023/24 auf den Spielplan zu setzen – ein ambitioniertes und mutiges Vorhaben. Was Erfurt hier auf die Bühne bringt, ist beeindruckend – nicht nur aufgrund der Größe des Ensembles. Neben einem starken Cast, der überwiegend aus Gästen besteht, überzeugt insbesondere der gewaltige Opernchor (Choreinstudierung: Markus Baisch) in der klugen und detailreichen Inszenierung von Stephan Witzlinger.
Schon mit den ersten Tönen der Ouvertüre wird klar: Der eigentliche Star des Abends ist das philharmonische Orchester unter der exquisiten Leitung von Clemens Fieguth. Die Entscheidung, die Musiker sichtbar auf der Bühne zu platzieren – als integralen Bestandteil des Schiffs – ist ein Geniestreich. Das Orchester wird so nicht nur musikalisch, sondern auch szenisch zum Herzstück der Produktion und fügt sich elegant in das Bühnenbild von Lena Scheerer ein.
Scheerer gelingt es mit wenigen, aber wirkungsvollen Mitteln, den Luxusdampfer zum Leben zu erwecken. Besonders im letzten Akt, beim dramatischen Untergang der Titanic, entfaltet ihre Ausstattung eine beeindruckende Wucht. Hier entstehen große Theatermomente, die im Gedächtnis bleiben und noch lange nachwirken.

Titanic legt den Fokus vor allem auf historische Figuren wie Kapitän Smith, souverän gespielt von Martin Sommerlatte, und Schiffskonstrukteur Thomas Andrews (eindringlich: Dennis Weissert). Da ist zum Beispiel der hoffnungsvolle, naive Heizer Frederic Barrett, überzeugend verkörpert von Daniel Eckert, und die junge Kate McGowan (gut: Johanna Spanzel), die ihr Glück in Amerika finden will.
Auch wenn Autor Peter Stone bemüht ist, die Vielfalt der Menschen an Bord und ihre unterschiedlichen Hintergründe sichtbar zu machen, wirkt die Handlung stellenweise zu episodenhaft. Vor allem einige Dialoge (in der deutschen Übersetzung von Wolfgang Adenberg) klingen mitunter hölzern und konstruiert.
Das Musical verfolgt die Ereignisse vor, während und nach dem Untergang der Titanic – in Sachen Emotionalität gelingt das mal mehr, mal weniger überzeugend. Zu bruchstückhaft werden die Geschichten der Charaktere aus den drei sozialen Klassen – darunter Passagiere, Crewmitglieder und Offiziere – präsentiert. Zwar liegt der Fokus auf den individuellen Lebenswegen, Hoffnungen und Träumen, doch die Tiefe bleibt oft an der Oberfläche hängen.
Ein Beispiel: Das Ehepaar Beane reist als Passagiere der dritten Klasse. Alice, großartig gespielt und gesungen von Katja Bildt, träumt davon, zur ersten Klasse zu gehören, und klammert sich an diese Illusion mit kindlicher Inbrunst. Ihr Ehemann Edgar hingegen, wenig überzeugend und merkwürdig deplatziert von Benjamin Ebeling dargestellt, versucht sie immer wieder zurück in die Realität zu holen – als gehöre er eigentlich in ein anderes Stück.

Als Passagiere der ersten Klasse beeindrucken Kerstin Ibald und Martin Berger als Isidor und Ida Straus: Ihre Darstellung ist herzzerreißend rührend, ihr Duett „Wie vor aller Zeit“ zählt zu den emotionalen Höhepunkten der Inszenierung – still, anrührend und nachhaltig bewegend.
Mit „Titanic“ gelingt Regisseur Stephan Witzlinger und seinem glänzenden Team eine beeindruckende Gesamtleistung (Choreografie: Kerstin Ried), wäre da nicht ein ganz unwesentlich wichtiger Faktor für ein Musical, der hier etwas unangenehm aufstößt: die Musik. Die Komposition von Yeston bewegt sich häufig zwischen Oper und Symphonie und ist zwar durchaus schöpferisch wertvoll, mitunter aber schwer antizipierbar. Mit Ausnahme der Eröffnungsnummer, die beeindruckend inszenatorisch und musikalisch gelingt, gibt es kaum Songs die ins Ohr gehen. Yeston versucht mit seiner Musik emotionale Resonanz zu erzeugen, verliert sich aber zu häufig darin. Die Idee mit seiner Komposition die Handlung voranzutreiben und die Erzählung zu unterstützen, gelingt ihm oft nur grobflächig, denn zu sperrig und verklausuliert geraten die teilweise atonalen Melodien. Intervallsprünge und unkonventionelle Klangfarben gestalten es häufig schwierig seiner Musik zu folgen, wirken schon beinahe avantgardistisch und erinnern an Werke von Arnold Schönberg oder Alban Berg.
Sehenswert ist das Stück am Theater Erfurt aber allemal und das liegt vor allem an der fantastischen Symbiose aus Orchester, Regie, Bühne, Licht (Florian Hahn) und Ensemble. Diese Titanic ist definitiv nicht dem Untergang geweiht.

Review: SOMETHING ROTTEN!
English Theatre Frankfurt

von Marcel Eckerlein-Konrath
„What the hell are musicals?! „It appears to be a play where the dialogue stops and the plot is conveyed through song.“ Klingt doch nach einer vortrefflichen Idee. Gut seien wir ehrlich, Menschen die sich gegenseitig ansingen, in musikalische Monologe abdriften oder eine Eleven o‘ clock belten, sind vollkommen unrealistische Utopien. Gleichzeitig sind Musicals nicht nur ein Garant für volle Häuser, sondern machen viel Spaß, berühren und entführen in andere Welten. Wir befinden uns bei „Something Rotten!“ in der Renaissance „with poets, painters, and bon vivants and merry minstrels who strolled the streets of London.“ Es ist die Zeit von Dürer und Michelangelo, Dante Alighieris Göttlicher Komödie, der Venus von Botticelli und der Blütezeit von William Shakespeare.
Welcome to the Renaissance!
So spielt die die Handlung von Something Rotten! im London des 16. Jahrhunderts und dreht sich um die zwei rivalisierenden Brüder, Nick und Nigel Bottom, die versuchen, endlich einen Hit für das Theater zu schreiben. Dabei geraten sie in Konkurrenz mit dem Rockstar-ähnlichen Shakespeare (Matt Beveridge), der im Stückeschreiben wesentlich erfolgreicher ist als die beiden Brüder. Wobei sich Shakespeare teilweise etwas unorthodoxer Methoden bedient um an sein Ziel zu kommen. In ihrer Verzweiflung wenden sie sich an einen Wahrsager, der ihnen prophezeit, dass die Zukunft des Theaters im Musical liegt. Dies bringt sie auf die Idee, das allererste Musical zu schreiben.

Mit Something Rotten! sicherte sich das English Theatre Frankfurt, die deutsche Uraufführung in des für 10 Tony Awards nominierten Musicals aus der Feder der Brüder Karey und Wayne Kirkpatrick. Was das großartig auftrumpfende Ensemble unter der Regie von Ewan Jones in der deutschen Premiere der Show auf die Bühne (Set und Kostüme: Stewart J. Charlesworth) zaubert ist eine wunderbare, herrlich absurd alberne Farce. Auch wenn das Buch von John O’Farrell und Karey Kirkpatrick stark überzeichnet ist und die Gagdichte gut funktioniert, werden die Charakter nie der Lächerlichkeit preisgegeben und sind mehr als bloße funktionierende Schablonen. Greg Miller Burns ist als Nick mit einem guten Gespür für comic timing gesegnet, singt fantastisch und stattet seine Figur aber mit ebenso viel Tiefe wie Herz aus. Als sein Bruder Nigel steht ihm mit Sami Kedar ein ebenbürtiger Partner zur Seite, der genussvoll sämtliche Nuancen auf seiner künstlerischen Partitur spielt. Mit dem waschechten Showstopper „It’s A Musical“ gelingt Tom Watson als Nostradamus eine echte tour-de-force performance. In dem Song, in dem sämtliche Musicals von Les Miserables, Rent, Chicago, The Music Man, Seussical, South Pacific, Evita, Annie über Guys & Dolls, A Chorus Line, Sweet Charity, Hello Dolly, Cats und Sweeney Todd rezitiert werden, gehört zu den vielen Highlights des Abends. Hier stimmt einfach alles und insbesondere für Musical Liebhaber*innen ist sowohl der Song, wie auch die gesamte Show ein süffisant, nerdiges Vergnügen. Die Kirkpatrick Brüder spielen dabei mit gängigen Klischees (Wait, so an actor is saying his lines and then, out of nowhere, he just starts singing?) und hinterfragen dabei scharf: It’s absurd. Who on Earth is going to sit there while an actor breaks into song? What possible thought could the audience think other than ‚this is horribly wrong‘? Dabei ist die Herangehensweise der Autoren und Komponisten immer liebevoll überspitzt und dabei beißend witzig. Auch aktuelle Bezüge werden immer wieder augenzwinkernd eingeflochten. Selbstverständlich wird das Patriarchat dabei konsequent auf die Schippe genommen. Hierarchische Geschlechterstrukturen werden grandios ad absurdum geführt, wenn Nigels Frau Bea (großartig und stimmstark: Rachael Archer) ihrem Gatten offeriert Think of me as your sidekick, helping you whenever I can. I’m more than just a woman. When the pressure’s coming, let me be your right-hand man. Als Running gag taucht Bea dann immer wieder in männlichen Rollen auf, da sie beweisen will, dass Frauen ohne Frage fähig sind, Männerjobs auszuführen. Bea, eine klare Anspielung auf die scharfzüngige und emanzipierte Beatrice in Much Ado About Nothing reiht sich in die Namen vieler Protagonist*innen ein, die aus Shakespeare Stücken adaptiert wurden. So verliebt sich Nigel in die, von Briana Kelly quirlig gespielte Portia (The Merchant of Venice) Jonathan Norman ist als Investor Shylock (The Merchant of Venice) zu sehen und der Nachname der Brüder Button bezieht sich ohne Zweifel auf eine der denkwürdigsten Figuren Shakespeares in A Midsummer Night’s Dream. Die Parallelen zum Shakespeare Gesamtwerk werden immer wieder humorvoll eingewoben und garantieren für einen genussvoll amüsanten Abend (Bottom’s Gonna Be on Top).


Mit viel Charme und Drive schafft es Regisseur Ewan Jones, der auch gleichzeitig für die Choreografie verantwortlich zeichnet das Maximum aus seinem Ensemble herauszuholen. Dazu eigenen sich die Kompositionen (Musical Director: Mal Hall) auch hervorragend, denn die bieten alles was ein gutes Musical baucht: echte Showstopper (It’s A Musical und Welcome to the Renaissance), dramatisch anmutende Balladen (I Love The Way) und steppende Ensemblenummern (We See The Light). What could be more amazing than a musical? With song and dance and sweet romance.
Aber noch einmal zurück zum multitalentierten Ensemble, denn die müssen an dieser Stelle alle unbedingt und ausdrücklich namentlich genannt werden: Bradley Adams, Bethany Amber-Wilde, William Beckerleg, Estelle Denison-French, Liam Huband, Jonathan Norman, Chris Tarsey und Myles Waby leisten großartiges. Oft bleiben ihnen nur wenige, hauchdünne Sekunden für Kostümwechsel, dabei spielen und singen alle mit solcher Passion, Hingabe und Präsenz ihre unterschiedlichen und zahlreichen Rollen, dass es eine wahre Freude ist, diese überschäumende Spielfreude mitverfolgen zu dürfen.
Dem English Theatre gelingt mit Something Rotten! ein waschechter Hit, von dem man sich erhofft, das er zukünftig den Weg auf viele weitere deutsche Bühnen finden wird. Take it from me they’ll be flocking to see your star-lit, won’t quit big hit, musical und das wünscht man dem English Theatre für die Weitsicht dieses Stück endlich nach Deutschland zu bringen, von Herzen.

Review: THE PRODUCERS
Musikalische Komödie Leipzig

von Marcel Eckerlein-Konrath
Broadway Flops gehören zum Great White Way In New York ebenso dazu, wie die gigantischen Erfolge. Nur sind Flops Szenarien, die jeder Broadway und Musical Produzent tunlichst vermeiden möchte. Eine Horror Nouvelle von Stephen King als abendfüllendes Musical? Gute Idee? Dass dachten sich zumindest die damaligen Produzenten, mussten jedoch nach dem Horror der auf der Bühne stattfand, gleichzeitig mit den horrenden, vernichtenden Kritiken umgehen und das Stück musste nach nur 5 Vorstellungen schließen. 8 Millionen Dollar waren so auf einmal komplett in den Sand gesetzt und „Carrie“ ging als einer der größten Flops in die Broadway Geschichte ein. Jedoch, könnte man damit nicht sogar mehr Profit machen als mit einem Erfolg? Der Ansicht sind zumindest Max Bialystock, ein windiger, aber zuletzt glückloser Theaterproduzent und sein neurotisch-verklemmter Buchhalter Leo Bloom. Sie haben den scheinbar perfekten Plan. Sie wollen die schlechteste Show aller Zeiten auf die Bühne bringen und einen vorprogrammierten Flop landen. Mit dem schauderhaften Machwerk „Frühling für Hitler“, verfasst von Franz Liebkind, einem vertrottelten Altnazi, glauben sie, das schlechteste Stück aller Zeiten gefunden zu haben. Als Regisseur engagieren sie den aufgeblasenen, aber gänzlich unbegabten Roger de Bris und sein offensichtlich talentloses Team.

Bialystock und Bloom sind siegessicher – das wird die unmöglichste Show, die der Broadway je gesehen hat, so unerträglich peinlich und geschmacklos, dass die Zuschauer noch vor dem letzten Vorhang das Theater verlassen werden. Zu einer zweiten Vorstellung soll es gar nicht erst kommen. Doch die beiden Produzenten haben die Rechnung ohne das Publikum gemacht: Ihre Show wird als geniale Farce verstanden und gerät zu einem gefeierten Hit. Damit stehen Bialystock und Bloom vor handfesten Problemen…
„The Producers“ aus der Feder von Comedy Titan Mel Brooks ist bereits selbst längst Broadway Legende geworden. Das Stück gewann stolze 12 Tony Awards und lief über 2.500 Vorstellungen. Die Melodien gehen direkt ins Ohr und reihen Ohrwurm an Ohrwurm. „The King Of Broadway“, „I Wanna Be A Producer“, „Keep It Gay“ oder „Springtime For Hitler“ sind nur einige von Brooks denkwürdigen Kreationen. Das Musical kam damals zur rechten Zeit, war die Uraufführung doch im 9/11 Jahr, in der das Publikum nach dieser fürchterlichen Tragödie nach leichter Unterhaltung gierte. Den Kopf abzuschalten und kurzerhand alles um einen herum zu vergessen, gelingt in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden nur bedingt. In einer kriegsgeprägten Ära, in der eine rechtsradikale, homophobe Partei Höchststimmen erzielt und in der braunes Gedankengut verbreitet wird, hält die Inszenierung von Dominik Wilgenbus an der Musikalischen Komödie Leipzig den Finger in die Wunde. Das gelingt dem Regisseur allerdings vortrefflich. Auch wenn sicher der ein oder andere Gag etwas plakativ und überstrapaziert wirkt, ist seine Interpretation von Brooks Show erstaunlich aktuell und erschreckend zeitkritisch. Dass bei allen aktuellen, politischen Eskalationen die Stimmung nicht kippt, ist Wilgenbus sehr zu Gute zu erhalten. Er findet eine gute Balance aus hemmungsloser, alberner Komik und sozialkritischen Tönen. Auf dieser Partitur spielt sein glänzend auftrumpfendes Ensemble fast durchgehend hervorragend. Nur hier und da sind ein paar Dissonanzen zu vernehmen.
Nick Körber kann als Leo Bloom leider nicht überzeugen. Er hatte vor der Premiere das obligatorische break a leg / Hals und Beinbruch etwas zu wörtlich genommen und seinen großen Zeh gebrochen. In den Tanzszenen wird er so kongenial mit geschmeidiger Leichtigkeit von Tänzer Pietro Pelleri vertreten. Auch wenn es Körber anzurechnen ist, dass er das Showbusiness Mantra „the Show must go on“ sehr ernst nimmt, kann er schauspielerisch wie gesanglich der Figur des Leo nicht genügend Überzeugung einhauchen. Seine Panikattacken im Stück sind wenig glaubhaft, sein Spiel zu forciert und unglaubwürdig. Besonders im direkten vergleich zu seinem Bühnenpartner Patrick Rohbeck fällt er deutlich ab.

Als Max Bialystock ist Rohbeck nämlich all dass, was die Rolle des schleimigen, nach Erfolg gierenden Produzenten ausmacht: schauspielerisch auf den Punkt, mit einem guten Gespür für Komik, gepaart mit einer solider Stimme. Besonders seine Nummer „Verrat“ im zweiten Akt, gehört zu seinen glänzenden Highlights. Rohbeck ist eine Idealbesetzung als Max. Echtes Broadway Feeling bringt Olivia Delauré als Ulla auf die Leipziger Bühne. Als Triple Threat kann sie gesanglich, schauspielerisch und vor allem tänzerisch überzeugen. In der Choreo von Mirko Mahr (Step-Choreographie Illia Bukharov) gibt Delauré buchstäblich alles und landet mit ihrer herrlich schwedisch säuselnden Interpretation der Ulla einen absoluten Volltreffer. Franz Liebkind wird von Michael Raschle zwar als hohler, aber auch gefährlicher Alt Nazi dargestellt. Mit seinen Auftritten hat er alle Lacher auf seiner Seite und hat dazu mit seinen Tauben noch eine mit sehr „speziellem“ Namen im Verschlag beherbergt. Dem larger than life Regisseur Roger deBris gibt Andreas Rainer Gesicht und Stimme. Zwischen Slapstick, gnadenloser Komik und guten gesanglichen Qualitäten ist Rainer als Hitler eine echte Wucht und löst beim Premierenpublikum wahre Beifallsstürme aus. Darf man über Hitler lachen? Die Antwort ist eindeutig: auf jeden Fall, wenn er so großartig überspitzt, zum Brüllen komisch und knallhart der Lächerlichkeit preisgegeben wird, wie hier. Jeffery Krueger ist eine herrliche doppelzüngige Carmen Ghia und erstaunliche nahe an Originalübersetzung Roger Bart. Angela Mehling lässt als Grabsch-mich-tatsch-mich keine Wünsche übrig und begeistert gleich in mehreren Rollen. Jedoch wirkt der Chor der Musikalischen Komödie etwas hölzern und kann es hier nicht ganz mit einem Musicalensemble aufnehmen. So sind einige Interaktionen nicht immer poliert pointiert und lassen etwas Agilität vermissen.Das Bühnenbild von Peter Engel ist doch etwas sehr karg und rudimentär geraten. Das Büro von Max sieht eher aus wie eine Spelunke in Harlem und Roger de Bris hat lediglich ein Sofa in Kussform zur Verfügung. Auch wenn das dem vergnüglichen Abend keinen Abbruch verschafft, hätte man hier oder da doch etwas phantasievoll ausladender arbeiten dürfen und monetär investieren können. Die Kostüme von Uschi Haug sind stückdeckend passend designt und interpretiert und können vor allem bei der Nummer „Frühling für Hitler“ visuell imponieren.

Unter der musikalischen Leitung von Michael Nündel könnte das Orchester der Musikalischen Komödie manchmal etwas mehr Drive und Tempo vertragen, sorgt aber für einen souveränen Gesamteindruck. Regisseur Dominik Wilgenbus macht mit seinen klugen politischen Einfällen vieles richtig, manchmal fehlt es allerdings an Timing und Drive. Einige Anschlüsse wirken etwas behäbig und schleppend. Die deutsche Übersetzung von Nina Schneider funktioniert gut, auch wenn natürlich einige Originalwitze unübersetzbar sind, macht Schneider einen sehr guten Job. „The Producers“ ist in Leipzig ein überaus gelungener Abend mit marginalen Abstrichen, der vor allem wegen dem viel zu selten gespielten Stück lohnt. Leipzig zeigt hier wieder einmal den Mut, auch selten gespielten Shows eine Chance zu geben.
Max und Leo hätte es sicher nicht gefreut, aber diese Show ist ein Hit!
Review: TOOTSIE
Staatstheater am Gärtnerplatz, München

von Marcel Eckerlein-Konrath
Ein neues Musical zur Uraufführung zu bringen, ist wie Kinder bekommen: nicht jeder sollte eins haben sagt Bettina Mönch in der Rolle der Julie im Musical Tootsie. Wenn das stimmt, dann sind die Eltern im vorliegenden Fallbeispiel äußerst zufriedene, denn dieses Kind erfreut sich bester Gesundheit und Agilität. Tootsie kann als Musical in der europäischen Uraufführung am Theater am Gärtnerplatz überzeugen. Die Geschichte von Michael Dorsey, der als Schauspieler keine Anstellung findet und kurzerhand in Frauenkleider schlüpft, um als Dorothy Michaels Karriere zu machen, wurde von Sidney Pollack 1982 erfolgreich mit Dustin Hoffman und Jessica Lange verfilmt. Hoffman wurde für einen Oscar nominiert und Lange bekam ihren erster Oscar als beste Nebendarstellerin. Gut 45 Jahre später gelang am Broadway der Musicaladaption ein Achtungserfolg, die Auszeichnung mit 2 Tony Awards und eine Show, die seitdem erfolgreich durch die Staaten tourt. Einiges grundliegendes hat sich seit den 80ern (zum Glück) geändert und so entstand ein neues Buch von Robert Horn und damit eine zeitgemäße, genderfluid Adaption des Stoffes. Auch wenn Tootsie als Film nichts von seinem Charme eingebüßt hat und Dustin Hoffman ein sehr sensibles, fernab von Hollywood Klischees geprägtes, sehr differenziertes Portrait liefert, ist der Film doch etwas in die Jahre gekommen und teilweise nicht gut gealtert.
Dass in der Inszenierung von Regie- und Musical Veteran Gil Mehmert, alles frisch, mitunter aber auch eine gewisse Antiquiertheit spürbar ist, macht vielleicht auch den Reiz der Produktion aus. Es gibt sehr viel zu lachen und viele schöne Ideen, die Mehmert phantasievoll umsetzt und geschickt einflechtet. Ein Highlight ist dabei eine entworfene Utopie in der Dorothy der Star gleich mehrerer weiblicher Musicalrollen in diversen Produktionen ist. Es ist also ein äußerst stimmiges Gesamtpaket was das Theater am Gärtnerplatz auf die Bretter schickt. Die einzige Frage die sich mir stellt, ist tatsächlich nur, ob das Stück als Schauspiel nicht noch besser funktioniert hätte? Die Songs sind alle ok bis gut, aber eine richtig zündende musikalische Nummer gibt es nicht und ein Ohrwurm, mit dem man das Theater verlässt bleibt leider aus. Es gibt die obligatorischen Betroffenheit- und Erkenntnissongs, gepaart mit repetitiven Ensembletracks und Pattern-Nummern, doch nichts davon bleibt dauerhaft und klingt zu austauschbar. Auf meine persönliche Musical Spotify Liste, würde ich keine der Songs hinzufügen. Komponist David Yazebeck bedient sich hier stellenweise etwas bei seinem Musical Dirty Rotten Scoundrels, doch da gab es mehr Nummern die nachhaltig überzeugen konnten. Bezeichnenderweise gewann „Tootsie“ zwar einen Tony Award für das beste Buch, ging aber im Musikapartment komplett leer aus. Eine in vielerlei Hinsicht nachvollziehbare Entscheidung. Tatsächlich hatte ich sogar eher die Songs Tootsie und It Might BeYou von Stephen Bishop aus dem Film im Kopf. Dass das Musical dennoch so hervorragend funktioniert, ist vor allem der grandiosen Besetzung und dem guten Buch zu verdanken.

Allen voran Armin Kahl als Michael / Dorothy der so gut wie durchgängig auf der Bühne ist und rasant überzeugend in den Geschlechterrollen wechselt. Das beherrscht Kahl auf großartige Weise mit viel Charme, Fleiß und Esprit. Als Ekel Regisseur mit Wedelesken Locken brilliert Alexander Franzen, während Julia Sturzlbaum als Sandy zum heimlichen Publikumsliebling avanciert. Gunnar Frietsch gibt herrlich nonchalant und deftig den Mitbewohner Jeff, während Dagmar Hellberg als kodderschnauzige Produzentin Rita alle Register zieht. Bettina Mönch ist als Julie wieder einmal sehr wandlungsfähig, charmant und berührend in ihrer Interpretation. Dabei gibt sie auch stimmgewaltig Einblicke in das Seelenleben einer Schauspielerin und welchen Kampf Frauen im Showbusiness immer noch dem Patriarchat ausgesetzt sind. Im Film wird Dorothy in einer Telenovlea als neue Hauptrolle besetzt, in der Bühnenadaption spielt sie die Amme in einer Fortsetzung von Romeo und Julia. Was im Film so hervorragend funktioniert und von Dustin Hoffman so exzellent gespielt wird, überträgt sich auf die Bühne zwar auch noch sehr amüsant, ist aber nicht ganz so zum Schreien witzig und grotesk wie im Film. Der alternde, lüsterne Soap Opera Schauspieler John Van Horn, wurde für die Bühne mit dem (fast) talentfreien Reality Star Max van Horn (stimmgewaltig: Daniel Gutmann) ausgetauscht, was gut funktioniert. So wird Dorothy auch als etwas ältere Schauspielerin von einem jüngeren Kollegen begehrt und verehrt: eine willkommene Loslösung von bestehenden Klischees und Vorurteilen. Die Musicaladaption bietet etwas, was mitunter Mangelware auf deutschen Stadttheaterbühnen ist: eine exzellente Inszenierung und die Möglichkeit für gut zwei Stunden den eigenen Alltag komplett auszublenden. So kann Tootsie mit marginalen Abstrichen überzeugen und ist ein Musical mit viel Witz, einem großen Herzen und guter Laune Garantie. Go Tootsie. Go!

Review: ROCK OF AGES
Tour, Meistersingerhalle Nürnberg

von Marcel Eckerlein-Konrath
We’re not gonna take it / No, we ain’t gonna take it / We’re not gonna take it anymore / We’ve got the right to choose, and / There ain’t no way we’ll lose it / This is our life, this is our song / We’ll fight the powers that be, just / Don’t pick on our destiny, cause / You don’t know us, you don’t belong.
Dieser Song könnte exemplarisch für den übersättigten Markt und übermäßigen Konsum der Compilation Musicals stehen. Hinter diesem Begriff verbergen sich Musicals, die aus einer Zusammenstellung oder einer Auswahl verschiedener Songs bestehen, basierend meistens aus bereits vorhandenen Musikstücken bekannter Künstler*innen oder Bands. Von richtig gut (& Juliet), über mäßig (Mamma Mia) bis katastrophal (Bat auf Of Hell) reicht hier die Palette. Mit Rock Of Ages kommt nun eins dieser Compilation Musicals auf Tour nach Deutschland, welches den Fokus auf die Musik der 80er und den Classic Rock legt. Dass die Musik zeitlos ist und nach wie vor Spaß macht steht für jeden außer Frage, und auch wenn die Songs überzeugen, so kann es dieses Musical bedauerlicherweise nicht. Allein dieses Wrack als Musical zu bezeichnen entbehrt jeder Logik und kommt einer Blasphemie gleich.
Mit der wohl belanglostesten Story, den unwitzigsten Dialogen und schlechtesten Klischees schafft Rock Of Ages es mühelos den Inhalt einer Telenovela oder der Gebrauchsanweisung gegen Vomitus zu unterbieten. Die Dialoge sind uninspirierte, unterirdisch schlechte Versuche den Hauch einer Handlung rund um die Songs der 80er zu stricken. Das was als Hommage gedacht ist gerät zu einer frivolen Demütigung. Die „Geschichte“ von Rock of Ages spielt in Los Angeles und dreht sich um das Schicksal des Rock’n’Roll Clubs „The Bourbon Room“. Dort treffen verschiedene Charaktere aufeinander, darunter der aufstrebende Rockstar Drew und die angehende Schauspielerin Sherrie. Die beiden verlieben sich ineinander und versuchen, ihre Träume in der Musikindustrie zu verwirklichen. So weit so uninteressant. Die Autoren probieren aus diesem dürftigen Konstrukt eine, ihrer Meinung nach, Parodie des Sujet Musicals zu basteln. Eine Parodie lässt sich allerdings für mich nicht erkennen, es ist eher ein Faustschlag ins Gesicht und eine Beleidigung für jeden der Musicals liebt oder auch nur ansatzweise mag.
Die „Gags“ bedienen sich sämtlicher Klischees, machen sich lustig über Homosexualität, sind rassistisch und chauvinistisch. Deswegen klage ich getreu dem Song von Twisted Sister an und rufe frei heraus: We’re not gonna take it anymore! Schluss damit aus jedem Auffahrunfall ein Musical zu zimmern. Liebe Autor*innen, wenn ihr nichts zu erzählen habt dann lasst es doch bitte direkt bleiben und verschwendet nicht die kostbare Zeit, das Geld und die Geduld eures Publikums. Denn schon dr große Anton Tschechow wusste: An der miserablen Qualität unserer Theater ist nicht das Publikum schuld. Wer diese Gags lustig findet, lacht wahrscheinlich auch über Verstopfungen und hält Richterin Barbara Salesch für intellektuelle Fernsehkunst. Ich habe schon Besuche beim Zahnarzt erlebt die lustiger waren und würde mich freiwillig einer Wurzelbehandlung unterziehen als mir Rock Of Ages noch einmal anschauen zu müssen. Nicht dass wir uns falsch verstehen. Ich finde es auch toll mich auf leicht bekömmliche Unterhaltung einzulassen und abzuschalten, ich möchte als Zuschauer allerdings nicht an der Nase herumgeführt werden. Von den Darstellern ist einzig die großartige Amanda Whitford zu nennen, die stimmlich so richtig rocken und punkten kann und die der einzige Lichtblick dieser traurigen Produktion bleibt. Kevin Thiel spielt als Lonny so sehr auf Witz, dass es schon fast körperliche Schmerzen auslöst. Wenn er unumwunden zugibt diese Show sei keine Andrew Lloyd Sondheim Show ist das ein kläglicher Versuch einen Hauch von Ironie in dieses Opus des Grauens zu hauchen. Und irgendwo auf einer Wolke sitzt Sondheim und vergießt bittere Tränen für diesen Affront. Die fünfköpfige Live Band versucht ihr Bestes aus den Songs das maximale heraus zu kitzeln, ist aber leider aufgrund des dürftigen Sounddesigns häufig übersteuert und übertönt die Darsteller weitestgehend.


Rock-Hymnen der 80er, wie Here I Go Again von Whitesnake, The Final Countdown von Europe, Can’t Fight This Feeling von Reo Speedwagon, I Want To Know What Love Is von Foreigner sind einige der Songs die Nostalgie heraufbeschwören sollen, es aber nicht so richtig transportieren können. Richtig gut klingt das tatsächlich dann, wenn das gesamte Ensemble gemeinsam singt. Einige der Songs wie z.B. We Built This City werden allerdings nur als Rezitative verwendet und erklingen leider nicht in voller Länge. Dies ist insofern enttäuschend, dass selbst die Songs so verstümmelt werden um sie der nicht vorhandenen Handlung zum Fraß vorzuwerfen. Felix Freund als Drew schreit sich unangenehm durch die Show, während Julia Tschler als Sherrie mit einigen Tönen meilenweit daneben liegt. Die Sparte Schauspiel scheint bei der lieblosen Inszenierung von Alex Balga und Natalie Holtom, überhaupt keine Rolle zu spielen und ist damit non-existent und ausgeklammert. Das was die Akteure bieten kommt über das Niveau „Amateurtheatergruppe“ nie hinaus. Die Bühne ist statisch und verändert sich im Laufe des Abends nur marginal. Dies ist allerdings auch von keiner großer Bedeutung, da Rock Of Ages auch mit einem aufwändigeren Bühnenbild nicht an Tiefe und Substanz gewönnen hätte. Wer hier seine Erfüllung findet, dem sei es gegönnt und ist mit diesem Autocrash einer Show bestens bedient. Für alle anderen die meinen We’re not gonna take it anymore sei hier eine 80er Jahre Party oder ein Konzert Tribute ans Herz gelegt. Oh, you’re so condescending / Your call is never ending / We don’t want nothin‘, not a thing from you / Your life is trite and jaded / Boring and confiscated /If that’s your best, your best won’t do.
Review: SCHOLL – DIE KNOSPE DER WEISSEN ROSE
Stadttheater Fürth


von Marcel Eckerlein-Konrath
Die Geschichte rund um die Geschwister Sophie und Hans Scholl ist eine tragische und wurde bereits in Opern, Theaterstücken und Filmen erfolgreich adaptiert. „Die weiße Rose“ war die Widerstandsgruppe in der die Geschwister mit anderen jungen Student*innen aktiv waren und die sich gegen die nationalsozialistische Regierung und ihre Ideologie des Rassismus und Antisemitismus wandten. Sophie und Hans Scholl spielten eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Flugblättern und anderen Materialien, die den Nationalsozialismus und den Krieg kritisierten. Sie wurden im Februar 1943 von der Gestapo verhaftet, nachdem sie Flugblätter an der Universität von München verteilt hatten. Sophie und Hans wurden zum Tode verurteilt und am 22. Februar 1943 hingerichtet. In dem Musical von Thomas Borchert und Titus Hoffmann wird nun die Geschichte vor dem Zusammenschluss der weißen Rose beleuchtet, der titelgebenden Knospe, dem Ursprung der Bewegung. Tirol, 1941/42: Die Geschwister Hans, Sophie und Inge Scholl verbringen zusammen mit ihren Freund*innen Traute, Ulla und Freddy den Jahreswechsel in der einsam gelegenen Coburger Hütte in den Tiroler Bergen. Politisch und weltanschaulich sind diese jungen Erwachsenen sehr unterschiedlich – sie eint aber ein breites literarisches Interesse und das Bedürfnis nach einer Auszeit von Reichsarbeitsdienst und Fronteinsatz im nationalsozialistischen Kriegsdeutschland. Sie vertreiben sich die Zeit mit Skifahren und lesen gemeinsam (politisch verbotene) Werke der Weltliteratur. Inge hat – wie immer – alles im Griff, Sophie freut sich auf ihr bevorstehendes Studium, und Traute hofft auf eine Wiederbelebung ihrer Sommerromanze mit Hans. Im letzten Moment zu Hause geblieben ist Hans‘ Freund und Vertrauter Shurik. Was Hans nicht daran hindert, in seinen Gedanken und in Erinnerung in ständigem Zwiegespräch mit Shurik zu stehen. Denn die Notwendigkeit politisch und privat zu seinen Überzeugungen zu stehen, beschäftigt Hans sehr. Denn da gibt es eine versteckte Seite seiner Persönlichkeit, die so gar nicht recht zu dem Wehrmachtssoldaten und Frauenschwarm passen will, den die anderen so gut kennen …
Ein sehr sensibles Thema also, dem sich das Kreativ Team in dieser Uraufführung auf behutsame Art und Weise nähert. Die jugendliche Naivität der Freund*innen kollidiert mit dem Hass und der Ignoranz des Nationalsozialismus in der klaustrophobischen Enge der Skihütte, die hier kongenial von Stephan Prattes schwebenden Holzbalken konstruiert wird. Wie ein Damoklesschwert schweben die Holzbalken über den Protagonist*innen und deuten bereits offensiv, teils versteckt ein Hakenkreuz und drohendes Unheil an: die Katastrophe naht. Doch das gut durchdachte Bühnenbild ist Segen und Fluch zugleich, denn durch das immer gleichbleibende Setting wirkt die Handlung oft sehr statisch und steril.
Bewegung gibt es zwar in Form der Choreografie von Andrea Danae Kingston (und im Song „Am Sonntag kommt zum Kaffeeklatsch..“) doch über die gut 2.5 Stunden ändert sich wenig am Bühnenbild. Das Stück wäre in seinem Kammerspiel und Sensibilität in einem intimeren Rahmen sicherlich besser aufgehoben, als auf der großen Bühne des Stadttheaters Fürth. So wird es schier unmöglich eine mentale, affektive Bindung mit den Figuren herzustellen.

Musikalisch gelingt Thomas Borchert in seinem Debüt als Musical Komponist nicht immer der Spagat zwischen Pop, Schlager und Kitsch. Borchert versucht sondheimesk Referenzen an den amerikanischen Komponisten einzustreuen, doch wirken die Melodien oft zu austauschbar und generisch. Es gibt wenig Titel die ins Ohr gehen und hängen bleiben. Ausnahme bildet hier „Das Leben ist anderswo“ das von Aufbau und Struktur an Sincerley, Me aus „Dear Evan Hansen“ erinnert und sich mehrere Male innerhalb des Abends wiederholt. Anrührend gelingen die Balladen „Diese Worte bleiben“ und „Schweigen“ jeweils mit den Original Texten von Hans Scholl. Für die restlichen Songs steuert Titus Hoffmann die Texte bei, der auch die Regie übernahm. Die als Hymne angelegte Nummer „Widerstand“ wirkt streckenweise unangenehm atonal. „Gemeinsam“ hingegen könnte problemlos im Schlagerradio laufen. Und „Entartet“ bemüht sich krampfhaft, an den Stil von „Hamilton“ anzuknüpfen – scheitert dabei aber auf ganzer Linie.
Die Besetzung ist durchweg erstklassig und die Darsteller*innen bilden ein homogenes Ensemble, aus dem vor allen Sandra Leitner (mit einer frappierenden Ähnlichkeit zu ihrem historischen Vorbild) als Sophie Scholl und Judith Caspari als Traute herausstehen. Leitner überzeugt stimmlich beim anspruchsvollen „Gott ist fern“ und ist auch schauspielerisch großartig, während Caspari mit „Der Doppelgänger“ punkten und auftrumpfen kann.
Warum gelingt es der Show trotzdem nicht, emotional wirklich zu berühren? An der exzellenten Besetzung liegt es nicht – im Gegenteil: Alle holen aus dem vorhandenen Material, was nur geht. Alexander Auler überzeugt als Hans mit viel Empathie und beeindruckender Stimme. Dennis Hupka bringt als naiver, aber liebenswerter Freddy charmanten Witz ins Spiel, und Fin Holzwart setzt mit „Propaganda“ zu Beginn des zweiten Aktes ein starkes Solo, das entfernt an „Kitsch“ aus Elisabeth erinnert. Eine echte Entdeckung ist Karolin Kohnert, deren intensive Inge nachhaltig im Gedächtnis bleibt. Und auch Lina Gerlitz liefert als Ulla eine durchweg überzeugende Leistung.

Der Zuschauer wird über weite Strecken mit einer wahren Flut an Informationen, Fakten und historischen Details konfrontiert – und dabei weitgehend allein gelassen. Genau hier liegt das zentrale Problem. Man fühlt sich oft weniger als Teil eines emotionalen Erlebnisses, sondern eher wie ein Schüler im Leistungskurs Geschichte, der mit erhobenem Zeigefinger belehrt wird. Mehrfach wird betont, dass „Die weiße Rose“ lediglich die Überschrift der ersten vier Flugblätter war – nicht der eigentliche Name der Gruppe. Solche Wiederholungen wirken eher belehrend als erhellend. Zu oft verliert man als Zuschauer*in den Anschluss: Zu viele Zeitsprünge, Traumsequenzen und Vorgriffe auf zukünftige Ereignisse erschweren das Verständnis und vernebeln den Blick auf das Wesentliche. Ohne Vorkenntnisse der historischen Hintergründe wird es zunehmend schwierig, der Handlung durchgängig zu folgen. Besonders die Rückblenden zu Hans und seinem Freund Shurik geraten unnötig verworren – und auch die angedeutete, aber nie wirklich entwickelte homosexuelle Spannung zwischen beiden bleibt seltsam blass und spannungslos. Es fehlt an dramaturgischer Klarheit und an einem feinen Händchen für Struktur, was sich letztlich auch im überlangen und stellenweise schleppenden Erzähltempo niederschlägt. Und doch gelingt dem Regisseur Titus Hoffmann an einigen Stellen Überraschendes. Einzelne Inszenierungsideen sind durchaus originell, aber sie können die dramaturgischen Schwächen des Stücks als Ganzes nicht auffangen. Das Musical bleibt fragmentarisch – wie eine Skizze, der es an Reife und Tiefe mangelt.
„Scholl – Die Knospe der weißen Rose“ hat ein starkes Ensemble, das engagiert und eindrucksvoll agiert. Aber der zündende Funke fehlt – ebenso wie die innere Kraft, aus dieser Knospe tatsächlich eine Blüte entstehen zu lassen.
Review: ROMEO UND JULIA
Theater des Westens, Berlin

von Marcel Eckerlein-Konrath
Das Theater des Westens ist zweifellos eine der bedeutendsten Bühnen der Hauptstadt – ein Haus, das gleichermaßen für große Namen wie Maria Callas und für generationsprägende Musicals steht. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1896 hat es unzählige künstlerische Spuren hinterlassen. Wer diesen Saal betritt, betritt ein Stück lebendige Theatergeschichte: Callas sang hier unter Karajan, Helmut Baumann brachte in den 1980ern „La Cage aux Folles“ mit durchschlagendem Erfolg auf die Bühne. Später folgten Großproduktionen wie „Chicago“, „Tanz der Vampire“ oder „Die drei Musketiere“. Der Ort hat Atmosphäre – ein Prunkbau, der Charme ausstrahlt und dessen Wände Geschichten zu erzählen scheinen. Wer das Theater betritt, spürt sofort, dass hier nicht bloß Shows stattfinden, sondern echte Theaterkunst gepflegt wird.
In diese ehrwürdige Kulisse zieht nun ein neues Stück ein: „Romeo und Julia – Liebe ist alles“ von Peter Plate und Ulf Sommer. Nach dem Erfolg von „Ku’damm 56“ kehren die beiden mit einer Uraufführung zurück. Eine neue Musicalversion von Shakespeares berühmtester Tragödie – das ist eine Ansage. Zumal das Thema bereits so oft variiert, übersetzt, verfilmt und weitergedacht wurde, dass man sich zwangsläufig fragt: Muss das wirklich noch einmal sein? Die Antwort lautet überraschenderweise: ja. Und das aus gutem Grund. In der Regie von Christoph Drewitz entsteht ein knapp dreistündiger Abend, der sich mutig auf einen spannenden Kontrast einlässt: Plate und Sommer lassen die berühmte Schlegel-Übersetzung der Shakespeare-Dialoge im Originalton stehen – elegant, klassisch, poetisch –, während die musikalische Ebene poppig-modern daherkommt. Diese Reibung zwischen Sprachwelten erzeugt Reiz und Energie. Es ist ein gelungener Balanceakt zwischen historischer Würde und popkulturellem Zeitgeist.
Die Songs fügen sich erstaunlich gut in die Handlung ein. Titel wie „Wir sind Verona“, „Es lebe der Tod“ oder „Es tut mir leid“ bleiben im Ohr – manche mit der Wucht von Popsongs, andere mit stiller Emotionalität. Mit „Liebe ist alles“ erklingt sogar ein Rosenstolz-Hit, der überraschend gut in die Dramaturgie integriert ist. „Halt dich an die Reichen“ wiederum wirkt wie ein augenzwinkernder Kommentar zur Gesellschaft und trägt deutlich die Handschrift früher Rosenstolz-Stücke.
Das junge Ensemble bringt frischen Wind auf die Bühne, auch wenn nicht alle durchgängig schauspielerisch überzeugen können. Die gesangliche Leistung ist solide bis stark, aber in den Dialogen fehlt es mancherorts an Tiefe und Natürlichkeit. Besonders im zweiten Akt, der stark textbasiert ist, wünscht man sich manchmal mehr Feinarbeit und emotionale Nuancen. Dennoch: Das Ensemble trägt den Abend mit Energie, Spielfreude und einem hohen Maß an Engagement.
Yasmina Hempel und Paul Csitkovics verkörpern das titelgebende Liebespaar glaubwürdig – auch wenn gesanglich nicht jede Passage ganz homogen gelingt. Was fehlt, ist stellenweise eine stärkere individuelle Auseinandersetzung mit ihren Figuren und mehr psychologische Klarheit. Umso stärker sind einige Nebenrollen: Joël Zupan als Todesengel ist ein echter Coup – mit seiner Countertenor-Stimme verleiht er der Figur eine fast übernatürliche Präsenz. Nico Went als Mercutio bringt Sensibilität in eine Rolle, die schnell zur Karikatur verkommen kann. Seine Nummer „Kopf sei still“ ist eindringlich und stark. Philipp Nowicki als Pater Lorenzo überzeugt mit warmer Bühnenpräsenz und klarer Stimme – besonders in „Kein Wort tut so weh wie vorbei“ und dem fast sakralen „Mutter Natur“. Steffi Irmen liefert mit der Amme eine mitreißende, manchmal berührende, manchmal urkomische Performance und wird mit „Will nicht mehr jung sein“ zum Publikumsliebling. Linda Rietdorff als Lady Capulet gibt den perfekt abgestimmten Kontrast: überdreht, selbstbezogen und brillant in ihrer Oberflächlichkeit. Das Bühnenbild bleibt bewusst zurückhaltend, setzt aber gezielt Akzente – etwa mit dem klassischen Balkon, der hier fast zum Symbol gerinnt. Besonders hervorzuheben ist die Choreografie von Jonathan Huor, die mit Präzision, Eleganz und Ausdruckskraft beeindruckt. Seine Handschrift hebt die Inszenierung auf ein deutlich höheres Niveau.


Tim Deilings Lichtdesign ergänzt das Bild wirkungsvoll – atmosphärisch, sinnlich, punktgenau. Der Epilog „Der Krieg ist aus“ rundet den Abend emotional aufgeladen ab und wartet mit einem effektvollen Schlussmoment auf, der nicht nur dramaturgisch clever, sondern auch atmosphärisch tief berührend ist.
Christoph Drewitz gelingt mit dieser Inszenierung etwas Seltenes: Er schafft eine Brücke zwischen Shakespeare und Pop, zwischen Tradition und Gegenwart, zwischen Kunst und Unterhaltung. „Romeo und Julia – Liebe ist alles“ ist keine bloße Neuerzählung, sondern eine eigenständige Interpretation für das Musiktheater von heute. Dass dabei Anklänge an Musicals wie „Hamilton“, „Spring Awakening“ oder „Elisabeth“ spürbar sind, macht den Abend umso interessanter.
Es ist zu hoffen, dass diese Produktion im Theater des Westens nicht nur das junge Publikum begeistert, sondern auch den Weg für weitere musikalische Experimente dieser Art bereitet. Denn: Wer Shakespeare mit Popmusik kombiniert, braucht Mut, Stilgefühl und – wie in diesem Fall – ein gutes Gespür für Timing.
Und das ist allen Beteiligten gelungen.
Review: EIN AMERIKANER IN PARIS
Tour, Stadttheater Fürth

von Marcel Eckerlein-Konrath
„An was denken Sie, wenn Sie an Paris denken?“ fragt Loïc Damien Schlentz in der Rolle des Adam Hochberg und adressiert dabei direkt das Publikum, noch bevor ein Ton des Krzysztof Klima Festival Orchester, Krakau erklingt. Mit dem Durchbrechen der vierten Wand kommen natürlich die obligatorischen, zu erwartenden Antworten: Eiffelturm und Champs Elysees. Dabei ist Paris soviel mehr als eine Reduzierung auf seine Sehenswürdigkeiten und L’amour. Ich selber habe einige Zeit in der französischen Hauptstadt gelebt und geliebt. Und meine Erinnerungen an die Metropole an der Seine sind durchweg positiv, wenn auch das verklärte, romantisierende Bild der Stadt sich nicht ganz bestätigt je länger man dort wohnt. Allerdings habe ich Paris auch so richtig erst während der Pandemie kennengelernt. Da waren die Möglichkeiten sich in einem größeren Radius zu bewegen extrem marginal und äußerst eingeschränkt.
Aber Paris ist eben auch ein Lebensgefühl: wunderschön, atemberaubend, beklemmend und einschüchternd zugleich. Das Essen ist so großartig wie alle Welt schwärmt, die Sprache melodisch aber voller gemeiner Stolperfallen und wenn die Stadt im Frühling erblüht und erstrahlt ist sie noch wundervoller, attraktiver und einladender denn je. Paris ist Baguette, Confit de canard und Pain au chocolat, Paris ist Marais, Père Lachaise, Parc des Buttes-Chaumont und die Opéra Garnier. Magnolien die sich im Wind bewegen und „wenn Du das Glück hattest […] in Paris zu leben, dann bleibt die Stadt bei Dir, einerlei wohin Du in Deinen Leben noch gehen wirst, denn Paris ist ein Fest fürs Leben.“ wusste schon Ernest Hemingway und ja, er hat vollkommen recht. Ich denke immer gerne an Paris, den Charme und Esprit und die einzigartige Architektur der Stadt zurück. Paris ist eben auch ein Gefühl. Umso enttäuschender ist es, dass bei der Inszenierung von Christopher Tölle sich dieses Gefühl so gar nicht manifestiert.
„Ein Amerikaner in Paris“ spielt im Jahr 1945, wo der angehende amerikanische Maler Jerry dem Charme der Pariserin Lise erliegt. Doch Jerry ist nicht ihr einziger Verehrer. Es gibt da noch den Revuestar Henry Baurel, dem sich Lise verpflichtet fühlt. Für zusätzliche Verwicklungen sorgen Jerrys Freunde, der Komponist Adam Cook, und die ebenso attraktive wie reiche Milo Roberts, eine Amerikanerin mit einem Faible für Künstler. Soweit, so unspektakulär die Handlung wären nicht die wundervollen Melodien von George Gershwin. Die Songs wurden leider ins deutsche übertragen, was der Übersetzung von Kevin Schröder etwas arg schlagerhaftes verleiht.
Das Bühnenbild (Robert Pflanz) der Tournee Produktion besteht im wesentlich aus einer Leinwand, auf die Animationen projiziert werden. Dies sind teilweise sehr verpixelt und von unzureichender Qualität. Immer wieder wird der Eiffelturm in allen nur denkbaren Perspektiven gezeigt, von der Ferne, von unten, von der Seite, von oben. Stellenweise erinnern die Projektionen etwas (mit ganz viel Phantasie) an die Poster von Jules Cheret. Es ist aber eine vertane Chance, dass, wenn man schon auf Projektionen zurückgreift, nicht die Möglichkeit nutzt und den Protagonisten selber „sein“ Paris malen lässt. In fast jeder Szene in der er auftaucht, wird erwähnt wie begabt und talentiert Jerry Mulligan als Maler ist. Bis auf eine kurze Skizze sehen wir allerdings als Zuschauer nichts, was sehr bedauerlich ist. Wenn er doch so toll malen kann, warum dies nicht auch zeigen als nur behaupten? Die Idee die Szenen wie eine Art Filmsequenz im Hintergrund zu zeigen, geht nur teilweise auf, weil dies nie zu Ende gedacht wird und die Inszenierung hindurch nicht konsequent verfolgt wird. Als Jerry ist Andrew Chadwick ein passabler Tänzer und Schauspieler, aber leider mit keiner großen Stimme gesegnet. Sein Zusammenspiel mit Mariana Hidemi als Lise hat keinerlei Chemie und das Liebespaar nehme ich den beiden zu keiner Sekunde ab. Zu haptisch und mechanisch ist ihre Beziehung, zu leidenschaftslos der Tanz.

Hidemi ist als Lise überall und nirgendwo. Dafür, dass sie eine der Hauptprotagonistinnen ist, macht sie sich recht rar, was natürlich am Original Buch von Craig Lucas liegt. Loïc Damien Schlentz (Adam Hochberg), Tilmann von Blomberg (Henri Baurel) bleiben stimmlich etwas flach und schauspielerisch sehr ausbaufähig. Lichtpunkt ist Kira Primke als Milo Davenport, die aus ihren wenig substanziellen Szenen das Beste macht. Mit guter Stimme und starker Präsenz gehört sie zu den Highlights des Abends. Es gibt storybedingt sehr viele Szenenwechsel, die vom Ensemble oft tänzerisch charmant gelöst und erledigt werden. In der Choreografie von Christopher Tölle und Nigel Watson haben die Tänzer*innen viel zu tun, denn hier wird, wie schon wie im Original Film, ein großes Hauptaugenmerk auf die Bewegung gelegt. „Ein Amerikaner in Paris“ ist eher als Ballett zu verstehen, mit mehr tänzerischen Etüden als Musical Songs. Auch wenn die bekannten Gershwin Hits „I Got Rhythm“, „The Man I Love“, „’S Wonderful“, „They Can’t Take That Away From Me” mit dabei sind, ist der Tanz hier extrem dominierend. So mag auch das Stück nicht jeden Geschmack treffen und daher auch wenig mit dem Sujet Musical gemein haben. Das französische Flair kann diese Inszenierung leider nicht elaborat transportieren. Ein paar Bistrotische oder Beret reichen da nicht aus. Damit schöpft Regisseur Tölle das volle Potential des Stückes nicht aus und versprüht damit nicht mehr als ein laues Sommerlüftchen. Die französische Kultur und Paris insbesondere sind aber noch so viel mehr. Oder wie die Amerikanerin und Autorin MJ Rose schrieb: „Paris riecht nicht nur süß, sondern melancholisch und neugierig, manchmal traurig, aber immer verführerisch. Sie ist eine Stadt für alle Sinne, für Künstler und Autoren und Musiker und Träumer, für Fantasien, lange Spaziergänge, guten Wein, für Verliebte und Geheimnisse.“
Review: CABARET
Theater Dortmund

von Marcel Eckerlein-Konrath
Es gibt Zeiten, da sitze ich vor einer Rezension und muss in Ermangelung an Quellen erfinderisch werden und tief in die Recherche eintauchen. Dies kann sich auf englischsprachige Texte beziehen, auf eigene Erinnerungen selbst besuchter Vorstellungen oder externe Fach Literatur spezialisieren. Bei einem Musical wie „Cabaret“ ist dies nicht erforderlich. Es gibt soviel Material zum Lesen, anhören und ansehen das einem schwindelig wird. Wo also beginnen? „Let’s start at the very beginning, a very good way to start.“ Ok … das ist nicht aus „Cabaret“, sondern aus „The Sound Of Music“, passt aber in diesem Fall besonders gut.
Meine erste Erfahrung mit „Cabaret“ hatte ich noch vor dem Film mit Liza Minnelli. Denn wie es für einen Theaterliebhaber wie mich vorbestimmt war, fand die erste Berührung und Begegnung mit „Cabaret“ im Theater statt. Michael Wedekind inszenierte das Stück in Aachen mit Ursula Vincent als Sally und Karl Walter Sprungala als Conférencier. Eine Inszenierung die mich in meiner Haltung und Zuneigung zu „Cabaret“ stark geprägt hat und an der sich zwangsläufig jede weitere Produktion messen musste. Auch wenn es schon einige Jahre zurückliegt, sind meine Erinnerungen an diese Produktion immer noch sehr präsent.
Mir und jedem anderen im Publikum stockte damals der Atem als der Conférencier in der finalen Szene und seiner Reprise von „Willkommen“ mit „Auf Wiedersehen“ und seinem letzten Goodbye in die Gaskammer eines namentlich nicht genannten Konzentrationslager sich für immer verabschiedete. Hier lag nicht nur die große Brisanz, sondern auch die Genialität und Kraft von Wedekinds Inszenierung.
Gerade diese Entscheidung polarisierte, aber genau das muss Theater und auch die Sektion Musical sollte dies nicht ausklammern. Auch wenn Musical manchmal leider immer noch als die leichte Muse belächelt wird.
Doch „Cabaret“ ist so viel mehr als reine Unterhaltung und die großartigen Melodien von John Kander. Es ist nicht nur eine Zeitreise in das Berlin der späten 20er Jahren, sondern eine treffsichere Charakterstudie und zeitgleich eine tiefgründige, zeitgeschichtliche Retrospektive. Vor allem ist „Cabaret“ zutiefst menschlich und emotional vor dem Hintergrund der politischen Instabilität und des sozialen Wandels der Weimarer Republik.

Musical Veteran Gil Mehmert inszeniert „Cabaret“ nun, nach dem Erfolg an der Wiener Volksoper, für die Oper Dortmund. Angesiedelt im Berliner Kit Kat Club folgt das Stück der Beziehung zwischen dem amerikanischen Schriftsteller Cliff Bradshaw (Jörn-Felix Alt) und der britischen Sängerin Sally Bowles (Bettina Mönch).
Während die beiden versuchen, ihre Beziehung aufrechtzuerhalten, verschärft sich die politische Situation in Deutschland und die Nationalsozialisten beginnen, ihre Kontrolle zu festigen. Der Club und seine Künstler*innen werden zunehmend bedroht und diskriminiert wie auch der Conférencier des Kit Kat Clubs (Rob Petzer). Er ist eine schillernde Figur, diabolisch, sarkastisch und der Master of Ceremonies. Auch die Pensionswirtin Fräulein Schneider (Angelika Milster) und ihr Freund und Nachbar Herr Schultz (Tom Zahner) werden zu Opfern ihrer Zeit.
Obwohl „Cabaret“ in der Vergangenheit eher auf kleineren Bühnen Einzug fand und vom Konzept auch ideal in ein kleines Clubtheater passt, inszeniert Gil Mehmert das Musical nun episch für die große Bühne. Hier kann er opulent und dekadent zeigen und alles aufgefahren was eine aufwendige Inszenierung ausmacht. Die Drehbühne wird hier äußerst effektiv zum Einsatz gebracht und bietet einen Blick in den KitKat Club während auf der Rückseite intime Einblicke in die Pension von Fräulein Schneider preisgegeben werden. Heike Meixner hat hier großartiges geleistet mit ihrem Design. Das gigantisch anmutende Klavier, auf dem der Conférencier die Partitur des Lebens spielt, ist dabei effektiv wie genial erdacht. So bietet die Bühne eine überdimensionale Spielwiese für die Protagonisten. Und was für eine!

Jörn-Felix Alt ist ein extrem starker Cliff. Er ist emotional und zart, dann wieder leidenschaftlich und zurücknehmend. Selten habe ich einen so guten Schauspieler wie Sänger in dieser Rolle gesehen. Eine rundherum großartige Leistung. Bettina Mönch stattet ihre Sally mit einer großen Belt Stimme aus und ihre Hit Songs „Cabaret“ und „Maybe This Time“ sitzen und sorgen daher zu Recht für fulminante Beifallsstürme des Publikums. Ihre Sally liebt und lebt bedingungslos, ist manipulativ, verrucht und herzzerreißend. Der Conférencier von Rob Pelzer führt nicht nur zynisch und provokant durch den Inhalt des Stückes, er ist zu dem lakonischen Begleiter, Beobachter und zeitgleich ein Provokateur sexueller und politischer Anspielungen. Zudem setzt Mehmert ihn auch immer wieder in anderen Momenten des Abends ein. So fungiert er mal als Kontrolleur, mal als Taxifahrer. Er ist zudem ein Symbol für den moralischen Verfall der Gesellschaft und auch die zunehmende Gewalt und Radikalität. Pelzer ist facettenreich, herrlich ironisch, singt und spielt grandios und wickelt so das Publikum sofort um den kleinen Finger. „Do you feel good?“ Doch bei der Replik bleibt einem schnell die Antwort im Halse stecken. Pelzer fungiert in seiner Rolle als Beobachter und Kommentator. Gleichzeitig ist er Teil der Geschichte, fungiert als Verbindungselement zwischen den Szenen und zwischen den Welten. Er durchbricht damit die vierte Wand und spricht das Publikum direkt an. Pelzer gibt seiner Figur ein bedrohliches und berechnendes Kalkül, das ihn unnahbar und zeitgleich sehr zugänglich macht. Sein Charakter bleibt distanziert in seinem Kosmos und ist unberechenbar in seiner Dynamik. Eine exzellente Leistung!
Sehr berührend und wunderbar fein inszeniert ist das Kammerspiel von Angelika Milster und Tom Zahner als verliebtes Paar, welches sich leider früher als später der Realität stellen muss. Wie die beiden Schauspieler dies herausarbeiten und so einfühlsam, echt und empathisch darstellen ist ein großer Gewinn für die Produktion und so avancieren die beiden zu den heimlichen Stars des Abends. Milster singt, nicht anders als zu erwarten, hervorragend und Tom Zahner rührt mit seiner nuancierten, intelligenten Darstellung zu Tränen. Überzeugend Samuel Türksoy als schleimiger Ernst Ludwig und wunderbar polternd und berlinernd die Fräulein Kost von Maja Dickmann. In der fulminanten Choreografie von Melissa King tanzen die Kit Kat Boys und Girls („each and everyone a virgin“) virtuos. Die Kostüme von Falk Bauer unterstreichen dazu perfekt die 20er Jahre in Berlin.
Die Songs von Kander und Ebb sind, hier unter dem kraftvollen Dirigat von Damian Omansen, neben den bekannten Hits, kritisch und politisch motiviert. „If You Could See Her With My Eyes“ sticht dabei besonders hervor. Eisige Gänsehaut gibt es zum Finale des ersten Aktes mit „Der morgige Tag ist mein“. Hier wird die Stimmungsmache der Nationalsozialisten besonders schmerzlich deutlich. Mehmert inszeniert dies als einen überdeutlichen, eindringlichen Fingerzeig und Weckruf. Leider ist dieser Teil aktueller denn je.

Als Jens Schmidl „Cabaret“ am Theater Freiburg inszenierte gelang ihm ein ganz spezieller Coup: der Regisseur platzierte vor Beginn jeder Vorstellung Mitglieder des Opernchores im Publikum, die während „Der morgige Tag ist mein“ sukzessive aufstanden und den rechten Arm emporstreckten. Das habe einiges an Überzeugungskraft gekostet, verrät Schmidl in einem Telefonat mit mir. Hatten doch die Sänger*innen Angst vor einer möglichen Attacke der Zuschauer. Ich sah die Produktion während meines Studiums und kann mich noch gut daran erinnern wie schockiert, paralysiert und ungläubig ich aus dem Augenwickel sah, wie mein potentieller „Sitznachbar“ sich erhob. Ja, es war Teil der Inszenierung aber ein Moment, so intensiv und eindringlich, dass ich ihn nie vergessen werde. Schmidl hatte damit den Keim des Bösen freigelegt und eindringlich demonstriert, dass Mitläufer und Anhänger rechtsradikaler Gruppierungen mitten unter uns sind. Niemand kann sicher sein.
Musikalisch hat die Show einiges zu bieten. Neben den bekannten Nummern gehen vor allem „Heirat“, „Don’t Tell Mama“ und „Two Ladies“ ins Ohr. Schön das mit „I Don’t Care Much“, eine Nummer die in der Original Broadway Inszenierung 1966 nicht mit dabei war und 1987 zum ersten Mal eingefügt wurde, mit dabei ist und vom Conférencier gesungen wird. Mehmert schafft es, das intime Kammerspiel von „Cabaret“ kongenial auf die große Bühne zu transportieren. „Cabaret“ ist eine Parabel aus Versuchung, Verführung, Hedonismus und politischen Aspekten, die uns sehr deutlich zeigt wieviel Aktualität das Musical immer noch hat. Mit einem stark aufspielenden, erstklassigen Ensemble ist diese „Cabaret“ Inszenierung eine für die Ewigkeit, so „come to the cabaret“.
Review: WEST SIDE STORY
Tour, Capitol Theater Düsseldorf


von Marcel Eckerlein-Konrath
Lonny Price hat eine lange Vergangenheit mit dem Werk von Stephen Sondheim. Angefangen hat für ihn alles nicht als Regisseur, sondern als Schauspieler in der Hal Prince Inszenierung von „Merrily We Roll Along“. Das Musical das rückwärts erzählt wird, wurde bei seiner Uraufführung zum desaströsen Flop, entwickelte im Laufe der Jahre aber eine treue Schar an Bewunderern und wird Ende 2023 mit Jonathan Groff, Daniel Radcliffe und Lindsay Mendez an den Broadway, nach einer ausverkauften off-Broadway Reihe transferiert. Die Entstehungsgeschichte von „Merrily“ ist auch Thematik der äußerst interessanten und sehr sehenswerten Dokumentation „Best Worst Thing That Ever Could Have Happened“, doch um diese soll es an dieser Stelle nicht gehen. Vielmehr zeichnet Price nun verantwortlich für ein Musical, das mit Superlativen der internationalen Presse nicht spart, die Times schrieb: „No.1 Greatest musical of all time“ und zu dem Sondheim die Lyrics beisteuerte. Sondheim war damals 25 Jahre jung, als er mit seiner Arbeit begann und noch ganz am Anfang seiner Karriere.
Zusammen mit dem großen Leonard Bernstein zu arbeiten war für ihn Ehre und Herausforderung zugleich. Sondheim arbeitete lieber allein, während Bernstein den gemeinsamen kreativen Prozess von Komponisten und Texter bevorzugte. Also fanden beide einen ungewöhnlichen Kompromiss: sie kommunizierten über das Telefon. So fand eine der wohl bedeutendsten Arbeiten der amerikanischen Musicalgeschichte auf recht unkonventionelle Art statt. Die Symbiose der beiden Jahrhundert Künstler resultierte in einem Musical, das Geschichte schrieb. Die kürzliche Neuverfilmung durch Oscar Preisträger Steven Spielberg macht deutlich, wieviel Kraft immer noch in der Musik von Bernstein steckt und wie unsterblich diese ist. Umso erstaunlicher ist es, dass in der neuen Inszenierung von Lonny Price die Show merkwürdig kalt und generisch daherkommt. Alles ist zwar makellos getimt, doch die initiale, emotionale Zündung bleibt aus. Woran liegt es also, dass diese „West Side Story“ nur marginal berührt? An dem exzellenten Dirigat von Grant Sturiale liegt es sicher nicht. Mit ganz viel Drive und Gusto führt der Maestro sein Orchester durch die Partitur Bernsteins: Jazz, lateinamerikanische Elemente und auch klassische Oper erfüllen immer noch ihre Bestimmung und zeigen die formvollendete, tiefe Schönheit und satte Qualität der Musik. Songs wie „Something’s Coming“, „Tonight“ und „Somewhere“ haben auch nach über 60 Jahren nichts von ihrer Strahlkraft eingebüßt. Gesungen und gesprochen wird bei der internationalen Tour auf Englisch. Übertitel gibt es zwar keine, dies dürfte aber aufgrund der Bekannt- und Beliebtheit des Stückes wenig problematisch sein. Überhaupt ist eine Aufführung in der Originalsprache in der Oper, bis auf sehr wenige Ausnahmen, Pflicht. Im Musical wird eine Aufführung in der Originalsprache hierzulande allerdings eher selten gezeigt und auf deutsche Übersetzungen zurückgegriffen.

Lose basiert das Musical auf Shakespeares „Romeo & Julia“ und spielt im New York der 1950er Jahre. Im Mittelpunkt der Handlung stehen die zwei rivalisierenden Straßengangs, die „Jets“ (weiße Amerikaner) und die „Sharks“ (Puerto-Ricaner) und natürlich Tony und Maria, die sich unsterblich ineinander verlieben und aus den jeweils revoltierenden Gangs kommen. Und wir alle als Zuschauer wissen: diese Verbindung endet tragisch. Als Tony ist Jadon Webster rein optisch eine Idealbesetzung für Tony. Auch wenn seine Singstimme im konträren Gegensatz zu seiner Sprechstimme steht, kann er gesanglich überzeugen, schauspielerisch aber wenig punkten. Zu aufgesetzt und wenig elaboriert ist sein Spiel, als dass es wirklich emotional berührt. Bei ihm sieht man auch gut den Knackpunkt der Inszenierung und die fehlende, mangelnde emotionale Bindung zu den Protagonisten. Ja man fühlt förmlich die Regieanweisungen von Lonny Price. „Geh jetzt hier hin – dann dort hin und verweile hier.“ Das mag zwar grundsolide sein und auch für einige Rezipienten ausreichen, mir war das allerdings zu wenig und zu statisch und vor allem fehlt das Feuer und essentielle Hingabe. Eine wirkliche Haltung und tiefe Diskrepanz fühlt man bei Websters Tony bedauerlicherweise nicht. Michel Vasquez als Maria ist da schon etwas positiver hervorzuheben. Ihr Sopran ist anrührend schön anzuhören und ihr Schauspiel etwas akzentuierter als das ihres Bühnenpartners. Allerdings fehlt ihr die jugendliche Unbekümmertheit und eine richtige Chemie mit Webster ist eher abstinent als richtig spürbar.
Ein Highlight hingegen, in der ohnehin sehr dankbaren Rolle ist tänzerisch, gesanglich und schauspielerisch Kyra Sorce als Anita. Bei ihr spürt man den Drive, die Passion und Hingabe für ihre Rolle. Ihre Anita ist leidenschaftlich, liebt und hasst bedingungslos. Etwas mehr von dieser Präsenz und Ausdruckskraft hätte der gesamten Produktion gutgetan. Anthony Sanchez bleibt als Bernardo eher blass und unscheinbar – ein Auftritt, der wenig Nachhall erzeugt. Taylor Harley überzeugt als Riff mit einer soliden, rollendeckenden Darstellung. Besonders hervor sticht Anthony J. Gasbarre III als Action: Mit beeindruckender Bühnenpräsenz und spürbarer Leidenschaft füllt er jede seiner Szenen, tänzerisch wie schauspielerisch. Man fragt sich unweigerlich, wie er wohl in der Rolle des Tony gewirkt hätte – das hätte durchaus Potenzial gehabt. Starke Nebenrollenbesetzungen runden das Bild ab: Laura Leo Kelly bringt als Anybodys angenehme Energie auf die Bühne, und auch Christopher Alvarado hinterlässt als Chino einen stimmigen Eindruck.
Tänzerisch bleiben keine Wünsche offen, orientiert sich die Choreo von Julio Monge doch stark an der legendären Original Choreografie von Jerome Robbins. Das bei einer Tourneeproduktion keine Hydraulik und fahrende Bühnenelemente zum Einsatz kommen liegt auf der Hand, doch die teilweise sehr lauten Bühnenumbauten der einzelnen Elemente und Fassaden von Anna Louizos, katapultierte mich als Zuschauer immer mal wieder aus dem Bühnenzauber zurück in die Realität des Theatersaals und meinen Sitz.

Dennoch sind die typischen New Yorker Feuertreppen, die auch maßgeblich im Original Artwork der Produktion zu finden sind, gut umgesetzt und erfüllen funktional ihren Zweck. Auch die Häuser als aufklappbare Puppenhäuser zu nutzen, geht (buchstäblich) auf. Schön und feinfühlig gelingt Price die Traumsequenz zu „Somewhere“: ein starkes Plädoyer für Liebe und eine deutliche, strikte Ablehnung von Rassismus, Homo- und Transphobie und Hass aller Art. Unterm Strich bleibt und bestätigt mit der neuen Inszenierung dieser „West Side Story“ die Erinnerung daran, wie großartig das Musical immer noch ist und wie elementar wichtig Toleranz, Akzeptanz und Empathie für jeden von uns sind.
Der letzte Funke, in dieser Neu-Inszenierung will dann am Ende aber leider nicht überspringen.
Review: Sunset Boulevard
Theater Heilbronn


von Marcel Eckerlein-Konrath
„Mein“ Sunset Boulevard liegt mir besonders am Herzen. Im Laufe der Jahre habe ich viele verschiedene Inszenierungen gesehen – abseits der legendären Originalproduktion von Trevor Nunn. Einige davon waren inspirierend, andere solide, und wieder andere würde ich lieber aus meiner Erinnerung streichen. Nun also hat Tilman Gersch das Musical für das Pfalztheater Kaiserslautern inszeniert, aktuell zu sehen im Theater Heilbronn. Das Ergebnis: Licht und leider auch viel Schatten.
Schon der Anfang wirkt unentschlossen. Anstatt Andrew Lloyd Webbers suggestiver Ouvertüre Raum zu geben, schickt Gersch den toten Joe Gillis quirlig über die Bühne. Was genau er da tut, bleibt unklar – viel mehr als gestische Spielereien sind es nicht, und das nimmt der Eröffnung jede atmosphärische Tiefe.
Ein besonders großer Stolperstein der Inszenierung wird früh deutlich: der Einsatz von Statistinnen mit Text. Das wirkt nicht nur unprofessionell – es ist auch unfair gegenüber ausgebildeten Schauspielerinnen, die jahrelang auf genau solche Rollen vorbereitet wurden. Wenn dann plötzlich Laien mit markanten Sätzen aus dem Bühnengeschehen hervorstechen, reißt das den Zuschauer unweigerlich aus der Illusion. Es ist ein mutiger, aber wenig geglückter Griff.
Die Bühne von Julia Hattstein trifft den düsteren Grundton des Stücks recht gut. Besonders ihre Kostüme aus den 40er-Jahren fangen Zeitgeist und Atmosphäre überzeugend ein. Umso enttäuschender sind leider die Outfits für Norma Desmond – erstaunlich farblos, wenn man bedenkt, dass diese Figur eigentlich schillernde Exzentrik verkörpern sollte. Die ikonischen Kreationen von Anthony Powell bleiben unerreicht – und unerreicht angestrebt.

Debra Hays gestaltet Norma solide, aber ihr fehlt es an Tiefe. „Nur ein Blick“ bleibt gesanglich ordentlich, aber ohne innere Bewegung. Ihr Gesicht bleibt seltsam ausdruckslos, ihr Wahnsinn zu brav, ihre Selbstverliebtheit zu zahm. Die große Salome-Szene verkommt zur Slapstick-Nummer – statt Größenwahn spürt man bestenfalls Verkleidungslust.
Ganz anders dagegen Daniel Eckert als Joe Gillis: stimmlich klar, darstellerisch präzise, mit gutem Gespür für Zwischentöne. Leider bleibt er oft auf sich allein gestellt – die Regie gibt ihm wenig Raum, sich in zentralen Momenten zu entfalten. Besonders schade beim Titelsong, wo plötzlich das Ballettensemble tänzelnd um ihn herum agiert. Statt Fokus auf Joes bitterem Resümee entsteht ein Bild, das den Kern der Szene verwässert.
Daniel Böhm als Max ist ein schauspielerischer Totalausfall. Obwohl er stimmlich solide auftritt, wirkt sein Max wie eine skurrile Nebenfigur aus einer anderen Welt – seltsam bemüht, unfreiwillig komisch. Wenn er bei „Das perfekte Jahr“ hilflos Mini-Schirmchen in Cocktails steckt, wirkt das eher wie ein Fremdschäm-Moment denn als liebevoller Dienst an Norma. Was hat man sich dabei gedacht?
Adrienn Cunka überzeugt stimmlich als Betty, bleibt jedoch in ihrer Darstellung zu scharfkantig. Ihre Betty ist wenig warmherzig, wirkt eher wie eine verbissene Rechthaberin. Die Chemie mit Joe bleibt so auf der Strecke. Völlig unverständlich ist die Besetzung von Peter Floch als Artie – er wirkt deutlich zu alt für die Rolle des jungen Assistenten und sorgt so für eine ständige Irritation.
Musikalisch ist das Ganze dafür auf bemerkenswert hohem Niveau. Das Orchester liefert einen vollen, opulenten Klang und ist zweifellos eines der Highlights des Abends. Leider wird der musikalische Zauber nicht immer von der szenischen Umsetzung getragen. Die Mitglieder des hauseigenen Chors scheinen in manchen Momenten eher aus einer Opernproduktion zu stammen – mit entsprechender Überzeichnung. Das Musical verlangt hier mehr Feingefühl und weniger Pathos.
Technisch lief in der besuchten Vorstellung auch nicht alles rund: Mikrofone schalteten sich zu spät oder gar nicht ein – ein Missgeschick, das bei einem professionellen Haus kaum passieren dürfte.
Die Villa von Norma – eigentlich der visuelle Anker des Stücks – bleibt erschreckend karg. Es fällt schwer, sich hier eine alternde Filmdiva vorzustellen, deren Leben einst von Glamour geprägt war. Noch verwunderlicher: Warum spielt der dramatische Schlussakt ausgerechnet vor dieser Fassade, während sich Norma hinter einem Fenster abmüht, mit Betty zu telefonieren? Eine Entscheidung, die eher umständlich als wirkungsvoll wirkt.
Sunset Boulevard ist ein großartiges Musical mit kraftvoller Musik und einer faszinierenden Geschichte, inspiriert von Billy Wilders Meisterwerk. Diese Inszenierung zeigt zwar einige gelungene Ansätze – vor allem musikalisch und in Teilen des Ensembles – bleibt aber letztlich zu uneinheitlich, zu unausgewogen, um wirklich zu berühren. Ich liebe diesen Stoff, aber ich habe schon viele Inszenierungen gesehen, die mich stärker in ihren Bann gezogen haben.
Ich werde immer bereit sein für die Nahaufnahme auf meinem ganz eigenen Sunset Boulevard – aber diesmal war das Licht auf der Bühne nicht stark genug.
Review: HAIRSPRAY
Staatstheater Nürnberg


von Marcel Eckerlein-Konrath
Es gibt Theaterabende, die sich unauslöschlich einprägen – leider auch im negativen Sinne. Ich erinnere mich an eine namenlose Produktion in einer ebenso vergessenswerten Stadt, die meine Leidenschaft für das Theater fast zum Erlöschen brachte. Was dort geboten wurde, war derart katastrophal, dass sich jeder Akt wie ein schmerzhafter Tritt in die Magengrube anfühlte. Doch dann gibt es Abende wie diesen – und plötzlich ist alles wieder gut. Melissa King bringt Hairspray von Marc Shaiman auf die Bühne des Staatstheaters Nürnberg, und man weiß wieder ganz genau, warum Theater so überwältigend sein kann.
King beweist nicht nur als Regisseurin ein sicheres Gespür für Timing, Humor und emotionale Tiefe, sie verantwortet auch – wie so oft in ihren Arbeiten – die Choreografie. Und was sie daraus macht, ist schlichtweg beeindruckend: ideenreich, energiegeladen, mitreißend und voller feiner Nuancen. Kings Inszenierung hat internationales Format, ohne sich anbiedern zu müssen. Alles wirkt präzise durchdacht, zugleich aber nie steril – es lebt, pulsiert und reißt mit.
Im Zentrum: die sensationelle Beatrice Reece als Tracy Turnblad. Ihre Bühnenpräsenz ist elektrisierend. Sie singt, tanzt und spielt mit einer Leichtigkeit und emotionalen Tiefe, die einen vom ersten Ton von „Good Morning Baltimore“ bis zum furiosen Finale von „Niemand stoppt den Beat“ durchgehend fesselt. Reece gelingt es, die Figur nicht zur Karikatur zu machen, sondern als glaubhafte, herzensgute Rebellin zu verkörpern, die für Gerechtigkeit kämpft – gegen Rassismus, Bodyshaming und Intoleranz. Ihre Stimme ist kraftvoll, ihr Spiel berührend. Ohne Frage: eine der stärksten Musical-Leistungen, die man derzeit im deutschsprachigen Raum erleben kann.
Melissa King betont selbst, wie wichtig ihr Tracys Geschichte ist: „Sie bewertet Menschen nicht nach dem Äußeren. Das Stück behandelt so viele Themen, die bis heute schmerzhaft aktuell sind – von Rassismus über Gleichberechtigung bis hin zu Selbstakzeptanz.“
Die Handlung führt uns ins Baltimore der 1960er-Jahre. Die „Corny Collins Show“ ist Tracys große Obsession – dort tanzen jeden Tag die angesagtesten Teenager. Doch Tracy entspricht nicht dem gängigen Schönheitsideal. Als sie beim Nachsitzen auf ihre afroamerikanischen Mitschüler*innen trifft und von deren Tanzstil begeistert ist, beschließt sie, ihren Traum dennoch zu verfolgen – und gleichzeitig die Rassentrennung im Fernsehen nicht länger hinzunehmen.
Neben Reece glänzt ein bemerkenswerter Cast. Allen voran Andrea Pagani als Edna und Hans Kittelmann als Wilbur – ein komödiantisches Dreamteam. Ihr Duett „Du bist zeitlos für mich“ ist hinreißend, berührend und ein Höhepunkt des Abends. Kristin Hölck gibt eine pointiert fiese Velma van Tussle mit gesanglicher Exzellenz, Marie-Anjes Lumpp lässt als zickige Amber keine Gelegenheit aus, für genüssliches Augenrollen zu sorgen. Benjamin Sommerfeld als Link Larkin hat Charme und Humor, Malcolm Quinnten Henry begeistert als Seaweed mit tänzerischer Präzision und viel Soul in der Stimme. Und wenn Deborah Woodson „Ich weiß, wo ich war“ singt, wird das Opernhaus zur Kirche. Standing Ovations fast garantiert. Auch das Dynamite-Trio (Vanessa Weiskopf, Meimouna Coffi und Taryn Nelson Di Capri) ist musikalisch wie darstellerisch ein echter Gewinn.
Die Produktion zeigt eindrucksvoll, dass ein Stadttheater wie Nürnberg sich keineswegs hinter den großen kommerziellen Häusern verstecken muss. Im Gegenteil – das hier hat Broadway- und West-End-Niveau. Die Bühne von Knut Hetzer ist variabel, funktional und atmosphärisch dicht. Die Kostüme von Judith Peter atmen den Geist der 60er-Jahre mit liebevollen Details, das Orchester unter der Leitung von Andreas Paetzold spielt leidenschaftlich und mit sattem Klang.

Einzig bleibt zu hoffen, dass das Staatstheater Nürnberg diesem Erfolg ein Signal abgewinnt: Bitte mehr Musical! Der tosende Applaus und das aufrechte Publikum am Ende des Abends zeigen deutlich – das Bedürfnis und die Begeisterung sind da.
Niemand stoppt den Beat – und hoffentlich auch nicht diese fulminante, mitreißende Inszenierung, die das Herz weitet und das Theater feiern lässt.



Review: DIE SCHÖNE UND DAS BIEST
Tour, Nürnberg

von Marcel Eckerlein-Konrath
Als Angela Lansbury 1991 im Disney-Zeichentrickfilm den Titelsong „Beauty and the Beast“ sang, konnte wohl niemand ahnen, welchen ikonischen Status sie damit begründen würde. Der Film selbst – mit Musik von Alan Menken und Texten von Howard Ashman – wurde zum Meilenstein: ein Klassiker, der über Generationen hinweg Herzen berührte. Nicht zuletzt wegen seiner zeitlosen Geschichte, die mit Charme, Witz und liebenswert gezeichneten Figuren immer wieder aufs Neue verzaubert.
Dass „Die Schöne und das Biest“ irgendwann auch die Musicalbühne erobern würde, war nur eine Frage der Zeit. Menkens Kompositionen, die bereits im Film perfekt ineinandergreifen, wirken wie gemacht für eine große Bühne. 1994 war es so weit: Das Musical feierte am Broadway Premiere und avancierte mit über 5.400 Vorstellungen zu einem der langlebigsten Hits der New Yorker Theaterwelt. Sechs neue Songs wurden für die Bühne ergänzt – klanglich stimmig, dramaturgisch reizvoll – und machten aus dem anderthalbstündigen Film ein abendfüllendes Musical.
Nun ist die Geschichte in einer Neuinszenierung des Budapester Operettentheaters unter der Regie von György Böhm erneut auf deutschsprachigen Bühnen zu erleben. Und vieles an dieser Produktion überzeugt. Das Bühnenbild von István Rózsa setzt auf Tourneetauglichkeit, ist aber dennoch wirkungsvoll. Die drehbare Konstruktion auf zwei Ebenen erlaubt fließende Übergänge und klare Szenenwechsel.
Unterstützt wird das visuelle Konzept durch ein Orchester, das unter der Leitung von Marton Rácz mit luxuriösem Klang begeistert – eine Seltenheit im Touringbetrieb, wo sonst häufig an musikalischer Besetzung gespart wird. Hier erklingt Menkens Partitur in voller orchestraler Pracht – detailreich, dynamisch und mitreißend.
Flora Széles als Belle ist ein Glücksgriff. Mit warmem Mezzo und natürlicher Bühnenpräsenz trifft sie die Figur punktgenau – selbstbewusst, verletzlich, sympathisch. An ihrer Seite gibt Sándor Barkóczi dem Biest ein glaubwürdiges Innenleben. Vor allem stimmlich überzeugt er mit einem runden, expressiven Bariton. Die Entwicklung zwischen Belle und dem Biest gelingt hier deutlich plausibler als in der Filmvorlage – Böhm findet für ihre Annäherung viele kleine Zwischentöne und zeichnet ihre Beziehung mit großer Sorgfalt.
Für Humor sorgen die verzauberten Schlossbewohner, allen voran Tamás Földes als von Unruh, der seine Rolle mit sichtlicher Spielfreude und gelungenem Timing versieht. Die Kostüme von Erzsébet Túri sind kreativ gestaltet, liebevoll detailliert – sei es Tassilos Zuckerwürfel-Hut oder Lumières echte Flammen an den Kerzenarmen. Solche verspielten Elemente unterstreichen die märchenhafte Welt ohne ins Kitschige abzudriften.
Ein starker Einstieg gelingt mit der Schattenbild-Sequenz zur Vorgeschichte des Prinzen – atmosphärisch, klar und bildstark. Schade, dass dieses Stilmittel im Verlauf der Inszenierung nicht erneut aufgegriffen wird. Die Choreographien von Éva Duda bleiben solide, ohne große Überraschungen. Besonders im Eröffnungssong „Belle“ wirken die Bewegungen etwas steif und mechanisch. Der ikonische Showstopper „Sei hier Gast“ enttäuscht dagegen leicht: Trotz Aufwand und Glitzer zündet die Nummer nicht recht. Die Tanzeinlagen wirken überinszeniert, manche Performer beinahe verloren in ihren fantasievollen Utensilienkostümen.
Nicht jede Besetzung kann überzeugen. Norman Szentmártoni als Gaston bringt zwar die nötige Physis mit, bleibt aber in Darstellung und Gesang blass. Seine Szenen wirken hölzern, fast leblos – was die eigentlich so überlebensgroße Figur spürbar schmälert.
Ein weiteres Problem zieht sich durch das Stück: die Textverständlichkeit. Vor allem in Ensemble-Passagen verschwimmen die deutschen Texte (Einstudierung: Martin Harbauer) zu einem klanglichen Brei, der den Inhalt oft nur noch erahnen lässt. Glücklicherweise gibt es Ausnahmen: Nikolett Füredi, ungarische Singstimme von Elsa in „Die Eiskönigin“, überzeugt als Madame Pottine mit viel Herzenswärme und rührt im Titelsong zu Tränen. Besonders schön und überraschend gelöst ist auch die finale Verwandlungsszene des Biests, die mit einem kreativen Kniff verblüfft.
Fazit:
Diese neue Version von Disneys Die Schöne und das Biest ist ein musikalisch hochwertiges, größtenteils stimmiges Bühnenmärchen. Sie schöpft ihre Stärken aus einem klangvollen Orchester, einer feinfühligen Regie und einem überzeugenden Leading Couple. In einigen choreografischen Momenten und bei der Textverständlichkeit bleiben Wünsche offen – dennoch gelingt insgesamt eine fantasievolle und berührende Inszenierung, die das Publikum zurück in jene Welt entführt, in der ein Fluch sich in Liebe verwandelt und Märchen immer wieder wahr werden.



Review: FLASHDANCE
Tour, Meistersingerhalle Nürnberg

von Marcel Eckerlein-Konrath
Schulterpolster, Stirnband, Kassettenrekorder – die 80er-Jahre sind ein Jahrzehnt, das modisch zwar diskutabel, musikalisch aber längst Kult ist. Kaum ein Jahrzehnt hat derart viele Evergreens hervorgebracht, die noch heute jede müde Party retten. Irene Caras „What A Feeling“ gehört dabei zu den unverwüstlichen Klassikern. Der Song gewann 1983 Oscar, Golden Globe und Grammy – und katapultierte den Film Flashdance in den Pop-Olymp. Bis heute ist der Titelsong fester Bestandteil jeder 80er-Playlist – und ein Soundtrack zum kollektiven Hüftkreisen.
2008 wurde aus dem Kultfilm schließlich ein Musical. Die Weltpremiere fand im britischen Plymouth statt, 2010 folgte das West End in London. Seither tourt die Show in unterschiedlichen Fassungen durch Großbritannien, Deutschland und die Schweiz. Aktuell ist sie unter der Regie von Christoph Drewitz wieder auf deutschen Bühnen zu sehen – und weckt damit hohe Erwartungen an ein schillerndes Revival der Neon-Ära.
Wer auf Schulterpolster, Neonfarben und Stirnbänder hofft, wird enttäuscht. Drewitz verzichtet bewusst auf ein 80er-Jahre-Zitatfeuerwerk. Die Kostüme wirken modern, beinahe zeitlos – ein klarer Bruch mit der Ästhetik des Films. Auch die Bühne von Adam Nee ist funktional, flexibel und eher industriell als nostalgisch. Pittsburghs Stahlwerke und Bars erscheinen hier als kühles, grafisches Bühnenbild, das viel Raum für Bewegung lässt – aber wenig Flair vergangener Dekaden versprüht.
Erzählt wird die Geschichte von Alex Owens, einer jungen Frau, die tagsüber in einem Stahlwerk arbeitet und nachts als Tänzerin auftritt. Ihr Traum: ein Platz an der renommierten Shipley-Tanzakademie. Als sie sich in ihren Chef Nick Hurley verliebt, gerät ihre Welt aus dem Gleichgewicht – und Alex steht vor der Entscheidung, ob sie für ihren Traum kämpfen oder in ihr altes Leben zurückkehren soll.
Die Inszenierung punktet mit einem hoch engagierten Ensemble, das mit viel Energie durch das zweistündige Programm führt. Getanzt wird zu den großen Hits des Films – „Maniac“, „Gloria“, „I Love Rock’n’Roll“ – unterstützt von Choreografien, die viel Dynamik, aber wenig erzählerischen Tiefgang bieten. Besonders Tamara Pascual als Gloria überzeugt mit starker Bühnenpräsenz, gesanglicher Präzision und einer tänzerischen Leichtigkeit, die ihresgleichen sucht. Julia Waldmayer gibt Alex als kraftvolle Kämpferin mit starker Stimme, vor allem in der finalen „What A Feeling“-Szene, die die Stimmung noch einmal auf den Siedepunkt treibt – auch wenn der große emotionale Durchbruch etwas verhalten bleibt.
Problematisch bleibt jedoch der Sound.
Immer wieder sind einzelne Stimmen zu leise abgemischt oder gehen im Halbplayback unter. Besonders Karina Schwarz als Hanna hat mit der Abmischung zu kämpfen – ihre Solonummer „Eins zu ’ner Million“ leidet unter schwacher Textverständlichkeit. An Stellen wie diesen wird die technische Umsetzung zum Stolperstein, der dem Gesamteindruck schadet.
Inhaltlich bleibt die Handlung dünn, was bei einem Musical dieser Art nicht weiter überraschen muss, aber nicht jede Nebenhandlung trägt zur Atmosphäre bei. Der Handlungsstrang um den angehenden Stand-up-Comedian Jimmy wirkt bemüht und bremst die Dynamik. Die Figur bringt weder dramaturgische Tiefe noch Humor, sondern bleibt als dramaturgisches Füllmaterial zurück.
Auch musikalisch kann das Stück nicht durchgehend überzeugen. Während die Filmsongs für echte Begeisterung sorgen, bleiben die neu komponierten Nummern von Robbie Roth und Robert Cary blass. Sie sind solide, aber ohne echten Ohrwurmcharakter – und können gegen die Strahlkraft der Originale nicht bestehen. Man fragt sich unweigerlich, warum nicht mehr 80er-Hits eingebunden wurden. Denn genau in diesen Momenten, wenn das Publikum die ersten Takte von „Maniac“ oder „What A Feeling“ erkennt, lebt die Show auf.

Flashdance bietet kurzweilige, oft mitreißende Unterhaltung, getragen von einem motivierten Ensemble und einigen starken Einzelleistungen. Die Inszenierung verzichtet auf 80er-Klischees – was mutig ist, aber nicht immer funktioniert. Der emotionale Kern bleibt etwas vage, die musikalischen Eigenkompositionen eher Mittelmaß, und der technische Klang teils störend. Trotzdem: Wer sich auf das Spektakel einlässt, erlebt einen Abend mit Tempo, Tanz und einem Hauch von Nostalgie. Und wenn am Ende der Song erklingt, auf den alle gewartet haben, ist er wieder da – der Moment, in dem man denkt: What a feeling.

Review: SUGAR
Altes Schauspielhaus Stuttgart


von Marcel Eckerlein-Konrath
Wir schreiben das Jahr 1972. Am Broadway feiert ein neues Musical von Jule Styne Premiere. Der Name Styne steht zu diesem Zeitpunkt für musikalisches Weltniveau – ein Tony- und Oscar-Preisträger, der mit Funny Girl und Gypsy zwei Meilensteine des amerikanischen Musiktheaters geschaffen hat. Es war Styne, der Barbra Streisand zu ihrem Durchbruch verhalf, und der mit Stephen Sondheim arbeitete, als dieser noch ganz am Anfang stand.
Doch 1972 ist auch ein Jahr im Umbruch: das Olympia-Attentat in München, die beginnende Watergate-Affäre, ABBAs erste Single. Die Welt wird unübersichtlicher, politischer, lauter. Inmitten all dessen wirkt ein Broadway-Musical im jazzigen Big-Band-Gewand fast wie aus der Zeit gefallen – nostalgisch, charmant, aber vielleicht auch ein wenig orientierungslos.
Sugar basiert auf Billy Wilders Komödienklassiker Some Like It Hot – einem Film, der nichts von seinem Esprit, seinem Rhythmus und seiner erzählerischen Raffinesse verloren hat. Jack Lemmon und Tony Curtis schlüpfen in Frauenkleider, nicht aus Spaß an der Verkleidung, sondern weil ihnen schlichtweg die Flucht vor der Mafia keine andere Wahl lässt. Marilyn Monroe war nie schöner, nie verletzlicher, nie witziger. Und Wilder? Inszenatorisch auf dem Höhepunkt – mit einem Gespür für Timing, Pointen und Subtext, das bis heute Maßstäbe setzt.
Der Schluss-Satz „Nobody is perfect“ ist weit mehr als ein Gag: Es ist ein plötzlicher, tiefer humanistischer Moment. Ein Satz, der Geschlechterrollen dekonstruiert und Liebe jenseits von Konventionen denkt – ein kleines Meisterwerk in fünf Worten.
Und genau damit tut sich die Bühnenadaption in Stuttgart schwer.
Das Alte Schauspielhaus bringt mit „Sugar“ ein Stück Broadway-Nostalgie auf die Bühne. Es ist ein Wiedersehen mit bekannten Figuren: Sugar Kane, Joe alias Josephine, Jerry alias Daphne. Das Ensemble spielt mit spürbarer Hingabe, die Produktion ist ambitioniert. Aber es fehlt ihr an Mut zur Eigenständigkeit.

Klaus Seiferts Inszenierung bemüht sich sehr, dem Film gerecht zu werden – vielleicht zu sehr. Trotz gegenteiliger Aussagen im Programmheft orientiert sich die Inszenierung in Tempo, Bildsprache und Dramaturgie auffällig nah am Original. Dabei reduziert die Stuttgarter Fassung die ohnehin filmisch sehr dynamische Handlung auf ein eher statisches Bühnenspiel – eine Herausforderung, der das Stück nicht immer gewachsen ist.
Der Witz, der im Film so organisch aus der Situation wächst, wirkt auf der Bühne häufig angestrengt oder gar konstruiert. Die Verwandlung der beiden Hauptfiguren in Frauen geschieht zu abrupt, das Spiel mit Gender-Klischees ist oft zu plakativ. Timing und Slapstick treffen nicht immer den richtigen Ton, manche Gags verlieren an Wirkung, weil sie zu sehr „gespielt“ wirken.
Musikalisch liefert Jule Styne ein handwerklich solides Broadway-Score mit klassischen Swing- und Jazz-Elementen. Doch der Funke will nicht so recht überspringen. Nur wenige Nummern bleiben im Ohr – allen voran „The Beauty That Drives Men Mad“ (dt.: „Schönheit“). Ansonsten fehlt es der Partitur an melodischer Schärfe, an Überraschung, an emotionalem Zugriff. Wer an Stynes große Hymnen wie „Don’t Rain on My Parade“ oder „People“ denkt, wird hier eher ernüchtert. Vielleicht war die Zeit des ganz großen kompositorischen Einfalls bei Styne 1972 schon vorbei.
Maja Sikora gibt der Rolle der Sugar eine eigene Note: charmant, präsent und mit starker Stimme – keine Monroe-Kopie, sondern eine eigenständige Bühnenfigur. Samuel Schürmann und Björn Schäffer harmonieren als Joe/Josephine und Jerry/Daphne vor allem gesanglich sehr gut, auch wenn das Spiel mit dem komödiantischen Potenzial nicht immer treffsicher ist. Ralph Morgenstern glänzt als Osgood mit sichtbarem Vergnügen an der Rolle – und liefert den berühmten Schlusssatz mit einer Nonchalance, die kurz daran erinnert, wie groß dieser Moment einst war.
Sugar ist eine liebevolle, aber harmlose Hommage an ein filmisches Meisterwerk. Die Produktion bietet unterhaltsames Musiktheater mit nostalgischem Flair, ohne eigene Akzente zu setzen. Das Stück fällt tatsächlich ein wenig aus der Zeit – aber vielleicht ist dies genau in unserer derzeitigen problematischen Gesellschaft auch ein kleiner Trost. Die große Magie des Originals bleibt unerreicht, doch als leichtfüßige Ablenkung funktioniert „Sugar“ zumindest streckenweise. Niemand ist perfekt – auch dieses Musical nicht. Aber einen charmanten Abend kann man ihm dennoch nicht absprechen.

Review: SHERLOCK HOLMES – The Next Generation
Tour, Meistersingerhalle Nürnberg


von Marcel Eckerlein-Konrath
Selbst ein Meisterdetektiv wie Sherlock Holmes würde an diesem Abend wohl vor einem Rätsel kapitulieren. Was genau hat das Kreativteam rund um Regisseur und Autor Rudi Reschke dazu bewogen, Arthur Conan Doyles legendäre Figur in ein Musical zu verwandeln? Vielleicht wird man diese Entscheidung nie ganz entschlüsseln können – genauso wenig wie viele andere Elemente dieser eigenwilligen Produktion.
Dabei mangelt es nicht an Versuchen, Spannung zu erzeugen. Wir befinden uns im London des frühen 20. Jahrhunderts. Holmes (Ethan Freeman) ist in die Jahre gekommen, residiert aber noch immer an der Seite von Dr. Watson (Matthias Otte) in der Baker Street und wartet auf den nächsten großen Fall. Ein persönliches Kapitel aus seiner Vergangenheit bringt schließlich die titelgebende „Next Generation“ ins Spiel – die Geschichte nimmt Fahrt auf, zumindest theoretisch.
Was als Krimi-Musical angekündigt wird, entwickelt sich in der Realität eher zu einer Mischung aus trägem Schauspiel mit Musikeinlagen und müder Versatzstück-Operette. Die Handlung bleibt blass, die Figuren erstaunlich flach, und die versprochene Spannung ist kaum spürbar. Jede durchschnittliche Folge von Inspektor Barnaby bietet mehr Nervenkitzel – und mehr britisches Flair. Die vollmundige Ankündigung von einem „spannungsgeladenen Abenteuer, das Artistik, Stunts und modernste Bühnentechnik“ vereine, ist wohl eher ein PR-Kunstgriff als eine tatsächliche Beschreibung.
Die Ausstattung (Reschke und Dietmar Wolf) arbeitet mit projizierten Szenerien – mal stimmig, wie beim Wasserfall zu Beginn, mal schlicht bizarr (eine Lavalampe als Stilmittel?). Requisiten werden von den Darstellerinnen und Darstellern mehr geschoben als platziert, was nicht nur ungeschickt wirkt, sondern den Erzählfluss regelmäßig stört. Miss Hudson, gespielt von Annette Lubosch mit viel Lautstärke und wenig Nuance, bringt es auf den Punkt: „Der Lack ist ab“ – eine Bemerkung, die man leider auf große Teile der Inszenierung anwenden kann.

Auch musikalisch will der Funke nicht überspringen. Die erste Nummer – „Ein Fall für Sherlock Holmes“ – lässt noch hoffen: eine brauchbare Melodie, ein Hauch von Humor, eine Spur Drive. Doch danach geht es bergab. Die Kompositionen und Texte von Christian Heckelsmüller bewegen sich zwischen Kindermusik, Jahrmarkt und Fahrstuhlpop. Die Reime wirken bemüht, manchmal unfreiwillig komisch, selten wirklich clever. Das Lied „Opium“, das inhaltlich einen fiebrigen Albtraum darstellen soll, entgleist völlig – Claudio Maniscalco kämpft sich tapfer hindurch, bleibt aber chancenlos gegen die groteske musikalische Vorlage.
Dass Ethan Freeman für dieses Projekt zugesagt hat, ist vielleicht das größte Rätsel des Abends. Freeman ist ein Routinier, ein Könner – sein Name steht für Qualität auf der Musicalbühne. Doch in dieser Rolle kann er kaum glänzen. Die Figur Sherlock Holmes bleibt seltsam leblos, wirkt uninspiriert und seltsam fern. Selbst Freemans Präsenz kann das nicht überdecken.

Auch sein Partner im Spiel, Matthias Otte als Watson, bleibt farblos. Die Rolle gibt ihm wenig bis gar nichts zu tun – und so verschwindet er nahezu in der Kulisse. Die eigentliche „Next Generation“, bestehend aus Florian Minnerop (John) und Alice Wittmer (Catherine), singt engagiert, hat aber musikalisch kaum Material, das echten Eindruck hinterlässt. Dass sich auf „unvergänglich“ das Wort „selbstverständlich“ reimen muss, sagt viel über die textliche Raffinesse.
„Da muss doch mehr sein“, fragt John im Stück – und man möchte ihm aus vollem Herzen zustimmen. Es gibt in dieser Inszenierung durchaus gute Ansätze, einzelne gelungene Bilder, kleine musikalische Lichtblicke. Doch sie reichen nicht, um das Stück zu retten. Statt eines „Bühnenspektakels, das den Zuschauer mitten ins Geschehen zieht“, erhält man einen zähen Abend, der sich über weite Strecken erstaunlich ereignislos anfühlt.
Am Ende bleibt vor allem Ratlosigkeit zurück. Der Vorhang fällt, aber das große Rätsel, wie aus dieser Geschichte ein packendes Musical hätte werden können, bleibt ungelöst.
Oder, um es mit Brecht zu sagen:
„Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen // Den Vorhang zu und alle Fragen offen.“

Review: SPONGEBOB – Das Musical
Tour, Meistersingerhalle Nürnberg


von Marcel Eckerlein-Konrath
Was wurde im Lauf der Musicalgeschichte nicht schon alles auf die Bühne gebracht. Ein Boxer, der sich musikalisch durch den Ring schlägt (Rocky), Scarlett O’Hara im dramatischen Duett mit Rhett Butler vor brennender Kulisse (Vom Winde verweht), und sogar Stephen Kings blutgetränkte Highschool-Hölle (Carrie) – letzteres ein Flop von beinahe legendärem Ausmaß. Da verwundert es kaum noch, dass nun auch ein gelber Meeresschwamm die Hauptrolle eines Musicals übernimmt.
Doch anders als erwartet war SpongeBob – Das Musical am Broadway kein totaler Reinfall. Mit immerhin 327 regulären Vorstellungen und zahlreichen Tony-Nominierungen erreichte die Produktion eine durchaus respektable Laufzeit. Für Nickelodeon offenbar Grund genug, der Show ein neues Bühnenleben zu schenken – abgespeckt, deutschsprachig und auf große Deutschlandtour geschickt.
Die Handlung bleibt dabei weitgehend gleich: Ein drohender Vulkanausbruch bringt Bikini Bottom in höchste Gefahr. Während Panik ausbricht, bleibt SpongeBob unerschütterlich optimistisch und entschlossen, seine Heimat zu retten. Unterstützung erhält er – zumindest theoretisch – von seinem besten Freund Patrick Star und weiteren Bewohnern der Unterwasserstadt. Doch zusätzlich zu den Naturgewalten sorgt auch Erzschurke Plankton mit einem weiteren finsteren Plan für Chaos. Die Lage spitzt sich zu, und nur ein echter Held kann Bikini Bottom retten. Die Bühne ist bereitet – zumindest dramaturgisch.
Die Inszenierung von Timo Radünz bemüht sich sichtlich um Zugänglichkeit und Tempo. Das Bühnenbild von Lukas Pirmin Waßmann ist pragmatisch und tourneetauglich: bunt, modular, funktional – ohne große Effekte, aber solide umgesetzt. Das Ensemble agiert mit viel Energie, doch es gelingt nicht allen, diese auch in echtes Charisma zu übersetzen. Michiel Janssens als SpongeBob ist eine wohltuende Ausnahme. Er trifft den Ton der deutschen Synchronstimme erstaunlich genau, wirkt stimmlich sicher, körperlich präsent und hat hörbar Spaß an der Rolle. Man nimmt ihm die Figur ab – in Mimik, Bewegung und Stimme.
Ganz anders Benjamin Eberling als Patrick Star: Die Rolle bleibt seltsam konturlos, die Darstellung über weite Strecken blass. Die Chemie zwischen den beiden „besten Freunden“ wirkt konstruiert, statt organisch. Gerade in einer Geschichte, die auf Freundschaft als zentrales Motiv setzt, wiegt das schwer.

Musikalisch ist die Produktion ebenso bunt gemischt wie ihr Bühnenbild – was sich allerdings weniger positiv auswirkt. Komponiert wurde das Stück von einem ganzen Kollektiv prominenter Namen, darunter John Legend, Cyndi Lauper, Sara Bareilles und David Bowie. Was auf dem Papier beeindruckend klingt, erweist sich in der Praxis als Stolperstein. Die Songs bleiben oft brav und austauschbar, es fehlt an musikalischer Handschrift und verbindendem Konzept. Kaum eine Nummer bleibt im Ohr. Man hört vieles, aber wenig davon hinterlässt Eindruck. Dass die Musik zudem ausschließlich vom Band kommt, macht die Sache nicht besser. Der Sound wirkt steril, die fehlende Live-Band nimmt der Inszenierung wichtige Energie und Lebendigkeit.
Auch szenisch wirkt der Abend über weite Strecken zäh. Die Gags sind kindgerecht – im besten Fall – aber oft wenig originell. Die Dialoge sind flach, der Wortwitz dünn, und viele Pointen verpuffen im Nichts. Besonders störend: Die Textverständlichkeit bei Songs und Dialogen ist stellenweise so schwach, dass man oft nur erahnen kann, worum es gerade geht. Für ein Stück, das sich sowohl an Kinder als auch Erwachsene richtet, ist das ein handwerkliches Manko.
Hinzu kommt die überlange Spielzeit: Mit rund zweieinhalb Stunden (inklusive Pause) wirkt die Show schlicht zu ausgedehnt. Viele Szenen hätten straffer inszeniert oder ganz gestrichen werden können. Ein frühes Beispiel dafür ist der Pirat, der bereits vor Showbeginn „komisch“ durch den Zuschauerraum irrt. Dieser Einstieg will witzig sein, zieht sich aber unangenehm lang – und leider bleibt das Gefühl eines mühsamen Anfangs für den Rest des Abends bestehen.

Und damit sind wir beim Kernproblem: SpongeBob – Das Musical weiß offenbar selbst nicht genau, wer sein Publikum sein soll. Für Kinder ist es zu lang, für Erwachsene nicht bissig oder originell genug. Die Mischung aus slapstickartiger Comedy, schräger Handlung und moralischer Botschaft ergibt kein stimmiges Ganzes. Statt großer Emotionen, starker Songs oder ansteckender Spielfreude bleibt am Ende vor allem ein Gefühl: lauwarme Unterhaltung mit viel Farbe, aber wenig Substanz.
Man kann den Machern den guten Willen nicht absprechen – und auch nicht das Engagement vieler Darsteller. Doch leider reicht das nicht aus, um einen wirklich mitreißenden Theaterabend zu gestalten. Und so bleibt die Frage, ob ein Schwamm als Musicalheld wirklich die beste Idee war, letztlich beantwortet mit „nein“.

Review: LA CAGE AUX FOLLES
Wiener Volksoper


von Marcel Eckerlein-Konrath
Ein Mann, allein im Lichtkegel. Die Bühne ist leer, die Pose stolz, der Blick entschlossen – und plötzlich ganz verletzlich. Es ist das Finale des ersten Aktes, in dem Zaza alias Albin ihre Maske fallen lässt. „Ich bin, was ich bin“ singt Drew Sarich mit bebender Stimme – und für einen Augenblick scheint die Zeit stillzustehen. Es ist ein Moment, wie er im Musical nur selten gelingt: persönlich, politisch, kraftvoll. Und der Höhepunkt eines Abends, der lange nachhallt.
Doch zurück zum Anfang – denn dort beginnt bekanntlich jede gute Geschichte. Als La Cage aux Folles 1983 am Broadway Premiere feierte, schrieb es Musicalgeschichte. Sechs Tony Awards, ein liebevoll gezeichnetes schwules Paar im Zentrum der Handlung, eine klare Botschaft für Toleranz, Respekt und Selbstbestimmung – das war zu dieser Zeit alles andere als selbstverständlich. Harvey Fiersteins Buch, in der deutschen Übersetzung von Erika Gesell und Christian Severin, hat bis heute nichts an Witz, Wärme und Charme eingebüßt. Und Jerry Hermans Komposition ist ein Feuerwerk an Melodien, deren Leichtigkeit nie über die Tiefe der Figuren hinwegtäuscht.
An der Wiener Volksoper bringt Regisseurin und Choreografin Melissa King diese klassische Revue-Komödie nun auf die Bühne – und beweist dabei ein sicheres Gespür für Timing, Tonalität und Tiefgang. Zwischen federleichter Travestie und leiser Melancholie, zwischen knalligem Showbiz und ehrlicher Intimität entfaltet sich ein Abend, der unterhält, berührt und – ganz nebenbei – Haltung zeigt.
Im Zentrum stehen Georges, Betreiber des Nachtclubs La Cage aux Folles, und Albin, sein langjähriger Partner und Star der abendlichen Shows. Seit zwanzig Jahren sind die beiden ein Paar – und Elternfigur für Georges‘ Sohn Jean-Michel, der nun ausgerechnet Anne heiraten will: die Tochter eines erzkonservativen Politikers, der Travestie-Clubs am liebsten aus dem öffentlichen Leben verbannen möchte. Um vor seinen zukünftigen Schwiegereltern eine „anständige“ Familie vorweisen zu können, bittet Jean-Michel seinen Ziehvater, sich für einen Abend zu verstellen – als diskreter „Onkel Al“.
Was folgt, ist eine wunderbar altmodische Boulevard-Komödie mit Herz – voll klug gesetzter Pointen, warmherzigem Humor und exzellentem Timing. Drew Sarich als Albin/Zaza ist das emotionale Zentrum der Inszenierung. Mit starker Bühnenpräsenz, satter Stimme und präzisem Spiel meistert er die Gratwanderung zwischen Glamour und Echtheit. Seine Zaza ist nie eine Karikatur, nie bloß schrill – sondern eine Persönlichkeit mit Tiefe, Würde und viel Gefühl. In „Ich bin, was ich bin“ legt Sarich all das offen: Stolz, Verletzlichkeit, Selbstbehauptung. Es ist ein stiller Triumph – und ein musikalischer Gänsehautmoment, wie man ihn im Musiktheater selten erlebt.

Thorsten Tinney als Georges überzeugt mit charismatischer Zurückhaltung. Er hat vielleicht nicht die stärksten Nummern des Abends, gleicht das aber mit charmantem Spiel und feinfühliger Präsenz aus. Ihre Bühnenbeziehung wirkt authentisch, getragen von gegenseitigem Respekt und echtem Gefühl – eine Liebesgeschichte, die nie in Kitsch abrutscht.
Für die meisten Lacher sorgt Jurriaan Bles als Jacob, der überambitionierte Butler und selbsternannte Zofe, der jede Szene mit seiner Energie an sich reißt – selbst wenn er nur als Stehlampe (!) auf der Bühne steht. Eine komödiantische Glanzleistung mit perfektem Timing.
Die Cagelles, das funkelnde Showensemble des Nachtclubs, tanzen, singen und bezaubern in fantasievollen Kostümen von Judith Peter. Sie sind das schillernde Rückgrat der Show – und gleichzeitig Ausdruck queerer Lebensfreude und Selbstermächtigung. Oliver Liebl gibt einen anrührenden Jean-Michel, Juliette Khalil überzeugt als Anne, und Robert Meyer sorgt mit einem besonderen Auftritt im Finale für ein weiteres Highlight. Sigrid Hauser bringt als Mutter Dindon Witz und ironisches Understatement ins Spiel.
Melissa Kings Regie verwebt all diese Elemente mit großer Leichtigkeit. Ihr gelingt der Spagat zwischen Klamauk und Klarheit, zwischen Varieté und Gefühl. Das Bühnenbild von Stephan Prattes ist wandelbar, verspielt, dabei nie überladen. In einer Szene tanzen mehrere Ruth Bader Ginsburgs über die Bühne – absurd, gewiss, aber auf eine herrlich originelle Weise. Überhaupt wirkt der ganze Abend wie ein liebevoll geschmücktes Überraschungspaket: mal glänzend, mal grell, mal zärtlich – aber immer mit Herz.
Und das ist vielleicht das Schönste an dieser Inszenierung: Sie fühlt sich an wie eine lange Umarmung. Wie ein Abend mit Freunden, bei dem man lacht, weint, feiert – und am Ende mit einem warmen Gefühl im Bauch nach Hause geht.
Wenn zum Schluss „Die beste Zeit ist jetzt“ erklingt, möchte man diesen Moment festhalten. Denn in einer Welt, die oft zu laut, zu hart, zu ernst ist, erinnert La Cage aux Folles daran, dass es sich lohnt, für die eigene Wahrheit einzustehen – mit Stolz, mit Liebe und mit ein bisschen Glitzer.
Review: PUTTING IT TOGETHER
Theater Regensburg


von Marcel Eckerlein-Konrath
Ein gewaltiges Bühnenbild mit schwebenden Kulissen, ein riesiges Ensemble oder eine dramatisch aufgebaute Handlung? All das gibt es bei Putting It Together nicht – und genau das ist einer der großen Stärken dieses Abends. Denn im Zentrum steht ein Name, der in der amerikanischen Musiktheaterlandschaft eine Ausnahmeerscheinung ist: Stephen Sondheim. Kaum ein anderer hat das Genre so klug, so komplex, so vielschichtig geprägt. Das Theater Regensburg widmet ihm nun eine Revue – und trifft damit genau ins Schwarze.
Ganze 30 Songs aus seinem reichen Schaffen werden in dieser Inszenierung von Intendant und Operndirektor Sebastian Ritschel präsentiert – eine Auswahl, die klug zusammengestellt ist und einen weiten Bogen über Sondheims Werk spannt: von Sweeney Todd über A Little Night Music und Company bis hin zu den unterschätzten Assassins und Merrily We Roll Along. Dass das Theater sich nicht für ein zugkräftiges Broadway-Musical mit Wiedererkennungswert wie My Fair Lady oder Evita entscheidet, sondern stattdessen diese anspruchsvolle Revue als deutschsprachige Erstaufführung wagt, ist mutig – und unbedingt lobenswert.
Denn: Die Songs dürften vielen Zuschauerinnen und Zuschauern zunächst kaum bekannt sein. Umso schöner ist es, dass sie an diesem Abend mit so viel Liebe, Respekt und Hingabe präsentiert werden, dass man dem ein oder anderen wohl mit Fug und Recht einen neu gewonnenen Sondheim-Fan-Status unterstellen darf.
Ein zentraler Verdienst dieses gelungenen Abends liegt bei Christian Alexander Müller, der die deutschen Übersetzungen der Songs verfasst hat. Und was für welche! Die Texte fügen sich überraschend flüssig und elegant in die komplexe Musikstruktur ein – meist ohne dass der Inhalt verwässert oder die Wirkung verloren geht. „Do I Hear a Waltz?“ wird zu „Ist das unser Tanz?“, „Marry Me A Little“ zu „Leb an meiner Seite“, „Being Alive“ zu „Heute und hier“ – und all das funktioniert erstaunlich gut. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine echte Meisterleistung.
Die Rahmenhandlung ist denkbar schlicht: Eine Cocktailparty, zwei Paare (eines älter, eines jünger) und ein Erzähler, der durch den Abend führt. Das Konzept stammt von Sondheim selbst und Julia McKenzie – und dient vor allem einem Zweck: den Songs genügend Raum zu geben. Die Szenen sind locker miteinander verbunden, ein roter Faden blitzt hier und da auf, aber das große Ganze ergibt sich letztlich aus den Themen der Musik – Liebe, Verlust, Beziehungen, Lebensentscheidungen.
Sebastian Ritschels Inszenierung bleibt bewusst zurückhaltend, fast minimalistisch – und lässt der Musik den Vortritt. Die Bühne zeigt eine große Treppe, die den Blick auf fünf leuchtende Lettern freigibt: PARTY. Je nach Stimmung des Songs wechseln sie die Farben. Eine Drehbühne sorgt für Bewegung, öffnet zwischendurch die Sicht auf das exzellent aufspielende achtköpfige Orchester unter der Leitung von Alistair Lilley. Auch Licht und Ausstattung stammen von Ritschel selbst – funktional, klar, stilvoll.
Musikalisch prallen in der Revue oft bewusst Kontraste aufeinander. Satirische Stücke treffen auf Balladen, Leichtigkeit auf Tiefe. Gerade das macht die Vielschichtigkeit von Sondheims Arbeit sichtbar – diese Mischung aus Intellekt, Ironie und Emotionalität, die ihn so unverwechselbar macht.
Das Ensemble besteht aus fünf Darsteller:innen – mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen:

Franziska Becker ist zweifellos die große Entdeckung des Abends. Ob in der zynischen Abrechnung „Damen von Welt“ („The Ladies Who Lunch“) oder im atemberaubend schnellen „Heiraten werde ich heut nicht“ („Not Getting Married Today“) – sie zeigt, wie man Musical nicht nur singen, sondern erzählen und mit Inhalt füllen kann. Ihre Bühnenpräsenz, ihre stimmliche Kontrolle und ihr komödiantisches Timing sind beeindruckend. Ihre Performance ist eine kleine Masterclass darin, wie man mit Text, Musik und Spiel eine Einheit bildet. Jede Silbe sitzt, jeder Blick erzählt mit.
Bruno Grassini bleibt dagegen etwas blass. Seine Textverständlichkeit ist – gerade zu Beginn – eingeschränkt, was den Einstieg erschwert. Auch fehlt ihm eine prägnante Szene, in der er seine Fähigkeiten voll ausspielen könnte. Im Vergleich zu Becker wirkt er leider oft zurückhaltend und wenig präsent.
Alejandro Nicolás Firlei Fernández zeigt zwar technische Präzision im Gesang und punktet durch tänzerisches Können (inklusive Stepp-Einlage), doch fehlt es seiner Interpretation an emotionaler Tiefe. Sondheims Lieder leben vom inneren Konflikt, vom Nuancenreichtum – das bleibt bei ihm etwas auf der Strecke. Besonders „Unworthy of Your Love“ („All deine Liebe“) verliert dadurch an Wirkung und driftet stellenweise ins Seichte ab.
Fabiana Locke überzeugt deutlich mehr. Sie bringt sowohl stimmlich als auch tänzerisch eine sichere Performance auf die Bühne. Besonders in Songs wie „Lovely“ („Lieblich“) und „More“ zeigt sie Spielfreude und Wandlungsfähigkeit – ein Highlight ihrer Darstellung ist „Sooner or Later“ („Heut oder Morgen“) aus dem Film Dick Tracy, das sie mit verführerischer Lässigkeit und starker Bühnenpräsenz interpretiert.
Felix Rabas, der als Conférencier das Publikum durch den Abend führt, zeigt in seinem professionellen Bühnendebüt eine solide Leistung. Seine Stärken liegen eher im tänzerischen Bereich, gesanglich fehlt es noch etwas an Ausdruckskraft. Doch seine sympathische Ausstrahlung trägt durch den Abend und lässt auf zukünftige Rollen gespannt sein.
Regisseur Ritschel selbst bringt es im Programmheft auf den Punkt: „Sich mit einem Sondheim-Stück zu beschäftigen, ist wie ein Geschenk – alles ist durchdacht und konsequent.“ Das merkt man dieser Produktion an. Putting It Together ist kein lauter Abend, keine Nummernrevue im klassischen Sinn. Es ist ein klug gebautes, musikalisch anspruchsvolles Mosaik – und eine eindringliche Hommage an einen der ganz Großen des Musiktheaters.
Bleibt zu hoffen, dass weitere deutschsprachige Bühnen diesem Beispiel folgen. Denn wer braucht schon schillernde Effekte, wenn er stattdessen Sondheim haben kann?

